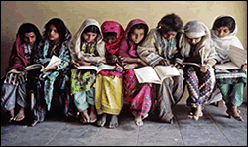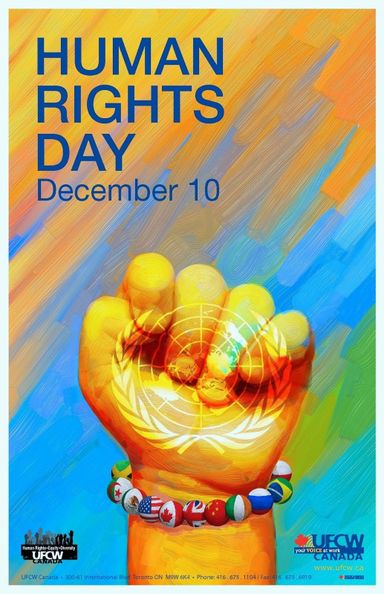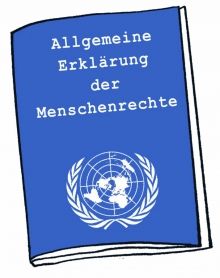Verstoß gegen Menschenrechte in Ecuador
Rechnung nicht bezahlt, Baby einbehalten
(Quito, 14. Juli 2024, Prensa Latina).- Ein ecuadorianisches Ehepaar hat heute rechtliche Schritte gegen eine Privatklinik in der südlichen Stadt Cuenca eingeleitet. Die Klinik hatte nach der Geburt ihres Kindes die Herausgabe des Säuglings verweigert. Lokale Medien berichten, dass sich die Mutter in der Einrichtung einem Kaiserschnitt unterzog, der eintausend Dollar kosten sollte. Aufgrund von Komplikationen während der Geburt und wegen des Gesundheitszustands des Neugeborenen stiegen die Kosten jedoch auf 8.300 Dollar. Die Famile versuchte, das Kind in ein öffentliches Krankenhaus zu bringen, was ihnen jedoch aufgrund der Schulden verwehrt wurde. Wenig später verstarb das Neugeborene in der Privatklinik. Nach dem Tod des Kindes wollte das Krankenhaus selbst den Leichnam des Kindes nicht herausgeben. Er konnte erst nach einigen Tagen vom Büro des Bürgerbeauftragten abgeholt werden. Mit ihrer Weigerung wollte die Klinik die Eltern zwingen, zumindest einen Teil der Schulden zu begleichen.
Anwältin Sybel Martínez, Expertin für Kinder, Jugendliche und Menschenrechte, zeigte sich empört. Ihrer Meinung nach sollte eine Klinik, die ein Neugeborenes als Zahlungsgarantie einbehält, geschlossen werden. „Diese miesen Gestalten! Erst haben sie den Eltern nicht erlaubt, das Kind in ein anderes Krankenhaus zu bringen, und dann wollten sie sich auch noch daran hindern, die Leiche abzuholen. Sechs Tage lang haben sie sich geweigert und erst nachgegeben, als das Büro des Bürgerbeauftragten sich eingeschaltet hat.“
Quelle: Nachrichtenpool Lateinamerika, Juli 2024/Brutkasten
Foto: Happi Raphael via wikimedia/Brutkasten Foto: Happi Raphael via wikimedia CC BY-SA 4.0

Kampf um die Einhaltung der Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 17.07.2024, Seite 7 / Ausland
MENSCHENRECHTE
Hoffen auf Ausreisemöglichkeit
Serbien: Der türkische Sozialist Ecevit Piroğlu sitzt weiter in Belgrad fest
Von Dieter Reinisch
An den serbischen Behörden liege es nicht, betonen die Freunde und Genossen des türkischen Aktivisten Ecevit Piroğlu in Belgrad auf Anfrage von jW. Vor mehr als einer Woche wurde er in Serbien aus der Haft freigelassen, in der er sich – mit Pausen – seit Sommer 2021 befand, davon 272 Tage im Hungerstreik.
In zwei Instanzen haben serbische Gerichte entschieden, dass er nicht in die Türkei abgeschoben werden darf. Denn Piroğlu war vor drei Jahren aufgrund eines Interpol-Haftbefehls und eines türkischen Auslieferungsersuchens bei der Durchreise am Flughafen in Belgrad festgenommen worden. Piroğlu war aktiv bei den Gezi-Park-Protesten und kämpfte in Nordsyrien als Kommandant kommunistischer Milizen gegen den »Islamischen Staat«. Ankara wirft ihm daher »Terrorismusunterstützung« vor.
Obwohl die Gerichte gegen eine Abschiebung entschieden haben, erhielt Piroğlu trotz vier Anträgen kein Asyl in Serbien. Er darf nicht in die Türkei abgeschoben werden, aber er befindet sich illegal im Land. Die serbischen Behörden drängen ihn, auszureisen – wohl auch wegen Drucks von Ankara auf Belgrad.
Seit über einer Woche versucht sein Anwalt Milan Vuković gemeinsam mit Unterstützern, eine Ausreise zu ermöglichen. Ursprünglich wollte er über die Schweiz nach Brasilien fliegen, wo er kein Visum benötigt und es kein Auslieferungsabkommen mit der Türkei gibt. Um in ein Land zu gelangen, in das Piroğlu ohne Visum einreisen kann, muss er über ein anderes Land fliegen. Doch derzeit stellt ihm kein europäisches Land ein Transitvisum zur Durchreise aus.
Die Zeit drängt, denn rechtlich hat Piroğlu eine Frist von 30 Tagen erhalten, in der er Serbien verlassen muss, betont Özgür Dağ, einer seiner Unterstützer, im jW-Gespräch am Dienstag. Er sieht auch Serbien in der Pflicht: »Sie spielen auf Zeit und schieben die Schengen-Länder als Ausrede vor. Mit anderen Worten, sie sagen, dass die Schengen-Länder nicht wollen, dass er reist.« Er glaubt, Serbien könne mehr tun.
Mit mehreren europäischen Ländern gebe es derzeit Gespräche. Transit durch die Schweiz wurde Piroğlu allerdings bereits vergangenen Mittwoch verweigert. Ein EU-Land hatte später ein entsprechendes Visum versprochen und dann wenige Stunden später wieder zurückgezogen, erzählt Piroğlus Anwalt Vuković. Ein weiteres Land hatte wiederum versprochen, »über das Wochenende über ein Transit- oder humanitäres Visum« zu entscheiden, doch bis jW-Redaktionsschluss gab es kein Ergebnis.
»Die UNO hat im Rahmen des Auslieferungsverfahrens eine Erklärung abgegeben, dass Ecevit nicht an die Türkei ausgeliefert werden darf und auch nicht in andere Länder, in denen er in Gefahr ist«, erklärt Dağ: »Eigentlich müsste daher das UNHCR den Fall aufgreifen. Andernfalls werden die Behörden Ecevit entweder erneut verhaften, weil er sich illegal in Serbien aufhält, oder ihn in ein Land wie Bosnien, Kosovo oder Dubai abschieben.« Von dort würde er dann in die Türkei geschickt werden, befürchten seine Unterstützer.
Quelle: junge welt v.17.07.2024/ IMAGO stock&people
Entscheidender Moment: Die Gezi-Proteste in Istanbul haben eine Generation geprägt (6.7.2013)

Meinungsfreiheit - ein Menschenrecht!!!
Youtube sperrt Konto der venezolanischen Plattform La Iguana TV
Er folgt auf die Blockade anderer Kanäle von Persönlichkeiten und Politikern der venezolanischen Linken.
Die Kommunikationsplattform La Iguana TV hat am Dienstag angeprangert, dass ihr YouTube-Konto mit mehr als 270.000 Abonnenten von dem sozialen Netzwerk der USA bis zum 29. Juli, einen Tag nach den Präsidentschaftswahlen in Venezuela, gesperrt wurde.
In der Klageschrift heißt es, dass dieser Kanal "eine Vielzahl von audiovisuellen Räumen bietet, die es unseren Anhängern ermöglichen, die Fakten aus erster Hand und aus einer kritischen Perspektive zu sehen".
Venezuela und Belarus treffen sich zur Stärkung der bilateralen Beziehungen
Vor dem heutigen Fall hatte sich herausgestellt, dass das Unternehmen X Corp., Eigentümer der digitalen Plattform X (ehemals Twitter), im vergangenen Juni ungerechtfertigterweise das persönliche Konto des Ministers für Kommunen und soziale Bewegungen, Ángel Prado (@AngelPradoSP), gesperrt hatte, was damals als "neuer Affront gegen die bolivarische Regierung" angeprangert wurde.
Laut Prado erfolgte die Absage damals, nachdem "der Fortschritt der von der Volksmacht nach der Nationalen Volksbefragung durchgeführten Projekte sowie der Einsatz der Kommunardenbewegung in ganz Venezuela in einer nationalen Mobilisierung geteilt worden waren".
Sie erklärten damals auch, dass es sich um einen weiteren Fall handeln würde, in dem "die Institutionen, die die digitale Kommunikation auf internationaler Ebene kontrollieren, weiterhin eine undeklarierte Zensur gegen die bolivarische Regierung von Präsident Nicolás Maduro verhängen und den Sprecher der großen Mehrheit der ihn begleitenden Volksbewegung zum Schweigen bringen".
Vor Wochen war es auch eine Nachricht, dass der venezolanische Präsident Nicolás Maduro die Zensur seines offiziellen Kontos im sozialen Netzwerk TikTok anprangerte, während er live über seine Tour durch die Avenida La Costanera berichtete, um diesen Straßenabschnitt im Bundesstaat Anzoátegui einzuweihen.
Maduro sagte damals: "Wir haben live auf Tik Tok gesendet und sie haben unser Konto zensiert, was ist die Angst? Wer hat Angst gesagt? Sie denken, dass die sozialen Netzwerke durch die Zensur in diesen Leuten landen werden, diese Leute werden von niemandem aufgehalten, nicht von Tik Tok, nicht von tausend Tik Tok. Ich trage die Welle Davids gegen Goliath und das Reich des Bösen."
Tage zuvor hatte das Staatsoberhaupt selbst seine Verurteilung des Verbots wiederholt, das die Medienunternehmen über soziale Netzwerke gegen ihn verhängt haben: "Wir werden das Verbot der sozialen Netzwerke brechen, weil wir die einzige Kraft haben, die dazu in der Lage ist, und es ist das Massenbewusstsein eines Volkes, das weiß, dass es die Mehrheit ist", sagte er während seines Besuchs im Bundesstaat Anzoátegui.
Im heutigen Fall ist La Iguana TV eine Plattform, auf der es 24 Stunden am Tag eine kontinuierliche Sendung mit Räumen wie Desde Donde Sea gibt, die von dem Philosophen und politischen Analysten Miguel Ángel Pérez Pirela geleitet wird.
Tubazos mit dem Journalisten Eligio Rojas; Face to Face, moderiert vom Journalisten Clodovaldo Hernández; Entre Líneas, von der Journalistin Nailé Manjarres; En La Pista mit dem Journalisten Mirelvis Gutiérrez; Aquí y Ahora, mit dem Journalisten Julio Riobó; und The Economics Podcast, moderiert von Esther Quiaro.
Quelle: teleSUR v.16.07.2024

Kolumbien kämpft für Menschenrechte der Palästinenser und gegen die Aggression Israel
Kolumbiens Kohleembargo gegen Israel ist ein Modell, dem man folgen sollte
Kolumbien setzt alle Kohleexporte nach Israel aus.
Kolumbien war der größte Kohleexporteur nach Israel - aber am vergangenen Samstag kündigte Präsident Gustavo Petro an, dass er die Lieferungen einstellen werde. Die kolumbianische Mobilisierung gegen den Völkermord in Gaza hat der Welt gezeigt, wie man materiellen Druck auf Israel ausüben kann.
Am 8. Juni kündigte der kolumbianische Präsident Gustavo Petro an, dass sein Land die Kohleexporte nach Israel aussetzen werde, bis der Völkermord aufhöre. Kolumbianische Kohle machte im Jahr 2023 mehr als 60 Prozent der gesamten Kohlelieferungen nach Israel aus, und das israelische Stromnetz ist für 22 Prozent seiner Produktion von Kohle abhängig. Das gleiche Netz versorgt Israels illegale Siedlungen und Waffenfabriken mit Strom sowie die Infrastruktur, die das israelische Militär für den Völkermord an den Palästinensern in Gaza nutzt.
Da Kolumbien der größte Kohleexporteur nach Israel ist, ist diese Entscheidung nicht nur ein Sieg in symbolischer Hinsicht, sondern zeigt auch die enormen Auswirkungen, die ein breiteres Energieembargo auf die Beendigung des israelischen Völkermords in Gaza haben könnte, sowie die Macht der transnationalen Organisation, die die Entscheidung herbeigeführt hat.
Nur wenige Wochen nach Beginn des Völkermords reagierte die größte kolumbianische Bergarbeitergewerkschaft Sintracarbón auf einen Solidaritätsaufruf der palästinensischen Gewerkschaftsbewegung und forderte in einer Erklärung den Stopp der kolumbianischen Kohleexporte nach Israel. Mit dieser Forderung hoben die Bergarbeiter auch Israels schändliche Rolle bei der Ausbildung von Paramilitärs und Söldnern hervor, die für weit verbreitete Gräueltaten in Kolumbien verantwortlich sind, und versammelten Arbeiter weltweit, um "die Produktion von Metallen, Mineralien und Brennstoffen zu stoppen, die in diesen Kriegen verwendet werden ... Der Planet steht am Rande eines neuen Weltkriegs, und es sind die Arbeiter, die diese Bedrohung für die Existenz der Menschheit stoppen können und haben."
Aufbauend auf diesem Aufruf initiierte eine Koalition palästinensischer Gruppen unter dem Banner des Globalen Energieembargos für Palästina eine breitere Forderung nach einem mehrstufigen Embargo gegen Energietransfers, die den israelischen Völkermord und die Apartheid über die Palästinenser schüren. Dazu gehörten Forderungen, den Energietransfer nach Israel zu beenden, den Kauf von israelischem Gas und die Zusammenarbeit von Energieunternehmen bei israelischen Energieprojekten.
Ein Energieembargo hat das Potenzial, Israel unmittelbar und langfristig unter Druck zu setzen, insbesondere durch die Kohlelieferkette. Der größte Teil der israelischen Kohle stammt aus Kolumbien und Südafrika, zwei Staaten, die sich verpflichtet haben, dem palästinensischen Volk beizustehen. Doch obwohl Südafrika das Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Israel eingeleitet hat und Kolumbien den israelischen Botschafter ausgewiesen hat, sind die Kohleexporte aus beiden Staaten unvermindert weitergegangen.
Die Kampagne "Globales Energieembargo für Palästina" entstand aus einer Verbindung zwischen den Kämpfen und baute auf einem Bündnis mit kolumbianischen Gewerkschaften und indigenen Gruppen auf, die beide – auf sehr unterschiedliche Weise – eine lange Geschichte des Kampfes gegen die Kohleindustrie in Kolumbien haben. Dieses Zusammenkommen zeigt, dass die palästinensische Sache nicht im Weltmaßstab isoliert ist, sondern Teil einer breiteren globalen Bewegung für kollektives Handeln und Befreiung.
Die beiden Hauptunternehmen, die für die Förderung von Kohle für Israel verantwortlich sind, sind die Schweizer Glencore und die amerikanische Drummond, die mehr als 90 Prozent der kolumbianischen Kohle liefern, die nach Israel geliefert wird. Ihr Kohleabbau hat seine eigenen schädlichen Auswirkungen, insbesondere auf die afrostämmige und indigene Bevölkerung des karibischen Nordens des Landes. Sie wurden von ihrem Land vertrieben, durch giftiges Kohlenpulver getötet und lebenswichtige Wasserressourcen wie den Rancheria River wurden verschmutzt und gestohlen. Umweltaktivisten, Stammesorganisationen und Gewerkschafter, die sich gegen die Umweltzerstörung wehren, werden immer wieder von Bergbaukonzernen und rechten Milizen angegriffen und ermordet.
In ihren Mobilisierungen zogen indigene Führer Parallelen zwischen den Kämpfen ihres Volkes und der Sache Palästinas und kombinierten Aufrufe an Petro, die Handelsbeziehungen zu Israel abzubrechen, mit der Forderung, Bergbauunternehmen für ihre Menschenrechtsverletzungen in Kolumbien zur Verantwortung zu ziehen und Israels Völkermord zu ermöglichen.
Petros Ankündigung erfolgte nach einem transnationalen globalen Aktionstag gegen Glencore wegen ihrer Menschenrechtsverletzungen am 28. Mai, an dem palästinensische Organisationen direkt an den Präsidenten schrieben und ihn aufforderten, die Kohleexporte zu beenden.
Diese Mobilisierung führte zu der monumentalen Entscheidung, die kolumbianischen Kohleexporte nach Israel auszusetzen. Es zeigt, wie Mobilisierungen über Grenzen hinweg, mit klaren Forderungen und durch gemeinsame Prinzipien und Werte, eine effektive Kampagne zusammenweben können, die globale Mächte, Imperialismus und Kolonialismus herausfordert.
Es wird berichtet, dass Israel über genügend Kohlereserven verfügt, um seinen unmittelbaren Bedarf zu decken. Es wird sich jedoch an andere Lieferanten wie Australien, Kasachstan, Russland und Südafrika wenden müssen, um das Defizit zu beheben, und wird wahrscheinlich gezwungen sein, mehr Prämien zu zahlen.
Dies unterstreicht die Notwendigkeit des globalen Energieembargos. Wenn andere Staaten dem Beispiel Kolumbiens folgen und sich verpflichten, die Kohlelieferungen zu unterbrechen, dann werden die wirtschaftlichen Kosten für Israel noch weiter steigen und als Hauptdruckquelle für die Zustimmung zu einem Waffenstillstand dienen.
Kolumbiens Ankündigung ist nur der Beginn einer globalen Kampagne zur Beendigung des Völkermords und zur Gerechtigkeit für das palästinensische Volk nach über sieben Jahrzehnten Kolonial- und Apartheidherrschaft Israels.
Die Solidarität zwischen Kolumbien und Palästina machte es wahrscheinlicher, dass die kolumbianische Regierung auf diese Forderungen reagieren würde. Unter anderen Umständen werden nachhaltigere Mobilisierungen erforderlich sein, um Wirkung zu erzielen. Aber auch andere Schlüsselstaaten wie Südafrika, das rund 9 Prozent der israelischen Kohle liefert, oder Brasilien, das Israel mit Rohölexporten versorgt, sollten von globalen Mobilisierungen betroffen sein.
Staaten und internationale Führer, die dem Aufruf nicht folgen, werden sich weiterhin an Israels Völkermord in Gaza mitschuldig machen. Ein Energieembargo ist ein entscheidender Weg, um diese Komplizenschaft zu beenden – und für die Weltgemeinschaft, eine prinzipientreue Haltung gegenüber dem palästinensischen Volk einzunehmen.
Rula Jamal ist Juristin und Menschenrechtsverteidigerin.
Foto: Jacobin
Quelle: Progressiv International, Ausgabe Juli 2024

Guatemala verstößt gegen Meinungs - und Pressefreiheit als wichtige Güter der Menschenrechte
Die bedingte Freilassung des guatemaltekischen Journalisten Rubén Zamora wurde annulliert
Am 15. Mai hatte Zamora von der Ersatzmaßnahme profitiert, die aus arraigo bestand, der Verpflichtung, sich alle 15 Tage in das Anwesenheitsbuch einzutragen.
Eine guatemaltekische Berufungskammer hat am Dienstag beschlossen, die bedingte Freilassung des seit dem 29. Juli 2022 inhaftierten Journalisten José Rubén Zamora aufzuheben
Zamora Marroquín war während einer Anhörung am 15. Mai vor einem Urteilsgericht der guatemaltekischen Justiz unter Hausarrest gestellt worden, die Maßnahme wurde jedoch von der Zweiten Berufungskammer aufgehoben, wie aus einer heute veröffentlichten Resolution hervorgeht.
Indigene Bevölkerung lehnt Vertreibung aus ihren Gemeinden in Guatemala ab
Die Maßnahme war dem 67-jährigen Journalisten gewährt worden, während er auf die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen ihn wegen angeblicher Geldwäsche wartet, der er 2022 beschuldigt wurde, nur 5 Tage, nachdem er in seinem Medienunternehmen El Periódico heftige Kritik am damaligen Präsidenten Alejandro Giammattei geübt hatte.
José Carlos Zamora, Sohn des Journalisten, prangerte an, dass das Netzzentrum "Yes Master" erneut die Entscheidung des Raumes bekannt gegeben habe, ohne dass sie vom jeweiligen Gericht offiziell benachrichtigt worden seien.
"Der Sprecher der Abgeordneten Guatemala von Consuelo Porras kündigt die Aufhebung der Maßnahmen zugunsten meines Vaters, des Journalisten José Rubén Zamora, an, bevor die Benachrichtigung die Parteien erreichte. Er wurde 697 Tage lang willkürlich für ein fadenscheiniges Verfahren festgehalten, in dem alle seine Rechte verletzt wurden", sagte er.
Die Vergünstigung für Zamora Marroquín wurde aufgrund eines Antrags der Sonderstaatsanwaltschaft gegen Straflosigkeit (FECI) annulliert, die international beschuldigt wird, Journalisten zu verfolgen und gerichtliche Korruptionsprozesse zu stoppen.
Der Kommunikator gründete und leitete von 1996 bis 2023 die Tageszeitung El Periódico, deren Seiten mehr als tausend Berichte über Korruption in der Regierung dokumentierten, darunter die Skandale, die zum Sturz der Regierung des ehemaligen Präsidenten Otto Pérez Molina (2012-2015) führten.
Seit fast 700 Tagen ist Zamora Marroquín in einem Gefängnis einer Militärbrigade im Norden von Guatemala-Stadt inhaftiert und hat immer noch 3 Strafverfahren gegen ihn anhängig.
Quelle: teleSUR v.26.06.2024

Israel setzt Völkermord fort
Aus: Ausgabe vom 24.06.2024, Seite 1 / Titel
GAZAKRIEG
Lazarett unter Feuer
Israelische Armee greift »sichere Zonen« in Gaza an. Größter Protestmarsch gegen Netanjahu in Tel Aviv. Kuba schließt sich Völkermordklage an
Von Karin Leukefeld
Während israelische Panzer in Rafah weiter vorrücken, wurden am Sonntag acht Palästinenser bei einem israelischen Luftangriff auf eine vom palästinensischen UN-Flüchtlingshilfswerk UNRWA betriebene Berufsschule, die für die Verteilung von Hilfsgütern genutzt wird, in der Nähe von Gaza-Stadt getötet, so palästinensische Zeugen gegenüber Reuters.
Seit Freitag wurden mehr als 100 Palästinenser im Gazastreifen getötet. In der Nacht zu Sonnabend war bereits das Büro des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) beschädigt worden, als schwere Geschosse »nur wenige Meter entfernt« einschlugen. Das teilte die Organisation via X mit. Das Büro liegt in der Stadt Mawasi (Rafah) inmitten von Zelten Hunderter Vertriebener. Das Gebiet war von Israel als »sichere Zone« ausgewiesen worden. Das IKRK betreibt dort ein Feldlazarett, in dem nach dem Angriff 22 Tote und 45 Verletzte eingeliefert wurden. Die israelische Armee sagte eine Untersuchung zu und gab an, den Ort nicht attackiert zu haben. Mindestens 50 Menschen starben bei Angriffen israelischer Kampfjets auf das Al-Shati-Flüchtlingslager und den Bezirk Al Tuffah in Nordgaza am Sonnabend. Beide Gebiete waren ebenfalls als »sichere Zonen« ausgewiesen worden.
Die Weltgesundheitsorganisation warnte am Freitag, dass die sengende Hitze im Gazastreifen die medizinische Notlage der vertriebenen Palästinenser noch verschlimmern könne. Das Welternährungsprogramm hat davor gewarnt, dass im Gazastreifen aufgrund des Mangels an sauberem Wasser, Lebensmitteln und medizinischer Versorgung eine erhebliche Gesundheitskrise droht. Richard Peeperkorn, WHO-Vertreter für Gazas und das Westjordanland, sagte: »Das Wasser ist durch die Hitze, und die Lebensmittel werden aufgrund der hohen Temperaturen noch mehr verderben. Wir werden Moskitos und Fliegen bekommen, Dehydrierung und Hitzschlag.«
In Tel Aviv kam es derweil am Sonnabend zu einem Höhepunkt der nahezu täglichen Protestmärsche gegen die Regierung von Netanjahu. Rund 150.000 Menschen füllten die Straßen um den »Demokratieplatz«. Tausende Angehörige und Unterstützer der israelischen Geiseln in Gaza kamen zu einer weiteren Demonstration in der Stadt zusammen. Die Menschen forderten den Rücktritt der Regierung, Neuwahlen, einen Waffenstillstand Verhandlungen, um die noch verbliebenen israelischen Geiseln aus Gaza zu ihren Familien zurückzubringen.
Juval Diskin, ehemaliger Chef des Inlandsgeheimdienstes Shin Beth, bezeichnete Netanjahu als »den schlimmsten Ministerpräsidenten«, den das Land jemals gehabt habe. Die Demonstranten trugen Schilder mit der Aufschrift »Schluss mit dem Krieg« und »Krimineller Minister« (»Crime Minister« statt »Prime Minister«) in Anspielung auf Netanjahu, den wegen Korruption eine Haftstrafe erwartet. Demonstranten überschütteten sich mit roter Farbe aus »Protest gegen den Tod der israelischen Demokratie« unter Netanjahu. Einige Israelis richteten ihre Parolen auch an den Rest der Welt, um deutlich zu machen: »Wir sind nicht unsere Regierung.«
Am Wochenende teilte das kubanische Außenministerium mit, dass Kuba sich der Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof anschließt. Die »Verbrechen gegen das palästinensische Volk durch die unverhältnismäßige und willkürliche Gewalt Israels« müssten gestoppt werden, hieß es in der Erklärung.
Quelle: junge welt v.24.06.2024/ Ayman Al Hassi/REUTERS Die Opfer im Gazakrieg sind oft Kinder: Die Hälfte der Bevölkerung Gazas ist unter 18 (Gaza, 22.6.2024)

22.06.
2024
Ecuador verstößt gegen Menschenrechte- Schutz der indigenen Rechte
Ecuadorianischer Präsident beginnt mit dem Bau eines Hochsicherheitsgefängnisses
Eine Reihe von Organisationen und sozialen Bewegungen wiesen darauf hin, dass das Gefängnis ein unnötiges und antitechnisches Projekt ist.
Inmitten von Ablehnung und Kritik von sozialen Organisationen und Menschenrechtsverteidigern leitete Ecuadors Präsident Daniel Noboa am Freitag die Zeremonie zum Beginn der Arbeiten an einem Hochsicherheitsgefängnis in der Provinz Santa Elena.
Das Gefängnis wäre eines von zwei Hochsicherheitsgefängnissen, die der ecuadorianische Präsident für kriminelle Anführer zu bauen versprach, nach einem ähnlichen Modell wie in El Salvador.
Die Zahl der Todesfälle durch die Regenfälle in Ecuador steigt auf 17
"Heute markieren wir einen der wichtigsten Meilensteine in unserem Kampf gegen den Terrorismus und die Mafia, die sich seit Jahrzehnten ungestraft in unserem Land verschanzt haben", sagte Noboa, als er den Grundstein für den Bau des Gefängnisses legte.
Der Direktor des Nationalen Dienstes für umfassende Betreuung von Erwachsenen, denen die Freiheit entzogen wurde, und jugendlichen Straftätern (SNAI), Luis Zaldumbide, wies darauf hin, dass sich das Strafvollzugszentrum Santa Elena über 16,2 Hektar erstrecken und eine Kapazität für 800 Insassen haben wird.
Nach Angaben des Leiters der SNAI werden die Kosten für das neue Hochsicherheitsgefängnis 52 Millionen Dollar betragen und er sagte, dass es in 300 Tagen gebaut werden soll.
Bau eines Hochsicherheitsgefängnisses abgelehnt
In der Nähe des Grundstücks, auf dem das Gefängnis gebaut werden soll, protestierten die Anwohner gegen das Projekt.
In diesem Sinne wiesen etwa zwanzig Organisationen und soziale Bewegungen, die sich in der Allianz der Organisationen für Menschenrechte zusammengeschlossen haben, in einer Erklärung darauf hin, dass "dies ein unnötiges und antitechnisches Projekt ist".
Darüber hinaus erwähnten sie, dass die Verletzung kollektiver Rechte und der Rechte der Natur "zu denselben gescheiterten Lösungen führt, die sich auf die ecuadorianische Gefängniskrise ausgewirkt haben".
Sie versicherten auch, dass das Land, auf dem das Gefängnis gebaut werden soll, "angestammten indigenen Gemeindemitgliedern von Bajada de Chanduy" gehöre.
"Auf diesem Land befindet sich der Wald des La Envidia-Grundstücks, der ein primäres Ökosystem ist und Bäume beherbergt, die seit mehr als hundert Jahren existieren", heißt es in einem Teil der Erklärung, die in den sozialen Netzwerken geteilt wurde.
Von der Allianz der Menschenrechtsorganisationen forderten sie, eine vorherige, kostenlose und informierte Konsultation mit den Bewohnern der Gemeinde Bajada de Chanduy durchzuführen, die für Projekte gilt, die auf indigenem Territorium durchgeführt werden.
Die Allianz versicherte, dass es bei dem Projekt dieses Gefängnisses "keine Umweltverträglichkeitsberichte, Berichte über archäologische Überreste von Küstenkulturen und Prozesse der freien, vorherigen und informierten Konsultation geben wird".
Quelle: teleSUR v.220.6.2024




Peru verstößt gegen Menschenrechte
Neues Gesetz könnte Aufklärung von Menschenrechtsverbrechen behindern
(Lima, 16. Juni 2024, poonal/cejil).- Der peruanische Kongress wird in Kürze über einen Gesetzesentwurf entscheiden, der die Straffähigkeit bei Menschenrechtsverbrechen auf rückwirkend 20 Jahre begrenzen soll. Das geplante „Gesetz zur Festlegung der Anwendung und des Anwendungsbereichs von Verbrechen gegen die Menschheit und Kriegsverbrechen (6951/2023-CR)“ besagt, dass nur solche Verbrechen bestraft werden können, die nach dem ersten Juli 2002 begangen wurden, das heißt, nach dem Inkrafttreten des Römischen Statuts, mit dem der Internationale Strafgerichtshof geschaffen wurde. In einer ersten Lesung am 6. Juni erhielt das Projekt bereits 60 Ja-Stimmen, 36 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen. Sollte die zweite Abstimmung ähnlich ausgehen, könnte das Projekt bereits in wenigen Tagen zu geltendem Recht erklärt werden. Dagegen regt sich Protest: Mit der Verabschiedung eines solchen Gesetzes würde Peru gegen internationales Recht verstoßen, warnen UN-Menschenrechtsexpert*innen. Die Verabschiedung der Gesetzesvorlage würde die Verfolgung und Verurteilung von Tätern behindern und den Opfern das Recht auf Wahrheit und Wiedergutmachung absprechen. Auch der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte (IACHR) forderte den peruanischen Staat auf, das Verfahren zum Gesetzentwurf 6951/2023-CR auszusetzen. Nach Auskunft des Obersten Rats der Staatsanwaltschaft würden dann etwa 600 laufende Fälle als abgeschlossen erklärt und zu den Akten gelegt werden. Dies sei ein „falsches und bedauerliches Signal“. Derart schwerwiegende Taten wie das Massaker von Barrios Altos von der strafrechtlichen Verfolgung auszunehmen widerspreche zudem den geltenden nationalen und internationalen Normen.
Wer profitiert?
Unmittelbar von dem neuen Gesetz profitieren würde Alberto Fujimori. Im Jahr 2007 wurde der ehemalige peruanische Präsident nach seiner Auslieferung aus Chile vor Gericht gestellt und für die Verbrechen der Colina-Gruppe zur Verantwortung gezogen: Am 3. November 1991 stürmte ein Kommando der paramilitärischen Gruppe eine Party in einem Gebäude in Barrios Altos, einem Stadtteil von Lima, zwang die Anwesenden, sich auf den Boden zu legen und tötete wahllos 15 Menschen, darunter einen 8-jährigen Jungen. Acht Monate später, am 18. Juli 1992, wurden im Stadtteil La Cantuta ein Professor und neun Universitätsstudenten entführt und ermordet. Auch dieses Verbrechen wird der Colina-Gruppe zugeordnet. Fujimori wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt, im Dezember letzten Jahres jedoch aus humanitären Gründen begnadigt – gegen den Willen des Interamerikanische Gerichtshofs. Die Anhänger des 85-jährigen Ex-Diktators verfügen auch heute noch über eine starke Position im Parlament und werden selbstredend für die Verabschiedung des Gesetzes stimmen.
Auch die ermordeten Häftlinge in den Gefängnissen El Frontón, Lurigancho und Santa Bárbara wären dann kein Ermittlungsfall mehr. Nach Gefängnisunruhen im Juni 1986 waren die Häftlinge des Terrorismus beschuldigt und außergerichtlich hingerichtet worden. Diese und andere Verbrechen im Rahmen der Auseinandersetzungen zwischen dem peruanischen Staat und den linksextremen Guerillabewegungen werden bis heute von peruanischen und internationalen Justizbehörden verfolgt.
Gegen die Hälfte der Kongressmitglieder wird ermittelt
Laut Expert*innenmeinung darf die Verjährungsfrist bei groben Verstößen gegen internationale Menschenrechtsnormen oder gegen das humanitäre Völkerrecht nicht aufgehoben werden. Die Unverjährbarkeit von Verbrechen gegen die Menschheit sei eine Norm der ius cogens, der höchsten Prinzipien des internationalen Rechts, an die sich Peru halten müsse. Der Gesetzentwurf stehe somit im Widerspruch zur Rechtsstaatlichkeit und den Grundwerten der internationalen Gemeinschaft und fördere die Straflosigkeit, heißt es in der Erklärung, die UN-Expert*innen nach der ersten Lesung veröffentlichten. Sprecher der Nicht-Regierungsorganisation Human Rights Watch erklärten, der Gesetzentwurf stehe in einer Reihe mit weiteren Maßnahmen des peruanischen Kongresses zur Förderung der Straflosigkeit und Demontage der Rechtsstaatlichkeit: Berichten zufolge wird gegen die Hälfte der Kongressmitglieder strafrechtlich ermittelt; dazu passend habe er „eine Reihe von Entscheidungen durchgesetzt, die die Unabhängigkeit der Justiz untergraben, den Kampf gegen Korruption und organisiertes Verbrechen schwächen und demokratische Prozesse und Menschenrechtsgarantien demontieren“.
Die Verfassungs- und Regelungskommission des Kongresses der Republik hatte bereits Mitte März seine Ablehnung des Gesetzesentwurfs bekundet. Hier die vollständige Stellungnahme der Kommission vom 13. März 2024:
Vollständige Ablehnung des Gesetzentwurfs, der die Straffreiheit für Verbrechen gegen die Menschenrechte und Verbrechen gegen die Menschheit begünstigt
Die Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso hat heute beschlossen, den Gesetzentwurf Nr. 6951/2023-CR zuzulassen, der die Verjährung von Verfahren im Zusammenhang mit Verbrechen gegen die Menschheit für Vorkommnisse vor dem Inkrafttreten des Römischen Statuts und des Übereinkommens über die Nichtanwendbarkeit der Verjährungsfristen auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit zu erklärt. Im genauen Wortlaut heißt es dort: „Niemand darf wegen Verbrechen gegen die Menschheit oder Kriegsverbrechen für Handlungen, die vor dem 1. Juli 2002 begangen wurden, strafrechtlich verfolgt, verurteilt oder bestraft werden. Keine Handlung vor diesem Datum kann als Verbrechen gegen die Menschheit oder als Kriegsverbrechen eingestuft werden.“
Grundsätzlich ist klarzustellen, dass alle Ermittlungen, Prozesse und Urteile in den Fällen, die in die Zeit der Gewalt 1980-2000 fallen, nach peruanischem Strafrecht geführt und nicht ausdrücklich als Verbrechen gegen die Menschheit eingestuft wurden. Dessen ungeachtet wurden die in diesem Zeitraum begangenen Menschenrechtsverletzungen als Verbrechen gegen die Menschheit betrachtet. Sowohl Menschenrechtsverletzungen als auch Verbrechen gegen die Menschheit unterliegen keiner Verjährungsfrist.
Dieser Gesetzentwurf begünstigt die Täter und kollidiert jedoch mit der staatlichen Verpflichtung, schwere Menschenrechtsverletzungen, die in Peru begangen wurden, zu untersuchen und zu bestrafen. Diese Verpflichtungen sind nicht nur im Verfassungsrecht, sondern auch im internationalen Recht fest verankert, wobei letzteres die Existenz eines Kerns unbestreitbarer Rechte anerkennt. Der peruanische Staat kann keine Normen erlassen, die im Widerspruch zu internationalen Verpflichtungen stehen, die sich aus ordnungsgemäß ratifizierten internationalen Menschenrechtsverträgen und -abkommen ergeben.
Mit der Ratifizierung des Übereinkommens über die Nichtanwendbarkeit der Verjährung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit hat Peru anerkannt, dass die Verbrechen, unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Begehung, keiner Verjährung unterliegen und dass zudem jeden Vorbehalt, der dies untergräbt, nicht anwendbar ist.
Zudem muss darauf hingewiesen werden, dass der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte in mehreren Urteilen diese Verpflichtung bekräftigt hat. Im Urteil Barrios Altos gegen Peru stellte der Interamerikanische Gerichtshof Folgendes fest:
„Amnestiebestimmungen, Verjährungsfristen und die Festlegung von Verantwortungsausschlüssen, die darauf abzielen, die Untersuchung und Bestrafung der für schwere Menschenrechtsverletzungen Verantwortlichen zu verhindern, sind unzulässig“. Der Staat kann sich nicht auf innerstaatliches Recht berufen, um sich von der Verpflichtung zu befreien, die Fälle zu untersuchen die Verantwortlichen zu bestrafen.
Die Staaten sind verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Verbrechen gegen die Menschheit nicht ungestraft bleiben. Daher müssen alle Hindernisse, die de facto und de jure Straflosigkeit ermöglichen, beseitigt werden. Die Verabschiedung des genannten Gesetzentwurfs würde nicht nur neue Ermittlungen wegen nicht sanktionierter Taten verhindern, sondern auch bereits laufende Prozesse behindern, nicht nur aus den 1980er Jahren: Huanta, Manta und Vilca, El Frontón, Chuschi, sondern auch aus den 1990er Jahren: Caraqueño-Pativilca, La Cantuta, Ventocilla, Zwangssterilisationen u.a., in denen gegen die Colina-Gruppe, Alberto Fujimori persönlich und gegen den Kongressabgeordneten Alejandro Aguinaga ermittelt wird. Letzterer würde den Gesetzentwurf schon allein aus persönlichem Interesse unterzeichnen. Außerdem soll das Gesetz auch die Urteile aufgehoben werden, die bereits wegen dieser Taten ergangen sind.
Schließlich sei daran erinnert, dass während der Regierung von Alan García Pérez am 31. August 2010 das Gesetzesdekret Nr. 1097 verabschiedet wurde, mit dem ebenfalls versucht wurde, die Verantwortlichen für schwere Menschenrechtsverletzungen, die vor 2003 begangen wurden, zu entlasten. Diese Forderung wurde jedoch für verfassungswidrig erklärt.
Aus diesem Grund lehnen wir den oben genannten Gesetzentwurf entschieden ab. Der Gesetzentwurf verstößt nicht nur gegen die internationalen Verpflichtungen, an die Peru gebunden ist, sondern fördert die Straffreiheit der für schwere Menschenrechtsverletzungen . Wir appellieren an die internationale Gemeinschaft, insbesondere an die Mitgliedstaaten der OAS, gegen diesen schweren Rückschlag für die Gerechtigkeit und die würdige Wiedergutmachung für die Opfer und ihre Familien einzutreten.
- Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH)
- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
- Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)
- Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)
- Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS)
- Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
- Instituto de Defensa Legal (IDL)
- Paz y Esperanza
Quelle: Nachrichtenpool Lateinamerika/ La Cantuta -Protest: „Gegen Straflosigkeit. Die Angehörigen schweigen nicht!“Foto: Catherine Binet, The Advocacy Project via flickr CC BY-NC-SA 2.0

EU - Verstoß gegen die Menschenrechte
Die griechische Küstenwache soll innerhalb von drei Jahren den Tod von 43 Menschen verursacht haben. Das geht aus Recherchen der BBC hervor. Der Linken-Vorsitzende Martin Schirdewan fordert Konsequenzen und bessere Kontrollen.
Hat die Küstenwache in Griechenland den Tod von Dutzenden Menschen verursacht, neun Personen sogar buchstäblich ins Wasser geworfen? Diese Vorwürfe erhebt jedenfalls der britische Rundfunksender BBC.
Die BBC hat demnach 15 Vorfälle genauer untersucht, von denen lokale Medien und Nichtregierungsorganisationen berichtet hatten. Das Ergebnis der Recherchen: Zwischen Mai 2020 und 2023 kamen 43 Menschen, die über das Meer auf die griechischen Inseln gelangen wollten, durch das Wirken der griechischen Küstenwache ums Leben.
Sie wurden demnach zum Beispiel in Schlauchbooten zurück aufs Meer gedrängt oder gezielt aufs offene Wasser gebracht. Geflüchtete und Migranten versuchen immer wieder, auf dem kurzen Weg von der Türkei zu den Ägäis-Inseln nach Europa zu gelangen.
"Pushbacks" verstoßen gegen Menschenrechtskonvention
Es geht dabei um sogenannte "Pushbacks" – also den Versuch, Schutzsuchende zurückzudrängen. Nach internationalem Recht sind diese Rückweisungen illegal. Das vierte Zusatzprotokoll der Europäischen Menschenrechtskonvention verbietet "Kollektivausweisungen ausländischer Personen". Die griechische Küstenwache wies die Vorwürfe gegenüber der BBC zurück.
Die Europäische Grenzschutzagentur Frontex steht immer wieder in der Kritik. Im Januar 2024 etwa zeigten Videoaufnahmen, wie maskierte Männer auf einem Schiff der griechischen Küstenwache an ein Schlauchboot mit etwa 30 Personen heranfuhren und sie mit Stöcken bedrohten. Frontex-Chef Fabrice Leggeri war 2023 ebenfalls nach Vorwürfen wegen Menschenrechtsverletzungen von seinem Amt zurückgetreten.
Schirdewan: "Ein Skandal sondergleichen"
Scharfe Kritik kommt von Martin Schirdewan, Co-Vorsitzender der Linken. "Die griechische Küstenwache hat mehr Menschen auf dem Gewissen als die italienische Mafia", sagte er unserer Redaktion. Der aktuelle Bericht der BBC belege nur, was Menschenrechtsorganisation seit vielen Jahren beklagen.
"Es ist ein Skandal sondergleichen und ein Versagen der EU, dass sich an dieser tödlichen Praxis nichts geändert hat", sagte Schirdewan. Die Pushbacks müssen aus seiner Sicht juristische Konsequenzen haben. "Ich erwarte, dass die beteiligten Beamten vor Gericht gestellt werden, denn auch das internationale Seerecht verpflichtet zur Hilfeleistung."
Schirdewan fordert eine eigene Kontrollinstanz, die die Grenzschützer überwacht. Um sie unabhängig zu machen, müssten auch zivilgesellschaftliche Akteure mitarbeiten.
EU verschärft Asylregeln
Die Europäische Union versucht seit längerem, ihre Außengrenzen stärker zu schützen, um Menschen davon abzuhalten, in die EU zu gelangen. Im Mai haben sich die Mitgliedsländer auf eine Reform der Gemeinsamen Asylpolitik (GEAS) geeinigt, die die Asylregeln in Europa deutlich verschärfen soll. Unter anderem sollen künftig Verfahren schon an den Außengrenzen durchgeführt werden, um Menschen an der Weiterreise zu hindern. Sie sollen dort zunächst festgehalten werden, bis über ihren Antrag entschieden ist.
Schirdewan kritisierte: "Anstatt die Seenotrettung auszubauen und alles zu tun, um den tausendfachen Tod der Migranten zu verhindern, will die EU ihr tödliches System nun perfektionieren." Die geplante Reform der GEAS werde "noch mehr Menschen dazu bringen, sich in löcherige Boote zu setzen und alles zu tun, um den Internierungslagern zu entgehen". (fab)
Quelle: BBC und Meldung von Schirdewan

Verstoß gegen die Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 14.06.2024, Seite 7 / Ausland
MENSCHENRECHTE
Anhörung mit Hindernissen
USA: Entscheidung über Bewährungsantrag des indigenen politischen Langzeitgefangenen Leonard Peltier kann sich bis Mitte Juli hinziehen
Von Michael Koch
Der indigene Gefangene Leonard Peltier musste in den USA 15 Jahre warten, bevor er erneut eine Freilassung auf Bewährung beantragen konnte, nachdem 2009 eine entsprechende Eingabe abgewiesen worden war. Entsetzt hatten seine Unterstützer damals die Ablehnung mit dem Hinweis kommentiert, dass Peltier, falls er dann überhaupt noch leben würde, 80 Jahre alt wäre und mehr als 48 Jahre in Haft verbracht hätte. Jetzt haben wir 2024, Peltier hat weitere 15 Jahre im Gefängnis überlebt, trotz hohen Alters, schwerer Krankheiten und ständiger Lockdowns. Die mögliche Kalkulation des FBI, er werde das nicht überleben, ist nicht aufgegangen.
Vergangenen Montag fand dann im Hochsicherheitsgefängnis Coleman in Florida die lange erwartete Anhörung statt. Neben Leonard Peltier und dem Anhörungsbeauftragten der U. S. Parole Commission waren Peltiers Anwälte Kevin Rabin und Moira Meltzer-Cohen sowie Vertreter seiner Gegner und Fürsprecher anwesend. Die Hoffnung, dass für Peltier der in den 70er Jahren aufsichtführende Staatsanwalt James Reynolds aussagen würde, wurde kurzfristig enttäuscht. Die Kommission hat von sieben vorgeschlagenen Fürsprechern sechs abgelehnt. Darunter auch Reynolds, der einst für Anklage, Verurteilung und anhaltende Inhaftierung des indigenen Aktivisten verantwortlich war, sich aber seit einigen Jahren für Peltiers Freilassung einsetzt und dabei darauf hinweist, dass es keinerlei Beweise für eine Schuld oder Mitschuld des seit 48 Jahren Inhaftierten gebe und er seine frühere Meinung bedauere.
Doch bevor sich Peltier, dessen Anwälte und nach Einspruch doch noch zwei Fürsprecher Peltiers – neben der Zeugin Renée Morrissey der Oglala-Lakota Nick Tilsen, Präsident des NDN Collectives, einer von Indigenen geführten Interessenvertretungsorganisation – äußern konnten, hatten zuerst die sechs Vertreter der Gegenseite das Wort. Neben einem Schreiben des amtierenden FBI-Direktors Christopher Wray, der sich am 7. Juni erneut gegen eine Freilassung Peltiers in jeder Form aussprach, kamen auch vier Angehörige der bei dem Schusswechsel vom 26. Juni 1975 getöteten FBI-Mitarbeiter Jack Coler und Ronald Williams zu Wort und wiederholten dabei ihre frühere Position, dass Peltier in Haft sterben solle. Weiterhin anwesend auf der Seite der Regierung waren ein Vertreter des FBI und ein Staatsanwalt.
Für Peltier, seine Anwälte, Zeugen und Fürsprecher war dies eine schwierige Ausgangssituation, um gegenüber dem anwesenden Vertreter der Kommission die Argumente für Peltiers Bewährungsfreilassung so überzeugend wie möglich vorzubringen. In einer E-Mail bedankte sich Peltier für die Unterstützung und betonte, dass die Entscheidungsfindung sicher nicht einfach werde. Diese kann sich bis zum 11. Juli hinziehen. In einem Schreiben an jW sendet Leonard Peltier überdies seinen großen Dank auch an all seine Unterstützer in Europa, die in den vergangenen Wochen an Brief- und Petitionskampagnen teilgenommen hatten. Dabei haben sich allein bei den von der »Europe for Peltier 2024 Coalition« überblickten Aktionen mehr als 40.000 Menschen an die Parole Commission mit der Bitte um Bewährungsfreilassung gewandt.
Wie geht es bis Bekanntgabe des Bescheids und danach weiter? Gegen eine Ablehnung könnte Widerspruch eingelegt werden. Allerdings würde dieses Verfahren mehrere Monate dauern. Gleichzeitig ist aber ein Antrag auf Executive clemency, also Begnadigung, bereits anhängig. Außerdem wird im Falle einer Ablehnung auch ein erneuter Antrag auf Freilassung aus mitfühlenden Gründen (Compassionate release) gestellt.
Bereits in zwei Wochen werden in der Pine Ridge Reservation am Jahrestag des tödlichen Schusswechsels zwischen FBI und indigenen Aktivisten, dem Oglala Commemoration Day, Peltiers Unterstützer erneut für Aufmerksamkeit sorgen. Seit vielen Jahren drücken sie an diesem Tag nicht nur ihre Solidarität mit Leonard Peltier aus, sondern betonen dabei auch den Wunsch nach einem Aussöhnungs- und Heilungsprozess zwischen den Betroffenen. Unterstützt werden sie dabei wieder auch von europäischen Menschenrechtsgruppen.
Quelle: junge Welt v.14.06.2024/ Matteo Nardone/Pacific Press Agency/imago
»Befreit Leonard Peltier«: Kundgebung für den inhaftierten Indigenenaktivisten vor der US-Botschaft in Rom (o. D.)
Weitere Infos: leonardpeltier.de

Völkerrechtswidrig
Kolonien im 21. Jahrhundert (II)
Deutsche Konzerne unterstützen die völkerrechtswidrige Besetzung der Westsahara durch Marokko. Die Westsahara, ehedem spanisches Kolonialgebiet, wird von der UNO als eine der bis heute verbliebenen Kolonien eingestuft.
BERLIN/RABAT (Eigener Bericht) – Deutsche Konzerne unterstützen die völkerrechtswidrige Besetzung eines der verbliebenen Kolonialgebiete des 21. Jahrhunderts – der Westsahara. Diese wird seit fast 50 Jahren von Marokko unter Kontrolle gehalten, obwohl schon im Jahr 1975 der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag entschied, die Westsahara habe – in Übereinstimmung mit ihrer Klassifizierung durch die UNO als „Hoheitsgebiet ohne Selbstregierung“ – das Recht auf Selbstbestimmung bzw. staatliche Unabhängigkeit. Die Westsahara war seit 1884 zunächst eine Kolonie Spaniens, das seit den 1950er Jahren gegen antikoloniale Aufstände kämpfte; als es sich Anfang 1976 endgültig aus dem besetzten Gebiet verabschiedete, zogen dort marokkanische Truppen ein. Diese halten es bis heute unter Bruch des Völkerrechts besetzt; nur die USA und Israel erkennen Marokkos Herrschaft über die Westsahara an. Zu den Mitteln, seine Herrschaft zu sichern, gehört der Versuch Rabats, in die ökonomische Ausplünderung des Gebiets auch Unternehmen aus Drittstaaten einzubeziehen. Dafür stellen sich nicht zuletzt deutsche Konzerne zur Verfügung, so etwa Heidelberg Materials und Siemens Gamesa Renewable Energy.
Kolonialmacht Spanien
Zur Kolonie erklärt wurde die Westsahara auf der Berliner Konferenz von 1884/85, auf der die europäischen Staaten beträchtliche Teile des afrikanischen Kontinents eigenmächtig unter sich aufteilten. Die Westsahara wurde damals Spanien zugeschlagen, das seine Kolonien in Lateinamerika bereits verloren hatte, nur wenig später auch die Herrschaft über Kuba und die Philippinen einbüßen sollte und jetzt in Afrika, wo es außer den Kanarischen Inseln, Ceuta und Melilla bis dahin vor allem Guinea Española (heute: Äquatorialguinea) kontrollierte, kolonialen Ersatz suchte.[1] Nicht zuletzt unter der Diktatur von Francisco Franco baute Madrid seine Herrschaft über die Westsahara aus; es suchte sie auch dann noch zu bewahren, als die Entkolonialisierung begann und schließlich immer mehr Staaten Afrikas frei wurden. In den 1960er Jahren begann Spanien die gewaltigen Phosphatvorkommen bei Bou Craa, die 1947 entdeckt worden waren, zu erschließen, was den Anreiz verstärkte, seine koloniale Herrschaft über die Westsahara auf Dauer zu zementieren.[2] Dies gelang allerdings nicht.
Kampf um Befreiung
Bereits in den 1950er Jahren hatten die antikolonialen Befreiungskämpfe unter anderem in Algerien und in Marokko auch antikolonialen Kräften in der Westsahara Auftrieb verschafft. Dort kam es gleichfalls zu bewaffnetem Widerstand gegen die spanische Kolonialmacht. Bestärkt wurden die Unabhängigkeitsbestrebungen dadurch, dass die Vereinten Nationen die Westsahara 1963 auf ihre Liste der Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung aufnahmen; dabei handelt es sich um eine Liste von Territorien, die entkolonialisiert werden sollen. Anfang der 1970er Jahre flammten in der Westsahara die Kämpfe gegen Spanien erneut auf; am 10. Mai 1973 gründete sich die Befreiungsorganisation Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro), die bis heute für die Entkolonialisierung des Landes kämpft. Als Spanien Ende 1975 keine andere Möglichkeit mehr sah, als sich aus der Westsahara zurückzuziehen, erhob Marokko Ansprüche auf das Land. Damalige Pläne für ein „Groß-Marokko“ sahen außerdem die Eroberung von Teilen Algeriens, Malis sowie Mauretaniens vor.[3]
Kolonialmacht Marokko
Zwar rief die Polisario am 27. Februar 1976, unmittelbar vor dem offiziellen Abzug der spanischen Kolonialmacht, die Demokratische Arabische Republik Sahara (DARS) aus. Es gelang ihr jedoch nicht, sich gegen die marokkanischen Streitkräfte zu behaupten, die die Kontrolle über weite Teile des Landes übernahmen. In den 1980er Jahren errichtete Marokko einen mit Minen und weiterem Militärgerät bewehrten Sandwall, der die westlichen zwei Drittel der Westsahara, die von Rabat beherrscht werden, abschirmt. 1991 gelang es den Vereinten Nationen, einen Waffenstillstand zwischen beiden Seiten zu vermitteln, der ein Referendum über die Unabhängigkeit der Westsahara vorsah. Begleitend wurde die United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) eingesetzt. Das damals geplante Referendum ist bis heute nicht abgehalten worden – nicht zuletzt, weil Marokko Stimmrecht für die zahlreichen in das Gebiet eingewanderten Marokkaner verlangt, um eine Mehrheit für die Unabhängigkeitsbefürworter zu verhindern. Inzwischen hat Rabat darüber hinaus den Waffenstillstand gebrochen.
Rabats Kampf um Anerkennung
Marokko ist seit langem bemüht, seiner Kontrolle über die Westsahara zu internationaler Anerkennung zu verhelfen, auch wenn der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag dies schon am 16. Oktober 1975 für unzulässig erklärte. Die Fortschritte, die Rabat dabei erzielen konnte, sind mäßig. So haben inzwischen zwar 38 der 84 UN-Mitgliedstaaten, die die Demokratische Arabische Republik Sahara anerkannt haben, dies eingefroren oder suspendiert. Allerdings haben erst zwei Staaten die marokkanische Herrschaft offiziell anerkannt. Die USA taten dies am 10. Dezember 2020 in einer der letzten Maßnahmen der Trump-Administration; Israel folgte am 17. Juli 2023. Marokko ist es inzwischen aber gelungen, insgesamt 28 Staaten zur Eröffnung eines Konsulats in Dakhla oder El Aaiún zu bewegen, den beiden wichtigsten Städten in der marokkanisch besetzten Westsahara.[4] Zudem ist Rabat bemüht, Firmen aus Drittstaaten in die wirtschaftliche Ausplünderung der besetzten Westsahara einzubeziehen. Dies geschieht insbesondere im Kontext mit dem Phosphatabbau und mit der Förderung erneuerbarer Energien.
Phosphat
Phosphatabbau betreibt Marokko seit Jahrzehnten bei Bou Craa, wo bereits die spanische Kolonialmacht den für die Herstellung von Düngemitteln unerlässlichen Rohstoff förderte. Involviert sind auf unterschiedliche Weise mehrere deutsche Konzerne. So hat Siemens Gamesa 22 Windturbinen für den Windpark Foum El Oued geliefert, der die komplette für den Phosphatabbau notwendige Energie produziert. Wie die Nichtregierungsorganisation Western Sahara Resource Watch (WSRW) berichtet, hat Siemens Gamesa ihr im Jahr 2018 bestätigt, den Vertrag zur Instandhaltung des Windparks für weitere 15 Jahre verlängert zu haben.[5] ThyssenKrupp wiederum hat laut WSRW 2021 bestätigt, Geräte zum Abbau von Phosphat in Bou Craa instandgesetzt zu haben; eine Absage an künftige Aktivitäten dort verweigert der Konzern. Heidelberg Materials wiederum (Ex-HeidelbergCement) hat seine Zementproduktion in der besetzten Westsahara, wie im vergangenen Jahr bekannt wurde, umfassend ausgeweitet – mutmaßlich zugunsten des Ausbaus eines Exporthafens für Phosphatgestein und Düngemittel.[6]
Windenergie
Darüber hinaus ist Siemens Gamesa auch in weitere Windenergieprojekte in der besetzten Westsahara involviert. Ein Konsortium unter Führung des Konzerns, dem auch das im Besitz des marokkanischen Königshauses befindliche Energieunternehmen Nareva angehört, erhielt 2012 den Auftrag zum Bau von fünf Windparks, darunter drei in Marokko und zwei in der Westsahara. Siemens Gamesa errichtete daraufhin im nordmarokkanischen, an der Straße von Gibraltar gelegenen Tanger eine Windturbinenfabrik, die 2017 in Betrieb genommen wurde; sie stattet unter anderem die Windparks in der Westsahara aus. Von Siemens Gamesa beliefert wurden neben dem Windpark Foum El Oued auch die Windparks Boujdour und Aftissat sowie eine kleinere Anlage, die ein Zementmahlwerk von Heidelberg Materials versorgt.[7] Wie WSRW berichtet, ging Siemens Gamesa im Jahr 2020 sogar so weit, die Westsahara ausdrücklich als einen Teil Marokkos zu bezeichnen. Das widerspricht offen der Feststellung des IGH vom 16. Oktober 1975; der Konzern stellt sich damit über das Völkerrecht.
Die „freie Welt“ und ihre Ordnung
Während die westlichen Staaten, auch Deutschland, ihren Kampf um die Sicherung der bestehenden, von ihnen dominierten Weltordnung unter dem Banner der angeblich „freien Welt“ führen, bestehen in dieser Weltordnung diverse Kolonien fort, die – zumeist von westlichen Staaten – ganz offen in Unfreiheit gehalten werden. Zu ihnen zählen neben der Westsahara Neukaledonien (german-foreign-policy.com berichtete [8]) und eine Reihe weiterer Kolonien; german-foreign-policy.com berichtet in Kürze.
[1] Macharia Munene: History of Western Sahara and Spanish colonisation. In: Neville Botha, Michèle Olivier, Delarey van Tonder: Multilateralism and international law with Western Sahara as a case study. Pretoria 2008. S. 82-115.
[2] P for Plunder. Morocco’s exports of phosphates from occupied Western Sahara. Western Sahara Resource Watch (WSRW) 2024.
[3] Werner Ruf: Marokkos Rolle in Afrika. In: Judit Tavakoli, Manfred O. Hinz, Werner Ruf, Leonie Gaiser (Hg.): Westsahara-Konflikt. Zwischen Kolonialismus, Imperialismus und Selbstbestimmung. Berlin 2021. S. 153-171.
[4] Ahmed Eljechtimi: Israel recognizes Moroccan sovereignty over Western Sahara. reuters.com 17.07.2023.
[5] P for Plunder. Morocco’s exports of phosphates from occupied Western Sahara. Western Sahara Resource Watch (WSRW) 2024.
[6] Massiver Zuwachs für Heidelberg Materials in der besetzten Westsahara. wsrw.org 16.05.2023.
[7] Das schmutzige Geschäft mit der grünen Energie. wsrw.org 22.04.2024.
[8] S. dazu Kolonien im 21. Jahrhundert (I).
Quelle: https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9578 07.06.2024

Verstoß gegen Menschenrechte in Chile - Schutz der indigenen Minderheiten Mapuche-indigenen Ureinwohner
Mapuche-Führer Héctor Llaitul beginnt Hungerstreik im Gefängnis
In einer Erklärung forderte Llaitul die Nichtigkeit des Verfahrens und dass die vor einigen Wochen eingereichten Berufungen vom Obersten Gerichtshof überprüft werden.
Der Mapuche-Führer der Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, trat am Montag im Gefängnis von Concepción in einen Hungerstreik, um gegen die Verurteilung zu 23 Jahren Haft zu protestieren, die das mündliche Gericht von Temuco in der chilenischen Hauptstadt am 7. Mai verhängt hatte.
Der Führer der indigenistischen, autonomistischen, antikolonialen, antikapitalistischen und revolutionären Organisation wurde wegen "gewaltsamer Usurpation, Holzdiebstahl und Angriff auf die Autorität" bestraft.
Die von Llaitul geleitete CAM übernimmt regelmäßig die Verantwortung für Brandanschläge auf Großgrundbesitzer im Süden des Landes.
In einer Erklärung forderte Llaitul die Nichtigkeit des Verfahrens und dass die vor einigen Wochen eingereichten Berufungen vom Obersten Gerichtshof überprüft werden.
Er forderte auch "würdige Haftbedingungen und die Achtung der Menschenrechte der politischen Gefangenen der Mapuche" sowie "die Freiheit" seiner beiden Söhne Ernesto und Pelentario Llaitul, die sich beide in Untersuchungshaft befinden.
Seit Jahrzehnten sind die Regionen La Araucanía und Biobío im Süden des lateinamerikanischen Landes Schauplatz eines Konflikts, an dem indigene Völker, der Staat und Großgrundbesitzer und Forstunternehmen beteiligt sind, die Land und Wälder ausbeuten, die von den indigenen Gemeinschaften als angestammte Völker angesehen werden.
Quelle: teleSUR v.04.06.2024

Verstoß gegen Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 23.05.2024, Seite 8 / Ausland
MENSCHENRECHTE
»Das Justizsystem hat Tausende im Stich gelassen«
Brüssel: Internationales Tribunal hört Opfer philippinischer »Aufstandsbekämpfung«. Ein Gespräch mit Jonila Castro
Interview: Justus Johannsen
Jonila Castro ist Umweltaktivistin aus den Philippinen. Sie ist Mitglied von AKAP KA Manila Bay Kalikasan People’s Network for the Environment
Als philippinische Umweltaktivistin sind Sie Opfer staatlicher Gewalt geworden und haben am 17. und 18. Mai als Zeugin am Internationalen Volkstribunal, IPT, in Brüssel teilgenommen. Können Sie uns mehr über Ihre Aussage erzählen?
Die zunehmende Repression der philippinischen Regierung gegen Umweltaktivisten und die breitere nationale Demokratiebewegung sind Teil eines größeren Konzepts der Regierung Ferdinand Marcos Jr. Bis heute sind die Philippinen einer der gefährlichsten Orte für Umweltaktivisten. Marcos Jr. wendet verschiedene Repressionstaktiken an, die von extralegalen Tötungen, über den Einsatz der berüchtigten NTF-ELCAC – der nationalen Taskforce zur Beendigung lokaler kommunistischer bewaffneter Konflikte –, bis hin zu verschiedenen erfundenen Anklagen gegen Aktivisten reichen. Diese Angriffe werden unter dem Deckmantel der »Aufstandsbekämpfung« durchgeführt, wodurch die Unterscheidung zwischen Kombattanten und Zivilisten verwischt wird. Das stellt einen schweren Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar.
Inwiefern betrifft Sie diese Repression?
Als Mitglied von Kalikasan konzentriert sich mein Engagement auf die Organisation von Kampagnen zur Verteidigung der Umwelt und der Rechte von marginalisierten Gemeinschaften, die von Landgewinnungs- und Bergbauprojekten sowie Megastaudämmen betroffen sind. Meine Zeugenaussage vor dem Internationalen Volkstribunal hat genau diese Probleme aufgezeigt. Ich berichtete aus erster Hand über die Brutalität des Staates und wie Jhed Tamano und ich 17 Tage lang vom Militär entführt, psychologisch gefoltert und dann den Medien als sogenannte Rebellen, die sich ergeben haben, präsentiert wurden. Die Regierung Marcos Jr. will abweichende Meinungen zum Schweigen bringen und die Interessen mächtiger Unternehmen schützen.
Welche Art von Verbrechen wurden vor dem Tribunal verhandelt?
Die Regierung Marcos Jr. leugnet Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen. Sie benutzt das Antiterrorgesetz, um Andersdenkende und Regierungskritiker als Terroristen abzustempeln und die Forderungen der Bevölkerung zu delegitimieren. Kurz gesagt, das philippinische Justizsystem hat Tausende von Aktivisten und Betroffene von Greueltaten unter der gegenwärtigen Regierung und sogar unter früheren Regierungen im Stich gelassen. Ich bin in der Hoffnung zum IPT gekommen, einen Beitrag zur Dokumentation der Greueltaten zu leisten, die von den durch die USA unterstützten Regimen Marcos Jr. und Rodrigo Duterte begangen wurden. Für mich als Opfer dieser Greueltaten bietet das Tribunal eine alternative Plattform, um die Wahrheit zu dokumentieren und Gerechtigkeit und Rechenschaft zu fordern.
Wie lautete das Urteil der Jury?
Die Geschworenen des IPT befanden die US-Regierung sowie die Regime von Marcos Jr. und Duterte einstimmig der Kriegsverbrechen und der Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht für schuldig. Die Ergebnisse des IPT sind für mich eine tiefe Bestätigung und Erleichterung. Dieses Urteil ist ein kollektiver Sieg für alle Opfer von Staatsterrorismus und Unterdrückung auf den Philippinen. Darüber hinaus bedeutet es eine Quelle der Stärke für die breitere nationale Demokratiebewegung auf den Philippinen und ermutigt mehr Menschen, trotz der Risiken ihre Stimme zu erheben.
Neben den USA hat auch Deutschland seine Militäreinsätze im asiatisch-pazifischen Raum verstärkt. Wie blicken Sie auf diese weitere Eskalation?
Die Kriegstreiberei der USA in der asiatisch-pazifischen Region in Verbindung mit der Unterwürfigkeit des Marcos-Regimes demgegenüber kann für das philippinische Volk und die Umwelt nur Zerstörung bedeuten. Die Anwesenheit von NATO-Streitkräften in der Region wird die Spannungen mit China nur verstärken und das philippinische Volk in den Mittelpunkt eines sich anbahnenden, heißen Krieges stellen. Die kürzlich abgeschlossenen Balikatan-Übungen beispielsweise haben diese Spannungen verschärft und Tausende von Fischergemeinden wegen der Kriegsspiele daran gehindert, ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können.
Quelle: junge Welt v.23.05.2024/ Gregorio B. Dantes Jr./Pacific Press Agency/imago
Protest gegen Minenausbau (Jakarta, 4.3.2019)

Anklage wegen Verstoß gegen die Menschenrechte in Kolumbien
Aus: Ausgabe vom 23.05.2024, Seite 6 / Ausland
MENSCHENRECHTSVERBRECHEN
Uribe nicht mehr unantastbar
Von Sara Meyer, Bogotá
Bisher die graue Eminenz, nun vor Gericht: Kolumbiens Expräsident Uribe (Bogotá, 29.6.2022)
Der einflussreichste Politiker Kolumbiens sitzt seit vergangenem Freitag vor Gericht. Dem ehemaligen Präsidenten Álvaro Uribe Vélez, der das Land von 2002 bis 2010 regierte, werden drei Delikte zur Last gelegt: Zeugenbestechung, Verfahrensbetrug und Beeinflussung von Richtern. Einer der Kläger ist der linke Senator Iván Cepeda. Sollte Uribe verurteilt werden, könnten ihm bis zu zwölf Jahre Haft bevorstehen.
Der Fall wurde durch eine Parlamentsdebatte ins Rollen gebracht, die bereits mehr als ein Jahrzehnt zurückliegt: 2012 war Uribe von Cepeda bezichtigt worden, gemeinsame Sache mit Drogenbossen und rechten Paramilitärs gemacht zu haben. Daraufhin setzt Uribe ein Verfahren wegen Verleumdung und Zeugenbestechung gegen Cepeda in Gang. Das Gericht stellte aber die Ermittlungen gegen Cepeda ein und begann 2018 einen Prozess wegen Manipulation von Zeugen gegen Uribe selbst.
Laut Staatsanwaltschaft hat Uribes Verteidiger Diego Cadena mehrere ehemalige paramilitärische Milizen unter anderem in Gefängnissen aufgesucht, um sie dazu zu bringen, vorherige Aussagen zurückzuziehen. Ziel sei gewesen, dass diese Exparamilitärs Briefe und Videos an den Obersten Gerichtshof schicken, in denen sie ihre früheren Aussagen über Uribes angebliche Verbindungen zu paramilitärischen Strukturen abstreiten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft geschah dies auf Anweisung des ehemaligen Präsidenten.
Probeabo junge Welt - zwei Wochen testen
Bei der ersten Anhörung am Freitag erhob das Gericht einen weiteren Tatvorwurf, für den sich Uribe verantworten muss: Bestechung während eines laufenden Strafprozesses. Demnach habe Cadena versucht, die ehemalige Staatsanwältin Hilda Niño dazu zu bewegen, gegen den damaligen Generalstaatsanwalt Eduardo Montealegre und seinen Stellvertreter Jorge Fernando Perdomo vorzugehen, da diese zu jener Zeit gegen Uribes Bruder wegen dessen Zusammenarbeit mit Paramilitärs ermittelten.
Das Verfahren gegen Uribe ist von weiteren Unregelmäßigkeiten geprägt. So enthüllten die kolumbianische Zeitung Cambio Colombia und das spanische Blatt El País, wie schwierig es war, das Verfahren zu eröffnen. Dabei kämpfte der Staatsanwalt des Obersten Gerichtshofs Gilberto Villarreal zunächst gegen Windmühlen. Erst als Exgeneralstaatsanwalt Francisco Barbosa seinen Posten im März abgeben musste, kam der Prozess richtig ins Rollen. Barbosa gilt als Unterstützer der von Uribe gegründeten Partei Centro Democrático, außerdem verbindet ihn eine Freundschaft mit Uribes politischem Ziehsohn, dem ehemaligen Präsidenten Iván Duque.
In Barbosas Amtszeit hatte die Staatsanwaltschaft mehrfach versucht, das Verfahren einzustellen. Zwei Bezirksrichter schafften es aber, den Antrag abzulehnen. Am 9. April verkündete die neue Generalstaatsanwältin Luz Adriana Camargo das Vorliegen weiterer Beweise gegen Uribe, was zu dessen Anhörung am Freitag führte. Uribes Rechtsvertreter versuchten, die Anhörung zu verschieben und beantragten die Nichtigkeit des gesamten Verfahrens, was das Gericht nicht gestattete. Camargo schließt in ihrer Beharrlichkeit an Villarreal an, der trotz Widerständen nicht aufgegeben hatte und offenbar den Abgang seines ehemaligen Chefs Barbosa abgewartet hat, um die Anklage am Ende doch noch erheben zu können.
Uribe, der seit 2020 vom Gericht unter »Hausarest« gestellt ist, beteuert derweil seine Unschuld und spricht von einem Komplott. Kurz vor Beginn der Anhörung verlas er ein an die kolumbianische Bevölkerung adressiertes Papier, in dem in 30 Punkten die angebliche Vorgehensweise gegen ihn dargestellt wird. Der Fall ist nicht nur angesichts des allgemein schwindenden Vertrauens in die Rechtsstaatlichkeit von großer Bedeutung, sondern insbesondere wegen seiner politischen Strahlkraft: Der 71jährige Uribe prägte mehrere Jahrzehnte lang die Politik des Landes. Ihm werden schwere Menschenrechtsverbrechen vorgeworfen. Der ehemalige Milizenchef Salvatore Mancuso bestätigte vergangenes Jahr vor der Sonderjustiz für den Frieden Uribes Verbindungen zu den Paramilitärs. Das Verfahren wird diesen Freitag fortgeführt.
Quelle: junge Welt vom 2305.2024/ Strafprozess_gegen_e_82098976.jpg
Lina Gasca/AP/dpa Kolumbiens rechter Expräsident endlich auf der Anklagebank

Menschenrechtsverstöße in Deutschland
„Eine neue Etappe der Repression“
Am 75. Jahrestag des Inkrafttretens des Grundgesetzes ist Deutschland auf dem Weg in eine autoritäre Formierung: Die Kriege in der Ukraine und in Gaza bringen in der Bundesrepublik zunehmend Ausgrenzung und Repression hervor.
23
MAI
2024
BERLIN (Eigener Bericht) – Am heutigen 75. Jahrestag des Inkrafttreten des Grundgesetzes (23. Mai 1949) befindet sich Deutschland in einer Phase einer rasch zunehmenden autoritären Formierung. Während etwa Bundeskanzler Olaf Scholz die „Freiheits- und Werteordnung“ des Grundgesetzes lobt und in offiziellen Stellungnahmen von „75 Jahren Freiheit“ die Rede ist, werden außenpolitisch missliebige Meinungen zunehmend unterdrückt und ihre Anhänger ausgegrenzt. Ein erster Schub in diese Richtung war mit dem Beginn des Ukraine-Krieges einhergegangen; damals waren russische Medien verboten, russische Künstler boykottiert und sogar Werke russischer Komponisten aus Programmen genommen worden. Seit dem Beginn des Gaza-Kriegs werden Palästinensern und ihren Unterstützern Literaturpreise entzogen, Kulturzentren genommen und Bankkonten gekündigt, Letzteres auch dann, wenn es sich um jüdische Organisationen handelt. Bundesminister beginnen, Hochschuldozenten, die sich für das Recht auf Protest aussprechen, offiziell zu disziplinieren, während Berlin Einreiseverbote gegen Kritiker verhängt, darunter ein ehemaliger griechischer Minister. Aus dem westlichen Ausland sind zunehmend entsetzte Reaktionen zu vernehmen.
Sendeverbote
Ein starker Schub in Richtung auf eine autoritäre Formierung der deutschen Öffentlichkeit war zu Beginn des Ukraine-Kriegs zu verzeichnen. War schon zuvor, ab 2014 und vermittelt nicht zuletzt über die Leitmedien, massiver Druck auf all diejenigen ausgeübt worden, die sich einem offen antirussischen Grundkonsens verweigerten („Putin-Versteher“), so ging die Bundesrepublik nun unter anderem zur Ausschaltung russischer Medien über – entweder, indem die deutschen Behörden ihnen Sendelizenzen verweigerten, oder durch ein Verbot auf EU-Ebene. Sender wie RT oder Sputnik sind seitdem in Deutschland nicht mehr erlaubt. Deutsch-russische Kooperationsprojekte auf den Feldern von Wissenschaft und Kultur, die vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD), der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) oder der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) betrieben wurden, wurden nun umgehend auf Eis gelegt; die Frankfurter Buchmesse schloss Russlands Nationalstand aus – und wies darauf hin, Repräsentanten russischer Verlage könnten aufgrund der Russland-Sanktionen ohnehin kaum zu der Veranstaltung anreisen.[1] Boykotte russische Künstler, zuweilen gar der Werke längst verstorbener russischer Komponisten wie auch Forderungen, die Bücher russischer Autoren – sogar klassischer Schriftsteller – zu verbieten, spitzten die antirussische Formierung zu.
Geschichtsrevision
Diese dauert bis heute an, greift immer weiter aus und beeinträchtigt mittlerweile sogar die Erinnerung an die Befreiung Deutschlands und Europas von der NS-Herrschaft. So waren bei den Befreiungsfeierlichkeiten am 9. Mai am sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Treptow nicht nur russische Fahnen und Symbole verboten, sondern auch die Flagge der Sowjetunion, die die Hauptlast bei der Niederwerfung des NS-Reichs getragen hatte. Überaus schikanöse Einlasskontrollen am Ehrenmal sorgten für recht lange Wartezeiten und schreckten von der Teilnahme an dem Gedenken an die Befreiung vom Nationalsozialismus ab. Verboten wurde sogar das Mitführen einer Tageszeitung, die auf ihrer Titelseite ein berühmtes historisches Foto von der Einnahme des Reichstags durch sowjetische Soldaten zeigte: Weil auf ihm eine sowjetische Flagge zu sehen ist, die die Soldaten gerade über dem Reichstag schwenken, musste, wer sich dem Gedenken anschließen wollte, die Zeitung im Müll entsorgen.[2] Das Foto ist aus zahlreichen Geschichtsbüchern bekannt. Ukrainische Flaggen hingegen waren erlaubt – und dies, obwohl die Organisationen der ukrainischen Faschisten, die 1941 einen ukrainischen Staat zu gründen versucht hatten, mit den Nazis kollaboriert sowie den Massenmord an den europäischen Juden aktiv unterstützt hatten.[3]
Ausgegrenzt
Ein weiterer massiver Schub in Richtung auf eine autoritäre Formierung erfolgt seit dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 und dem Beginn des Gaza-Kriegs; er richtet sich pauschal gegen palästinensische Organisationen, gegen ihre Unterstützer und gegen alle, die Sympathie mit ihren Anliegen zu erkennen geben. So wurde beispielsweise die Vergabe diverser Literaturpreise, deren ursprünglich vorgesehene Empfänger sich mit Kritik an der israelischen Politik hervorgetan hatten oder auch nur palästinensischer Herkunft waren, unbestimmt verschoben oder vollständig abgesagt, so etwa eine offiziöse Auszeichnung, die auf der Frankfurter Buchmesse vergeben wird.[4] Die Berliner Behörden strichen einem bekannten Kulturzentrum in der Hauptstadt, das für palästinensische Anliegen offen ist, alle Fördermittel und verlangten die Räumung seines Gebäudes. Die Exempel wirken: In ganz Deutschland berichten Organisationen, die palästinensische Anliegen unterstützen, sie seien kaum noch in der Lage, Räumlichkeiten für Treffen und Veranstaltungen zu finden. Der Repression durch deutsche Stellen ausgesetzt ist mit der Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost auch eine jüdische Vereinigung; ihr sperrte die Berliner Sparkasse bereits im März das Bankkonto.[5]
Ausgesperrt
Mittlerweile beginnt die Bundesregierung, Hochschuldozenten öffentlich zu disziplinieren, greift zu Reiseverboten und setzt sie EU-weit durch. Vor zwei Wochen hatten nach der Räumung eines Protestcamps an der Freien Universität Berlin durch die Polizei ungefähr 300 Lehrkräfte in einem Protestschreiben erklärt, sie verteidigten – unabhängig von ihrer Haltung zu den Forderungen des Protestcamps – das „Recht auf friedlichen Protest“.[6] Daraufhin äußerte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, die Stellungnahme mache sie „fassungslos“. Die öffentliche Verurteilung durch die Ministerin schädigt die Unterzeichner des Protestschreibens und schreckt andere davon ab, sich der Kritik anzuschließen. Zuvor hatten die deutschen Behörden zwei Referenten eines Palästina-Kongresses an der Teilnahme an der Veranstaltung gehindert. Gegen den ehemaligen griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis hatte Berlin ein politisches Betätigungsverbot verhängt.[7] Den palästinensischen Arzt und Rektor der University of Glasgow, Ghassan Abu-Sittah, hatte sie mit einem Einreiseverbot belegt, und zwar für den gesamten Schengen-Raum. Abu-Sittah konnte daher Anfang Mai auch an einer Veranstaltung des französischen Senats nicht teilnehmen. Das Verwaltungsgericht Potsdam hat das Einreiseverbot inzwischen für rechtswidrig erklärt.[8]
„Gegen ethnische Minderheiten“
Aus dem westlichen Ausland sind zunehmend entsetzte Reaktionen zu vernehmen. Bereits im Dezember konstatierte die New York Times, Deutschland drohe seinen „Ruf als Zufluchtsort für künstlerische Freiheit“ zu verlieren [9], während die Washingtoner Onlinezeitung The Hill notierte: „Nahezu jede größere Einrichtung in Deutschland ist an einer Welle der Repression gegen ethnische Minderheiten beteiligt gewesen“ – gegen „Palästinenser, andere Nichtweiße und jüdische Antizionisten gleichermaßen“, und dies „in einem Ausmaß und einer Intensität, die in der deutschen Nachkriegsgeschichte beispiellos ist“ [10]. Im April zitierte der britische, gewöhnlich deutschlandfreundliche Guardian konsterniert die Aussage einer in Nordafrika geborenen und heute in Berlin lebenden Aktivistin, „Demokratie und Meinungsfreiheit“ seien in der Bundesrepublik offenbar nur noch „Fassade“.[11] Im Mai äußerte die französische Senatorin Raymonde Poncet Monge (Europe Écologie – Les Verts), die Ghassan Abu-Sittah zu der Veranstaltung des Senats eingeladen hatte, zu der auf Berliner Betreiben verfügten Einreisesperre: „Das ist grauenhaft! Das ist eine neue Etappe der Repression“.[12]
Der dritte Schub
Dabei hat längst ein dritter Schub in Richtung auf eine autoritäre Formierung begonnen, der sich gegen den stärksten Rivalen der Bundesrepublik richtet – gegen China. Schon vor Jahren ergab eine wissenschaftliche Untersuchung, die deutsche China-Berichterstattung sei „von teil noch aus kolonialen Zeiten herrührenden Klischees und Stereotypen geprägt“.[13] Seither hat auch der staatliche Druck auf in Deutschland lebende Chinesen, ihre Unterstützer und ihre Kooperationspartner zugenommen. So dürfen Chinesen, die bestimmte staatliche Stipendien erhalten, an manchen deutschen Hochschulen nicht mehr studieren. Deutsche Hochschulen stellen zunehmend ihre bisherige Kooperation mit chinesischen Kulturinstituten (Konfuzius-Institute) ein. Mit der Verschärfung des Konflikts mit der Volksrepublik steht – ähnlich wie zuvor gegen Russland und aktuell gegen Palästinenser – eine Verschärfung der inneren Frontbildung gegen China und gegen Chinesen bevor.
Quelle : https://www.german-foreign-policy.com/ v.23.05.2024
[1] S. dazu Die dritte Front.
[2] Nico Popp: Antifaschistische Zeitenwende. junge Welt 08.05.2024.
[3] S. dazu Von Tätern, Opfern und Kollaborateuren (II).
[4] S. dazu „Zum Schweigen gebracht“.
[5] Berliner Sparkasse sperrt Konto der Jüdischen Stimme. juedische-stimme.de 27.03.2024.
[6] Stark-Watzinger „fassungslos“ über Brief von Uni-Lehrkräften – Kritik auch vom Senat. rbb24.de 10.05.2024.
[7] Daniel Bax: „Betätigungsverbot“ für Varoufakis? taz.de 13.04.2024.
[8] Ronen Steinke: Einreiseverbot war rechtswidrig. sueddeutsche.de 15.05.2024.
[9] Alex Marshall: German Cultural Scene Navigates a Clampdown on Criticism of Israel. nytimes.com 07.12.2023.
[10] Kumars Salehi: Germany’s unprecedented crackdown on pro-Palestinian speech. thehill.com 17.12.2023.
[11] Philip Oltermann: ‘Free speech is a façade’: how Gaza war has deepened divisions in German arts world. theguardian.com 25.03.2024.
[12] Benjamin Barthe: Le médecin palestinien Ghassan Abu Sitta, témoin de l’enfer de Gaza, interdit d’entrée sur le territoire français. lemonde.fr 04.05.2024.
[13] Jia Changbao, Mechthild Leutner, Xiao Minxing: Die China-Berichterstattung in deutschen Medien im Kontext der Corona-Krise. Studien der Rosa-Luxemburg-Stiftung 12/2021. Berlin 2021. S. dazu Feindbild China.

Völkermord- Verletzung der Menschenrechte - EU-
Aus: Ausgabe vom 22.05.2024, Seite 1 / Titel
EU-GRENZREGIME
EU mordet mit
Recherche zu Tunesien, Marokko und Mauretanien: Systematische Menschen- und Asylrechtsverbrechen mit Geld und Wissen Brüssels
Von Ina Sembdner
In offiziellen Dokumenten hört es sich wohlwollend an: »Die EU setzt sich für den Schutz von Migranten und Flüchtlingen und die Unterstützung lokaler Gemeinschaften in Tunesien ein und ergreift gleichzeitig Maßnahmen, um legale Wege der Migration zu fördern und die irreguläre Ausreise zu verringern.« In der Realität sieht es jedoch so aus, dass das nordafrikanische Land die »mehr als 1,7 Milliarden Euro« (2014–2022) dafür verwendet, Asylsuchende systematisch aufzugreifen und in der Wüste auszusetzen. Die Vorwürfe sind nicht neu, wurden aber nun in einer umfassenden Recherche von der Plattform Lighthouse Reports gemeinsam mit verschiedenen europäischen Medien aufgearbeitet. Unter dem Titel »Desert Dump« (Wüstenhalde) kommt die Recherche zu dem Schluss, dass »Europa wissentlich die systematische Vertreibung von schwarzen Flüchtlingen und Migranten in Wüsten und abgelegene Gebiete in drei nordafrikanischen Ländern finanziert und manchmal sogar direkt daran beteiligt ist, um sie daran zu hindern, in die EU zu kommen«. Neben Tunesien sind das Marokko und Mauretanien.
Gesprochen haben die Journalisten mit Asylsuchenden selbst unter Zuhilfenahme von deren Videoaufnahmen, die geolokalisiert und damit bestätigt werden konnten, sowie Gesprächen mit früheren oder noch aktiven EU-Beamten, Vertretern der nationalen Polizeien und internationalen Organisationen. In Tunesien konnten so 13 Vorfälle zwischen Juli 2023 und Mai dieses Jahres nachgewiesen werden, »bei denen Gruppen Schwarzer Menschen in Städten oder an Häfen zusammengetrieben und viele Kilometer weit weggefahren wurden, in der Regel in die Nähe der libyschen oder algerischen Grenze, um sie dort abzuladen«. Die von Asylsuchenden selbst initiierte Protestbewegung Refugees in Libya, die seit 2021 öffentlichkeitswirksam gegen die dramatische Lage der Flüchtenden in dem Kriegsland aktiv ist, hatte am 10. Mai auf X ebenfalls von diesen Hetzjagden in Tunesien berichtet und Aufnahmen davon online gestellt: »In den vergangenen zwei Wochen wurden alle dunkelhäutigen Menschen, auch diejenigen, die als Tunesier identifiziert wurden, von Tür zu Tür und auf der Straße eingesammelt und in die östlichen Grenzregionen abgeschoben«, hieß es dort zu dem rassistischen Vorgehen der Einsatzkräfte.
Einer der EU-Töpfe, die zur Abwehr Asylsuchender eingesetzt werden, ist der EU-Treuhandfonds, aus dem in den vergangenen Jahren mehr als 400 Millionen Euro in die drei Länder geflossen sind. Ein Berater, der an einem dadurch finanzierten Projekt arbeitete, erklärte zu den Zielen dieses Fonds, dass den Flüchtenden damit das Leben schwergemacht werden solle: »Wenn Sie einen Migranten aus Guinea zweimal in der Sahara (in Marokko) zurücklassen, wird er Sie beim dritten Mal bitten, ihn freiwillig nach Hause zu bringen.« Oder sie sterben, wie nach UN-Angaben mindestens 29 Menschen, nachdem sie an der libyschen Grenze abgesetzt oder aus Tunesien vertrieben wurden. Ohnehin ist die Sahara mit offiziell seit 2014 6.204 registrierten die tödlichste Landmigrationsroute aller Zeiten.Interne Dokumente, die per Informationsfreiheitsgesetz erfragt wurden, belegen darüber hinaus, dass die EU direkt marokkanische paramilitärische Einheiten finanziert und dass das Königreich rassistische Profile erstellt und daran anknüpfend »vorwiegend schwarze Migranten zwangsumgesiedelt hat«. Die Verfolgung der Asylsuchenden geschah zudem mit direkter Beteiligung Spaniens. Eine Guineerin gab an, in der mauretanischen Hauptstadt Nouakschott von spanischen Polizeibeamten fotografiert worden zu sein, bevor sie in einem weißen Bus an die Grenze zu Mali verschleppt wurde.
Quelle: junge Welt v.22.05.2024/ Hazem Ahmed/REUTERS
Ausgesetzt in der Wüste: Asylsuchende an der libysch-tunesischen Grenze ohne jede Versorgung (Al-Assah, 5.8.2023)

ISGH - Haftbefehl wegen Völkermord des Israelischen Präsidenten - unterschiedliche Reaktionen
Im Unterschied zu Deutschland: Paris stellt sich hinter IStGH-Haftbefehle
21 Mai 2024 11:17 Uhr
Frankreich unterstützt den Internationalen Strafgerichtshof in seiner Bemühung um Strafverfolgung. Das Gericht hatte gestern Haftbefehle gegen Israels Ministerpräsident Netanjahu sowie Anführer der Hamas beantragt. Deutschland positioniert sich dagegen weiter einseitig zugunsten Israels.
Chefankläger Karim Khan hat beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) Haftbefehle gegen Israels Ministerpräsident Netanjahu, Verteidigungsminister Galant und drei führende Hamas-Mitglieder beantragt. Die EU ist über diese Entscheidung gespalten. Frankreich unterstützt den IStGH, meldet die Nachrichtenagentur Reuters.
"Frankreich unterstützt den Internationalen Strafgerichtshof, seine Unabhängigkeit und den Kampf gegen Straflosigkeit mit aller Kraft", zitiert Reuters Frankreichs Außenminister Stéphane Séjourné.
Es sei nun Sache des Gerichts, die von Chefankläger Khan vorgelegten Beweise zu prüfen und zu entscheiden, ob Haftbefehle ausgestellt werden, fügte er hinzu.
Damit droht eine Spaltung des westlichen Bündnisses und der EU. US-Präsident Joe Biden bezeichnete die Entscheidung des Strafverfolgers, Antrag auf Haftbefehl zu stellen, als "empörend". Er nannte den Schritt "illegal". Frankreich positioniert sich zu den USA nun diametral.
Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell teilte in einer Nachricht auf X lediglich mit, dass man die Entscheidung zur Kenntnis genommen habe.
Die deutsche Außenministerin bleibt bei ihrer einseitigen Positionierung und der Unterstützung Israels. Auf der Seite des Auswärtigen Amtes heißt es dazu:
"Durch die gleichzeitige Beantragung der Haftbefehle gegen die Hamas-Führer auf der einen und die beiden israelischen Amtsträger auf der anderen Seite ist der unzutreffende Eindruck einer Gleichsetzung entstanden."
Die Hamas sei verantwortlich für ein "barbarisches Massaker" am 7. Oktober 2022, dagegen habe "die israelische Regierung (…) das Recht und die Pflicht, ihre Bevölkerung davor zu schützen und dagegen zu verteidigen."
Für den Fall, dass der IStGH einen Haftbefehl gegen Netanjahu ausstellt, droht vor allem der EU aufgrund der unterschiedlichen Positionen eine Zerreißprobe. Als der IStGH einen Haftbefehl gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin ausstellte, hat sich Außenministerin Baerbock unmittelbar hinter die Entscheidung des IStGH gestellt. Justizminister Marco Buschmann hatte zugesichert, dass Deutschland
Quelle: RTd.21.05.2024

Gegen Völkermord an Palästinensern aktiv werden Teil 3
Aus: Ausgabe vom 21.05.2024, Seite 7 / Ausland
NAHOSTKONFLIKT
Strafandrohung für Kriegsverbrecher
Gaza: Dramatische Situation im Küstenstreifen. Internationale Gerichte beraten über Maßnahmen
Von Karin Leukefeld
Yves Herman/REUTERS
Trotz monatelanger Proteste, Verfahren vor IGH und IStGH soll das Gemetzel im Gazastreifen nach israelischen Vorstellungen in eine weitere Runde gehen (Den Haag, 16.5.2024)
Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) hat Haftbefehle gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und gegen den Anführer der Hamas in Gaza, Jahja Sinwar, beantragt. Das teilte der Gerichtshof am Montag in Den Haag mit. Weitere Haftbefehle will Chefankläger Karim Khan demnach gegen Israels Verteidigungsminister Joaw Gallant sowie gegen Sinwars Stellvertreter Mohammed Deif und gegen Hamas-Auslandschef Ismail Hanija erreichen. Laut Khan habe die Hamas »Verbrechen gegen die Menschheit« begangen. Netanjahu und Verteidigungsminister Gallant wiederum werden unter anderem das Aushungern der Bevölkerung als Kriegswaffe, willkürliche Tötungen und zielgerichtete Angriffe auf Zivilisten vorgeworfen. Ob die Haftbefehle erlassen werden, müssen nun die Richter der IStGH entscheiden.
Zuvor hatte Gallant am Montag im Gespräch mit dem US-amerikanischen Nationalen Sicherheitsberater Jacob Sullivan erklärt, dass die Bodenoffensive gegen Rafah und im gesamten Gazastreifen noch ausgeweitet werde. Sullivan war nach Israel gereist, um zu erfahren, wie die Bevölkerung bei den Angriffen geschützt und der verwüstete Gazastreifen in Zukunft verwaltet werden solle. Netanjahu hat bisher keinen entsprechenden Plan vorgelegt, seine extrem rechten Regierungspartner wollen die Palästinenser komplett vertreiben, den Gazastreifen besetzen und neu besiedeln. Gallant und Benjamin Gantz, die mit Netanjahu das israelische Kriegskabinett bilden, fordern eine internationale Verwaltung Gazas.
Unterdessen befasst sich der ebenfalls in Den Haag ansässige Internationale Gerichtshof (IGH) aktuell mit einem weiteren Eilantrag aus Südafrika, das im Januar 2024 eine Klage gegen Israel wegen des Verdachts auf einen Völkermord in Gaza eingereicht hatte. Südafrika beantragte am Donnerstag, dass der IGH Israel verpflichten solle, seinen Angriff auf Rafah zu stoppen. Die israelischen Truppen sollten sich aus dem Süden des Küstenstreifens zurückziehen, weil dort mehr als 1,4 Millionen Menschen Zuflucht gesucht hätten. Außerdem müsse Israel umgehend die Grenzübergänge Rafah und Kerem Schalom für Hilfslieferungen öffnen.
Israel wies am Freitag alle Vorwürfe zurück. Der stellvertretende israelische Generalstaatsanwalt für internationales Recht, Gilad Noam, sagte vor dem IGH, Israel habe das Recht, seinen Angriff auf Rafah fortzusetzen. Es sei eine »Tatsache, dass Rafah eine Militärbasis für die Hamas ist, die eine große Bedrohung für den Staat Israel« sei. Noam warf Südafrika vor, »den abscheulichen Vorwurf des Völkermords ins Lächerliche« zu ziehen. Letztlich wolle Südafrika für »seinen Verbündeten Hamas militärische Vorteile« erreichen, so Noam weiter: »Es will nicht, dass sie besiegt werden.«
Die Arabische Liga, die in der vergangenen Woche in Bahrain zusammentraf, hat wiederum eine internationale Friedenskonferenz für Palästina gefordert. Bis zur Umsetzung einer Zweistaatenlösung sollten die von Israel besetzten palästinensischen Gebiete von einer UN-Friedensmission geschützt werden. Die »israelische Aggression muss sofort gestoppt werden, die Besatzungstruppen müssen sich aus dem gesamten Gazastreifen zurückziehen, und die Belagerung muss aufgehoben werden«, hieß es in der Abschlusserklärung vom Freitag.
Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem jordanischen Außenminister Aiman Safadi hat Philippe Lazzarini, der Leiter des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA), am Sonnabend betont, dass es keine Sicherheit für die Zivilbevölkerung in Gaza gebe: »Kein Ort ist sicher. Niemand ist sicher«, so Lazzarini in Amman. Hilfsgüter fehlten, die Helfer hätten nichts mehr zu verteilen: keine Lebensmittel, keine Medikamente. Die Grenzübergänge nach Gaza blieben geschlossen. Um Hilfsgüter zu den Menschen zu bringen, werde auch dringend Treibstoff für die Lastwagen gebraucht, betonte Lazzarini. Auch dieser werde nicht durchgelassen. In den vergangenen Tagen hätten lediglich 33 Lastwagen in den südlichen Gazastreifen fahren dürfen. Angesichts der Situation der Menschen sei das völlig unzureichend.
Quelle: junge Welt v.21.05.2024/ Yves Herman/REUTERS
Trotz monatelanger Proteste, Verfahren vor IGH und IStGH soll das Gemetzel im Gazastreifen nach israelischen Vorstellungen in eine weitere Runde gehen (Den Haag, 16.5.2024)

Gegen Völkermord an Palästinensern aktiv werden Teil 2
IStGH-Ankläger beantragt Haftbefehl gegen israelischen Premierminister
Das Gericht sagte, Netanjahu und andere Angeklagte seien für "Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit" verantwortlich.
Der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, forderte am Montag Haftbefehle gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu; der Verteidigungsminister des hebräischen Landes, Yoav Gallant, in Bezug auf den Völkermord in Gaza, eskalierte in den letzten Monaten.
Als Akt der Äquidistanz umfasste ihre Petition jedoch auch Yahya Sinwar, den Anführer des palästinensischen Widerstands (Hamas) im Gazastreifen; Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, Oberbefehlshaber des militärischen Flügels der Hamas, bekannt als al-Qassam-Brigaden; und Ismail Haniyeh, Chef des Politbüros der Hamas.
Nach Ansicht des Gerichts sind alle Personen "strafrechtlich verantwortlich für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die auf dem Territorium Israels und des Staates Palästina begangen wurden".
Die Haftbefehle gegen zionistische Politiker sind das erste Mal, dass der IStGH den obersten Führer eines engen US-Verbündeten ins Visier nimmt.
Ein Gremium von IStGH-Richtern wird nun jedoch Khans Antrag auf Haftbefehle prüfen.
Die Anklagepunkte gegen Netanjahu und Gallant umfassen "Vernichtung, Verursachung von Hunger als Methode der Kriegsführung, einschließlich der Verweigerung humanitärer Hilfslieferungen, absichtliches Angreifen von Zivilisten in Konflikten", sagte Khan gegenüber Amanpour.
Als letzten Monat Berichte auftauchten, dass der Chefankläger des IStGH diese Vorgehensweise in Betracht ziehe, sagte Netanjahu, dass jeder Haftbefehl des IStGH gegen hochrangige israelische Regierungs- und Militärbeamte "eine Schandtat von historischem Ausmaß" wäre und dass Israel "ein unabhängiges Rechtssystem hat, das alle Gesetzesverstöße rigoros untersucht".
Als Antwort sagte Khan: "Niemand steht über dem Gesetz" und argumentierte, dass, wenn Israel mit dem IStGH nicht einverstanden ist, "es ihnen freisteht, trotz ihrer Einwände gegen die Gerichtsbarkeit eine Anfechtung vor den Richtern des Gerichts zu erheben, und das rate ich ihnen."
Israel und die Vereinigten Staaten sind keine Mitglieder des IStGH. Der IStGH beansprucht jedoch die Zuständigkeit für Gaza, Ostjerusalem und das Westjordanland, nachdem die palästinensischen Führer 2015 formell zugestimmt hatten, an die Gründungsprinzipien des Gerichtshofs gebunden zu sein.
Quelle: teleSUR v.20.05.2024/Bild "Ich habe berechtigten Grund zu der Annahme, dass Benjamin Netanjahu, der Premierminister, und Yoav Gallant, der Verteidigungsminister, die strafrechtliche Verantwortung für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit tragen." | Foto: Screenshot

Gegen Völkermord an Palästinensern aktiv werden Teil 1
Krieg in Nahost
Strafgerichtshof: Haftbefehl gegen Netanjahu und Sinwar beantragt
Aktualisiert am 20.05.2024, 14:13 Uhr AFP
Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs wirft Israel unter anderem das Aushungern von Zivilisten im Gaza-Krieg vor. Die Richter sollen Haftbefehle gegen Israels Premier und auch gegen die Hamas-Führung ausstellen.
Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) hat Haftbefehle gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und gegen den Anführer der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen, Jihia al-Sinwar, beantragt. Das teilte der Gerichtshof am Montag in Den Haag mit.
Chefankläger Karim Khan verfolgt Verbrechen während des Gaza-Krieges. Weitere Haftbefehle will Khan laut Mitteilung des IStGH gegen Israels Verteidigungsminister Joav Galant sowie gegen Sinwars Stellvertreter Mohammed Deif und gegen den Hamas-Auslandschef Ismail Hanija erreichen.
Den Hamas-Führern wirft der Ankläger der Mitteilung zufolge unter anderem "Ausrottung" sowie Mord, Geiselnahme, Vergewaltigungen und Folter als Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor.
Vorwurf: Aushungern von Zivilisten als Methode der Kriegsführung
Premierminister Netanjahu und Verteidigungsminister Galant wird unter anderem vorgeworfen, für das Aushungern von Zivilisten als Methode der Kriegsführung sowie für willkürliche Tötungen und zielgerichtete Angriffe auf Zivilisten verantwortlich zu sein. Ob die beantragten internationalen Haftbefehle erlassen werden, müssen nun die Richter der IStGH entscheiden.
Die israelische Regierung hatte kürzlich bereits Befürchtungen geäußert über mögliche strafrechtliche Verfolgung. Netanjahu schrieb bei X, Israel werde unter seiner Führung "niemals irgendeinen Versuch des Strafgerichtshofs akzeptieren, sein inhärentes Recht auf Selbstverteidigung zu untergraben". Der Regierungschef hatte vor einem "gefährlichen Präzedenzfall" gewarnt, "der die Soldaten und Repräsentanten aller Demokratien bedroht, die gegen brutalen Terrorismus und rücksichtslose Aggression kämpfen".
Das Gericht hat zwar keinerlei Möglichkeiten, Haftbefehle auch zu vollstrecken. Doch ist im Falle einer Vollstreckung die Bewegungsfreiheit der Gesuchten stark eingeschränkt ist. Denn eine Folge der Haftbefehle wäre, dass alle Vertragsstaaten des Gerichts verpflichtet sind, die Gesuchten festzunehmen und dem Gericht zu übergeben, sobald sie sich in ihrem Land befinden.
Bei den Attacken der Hamas im israelischen Grenzgebiet am 7. Oktober waren rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden. Die Angriffe waren Auslöser für die militärische Offensive Israels im Gazastreifen, bei der nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bisher mehr als 35 400 Menschen getötet worden sind. (dpa/mbo)

Position Südafrika gegenüber Aggressor Israel
Südafrika: "Wir werden nicht ruhen, bis die Freiheit Palästinas verwirklicht ist."
Rede der südafrikanischen Außenministerin Naledi Pandor auf der Globalen Anti-Apartheid-Konferenz zu Palästina
Rede des Ministers für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit, Dr. GNM Pandor, auf der Globalen Anti-Apartheid-Konferenz zu Palästina im Sandton Convention Centre, Freitag, 10. Mai 2024
Programmdirektor, verehrte Gäste, meine Damen und Herren
Es ist mir eine Ehre, heute hier auf der ersten Globalen Anti-Apartheid-Konferenz zu Palästina zu Ihnen zu sprechen. Dies ist ein Wendepunkt, da es der Beginn der globalen Anti-Apartheid-Bewegungen zu Palästina aus der ganzen Welt ist, die zusammenkommen und ihre Kräfte im Kampf für Gerechtigkeit für das palästinensische Volk bündeln. Wir möchten Reverend Frank Chikane unsere tiefe Wertschätzung dafür aussprechen, dass er die Bemühungen anführt, diese Konferenz in einem entscheidenden Moment für die Palästinenser Wirklichkeit werden zu lassen, die inmitten von Massenhunger, militärischen Angriffen und unaussprechlichen Kriegsverbrechen und Gräueltaten um ihr Überleben kämpfen.
Es war noch nie so dringend für die fortschrittlichen Kräfte rund um den Globus, sich in einer kollektiven Anstrengung zusammenzuschließen, um maximalen Druck auszuüben, um die Völkermordkampagne in Gaza zu beenden und das Apartheidsystem in Israel und den besetzten Gebieten zu beenden, das schlimmer ist als das, was wir in unserem eigenen Land erlebt haben. Die anhaltenden völkermörderischen Gräueltaten, die von Israel in den besetzten Gebieten begangen werden, haben den Fokus erneut auf die dringende Notwendigkeit gelenkt, dass die breitere internationale Gemeinschaft die Entkolonialisierung und ein Ende des israelischen Siedlerkolonialismus fordert. Progressive Kräfte müssen auf die Erfüllung des unveräußerlichen Rechts des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung drängen, das seit dem britischen Mandat systematisch verweigert wird, sowie auf das Recht der Flüchtlinge in der Diaspora auf Rückkehr.
Südafrika ist der Ansicht, dass die internationale Gemeinschaft verpflichtet ist, eine umfassende und gerechte Lösung für die Palästinenserfrage zu finden. Bisher hat der traditionelle Ansatz zur Konfliktlösung im israelisch-palästinensischen Konflikt keinen Frieden erreicht. Es ist möglich, dass ein anderer Ansatz, der eine Menschenrechtsperspektive zur Konfliktlösung verwendet, das hervorbringen könnte, was der alte Ansatz nicht konnte.
Ein Menschenrechtsansatz behauptet, dass die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankerten Prinzipien und Praktiken, einschließlich Gleichheit und Nichtdiskriminierung, Partizipation, Inklusion und Rechenschaftspflicht sowie die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit, alle Phasen des Friedensprozesses leiten sollten.
Südafrika ruft zu internationaler Solidarität und erhöhtem Druck auf, um die gerechte Sache des palästinensischen Volkes zu unterstützen, um seine legitime Forderung nach einem lebensfähigen unabhängigen Staat neben dem Staat Israel zu erfüllen. Südafrika ist bereit, enger mit Palästina zusammenzuarbeiten, und glaubt, dass der einzige Weg, einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten herbeizuführen, eine umfassende und verhandelte Lösung ohne Vorbedingungen ist, um die israelische Besatzung der palästinensischen Gebiete und die fortgesetzte Blockade und Belagerung des Gazastreifens durch Israel zu beenden.
Südafrika erkennt die Verbindung zwischen dem palästinensischen Kampf für Selbstbestimmung und der breiteren globalen Bewegung zur Befreiung sowohl vom Kolonialismus als auch von anderen damit verbundenen Formen des strukturellen und institutionalisierten Rassismus an. Südafrika hat in den letzten 30 Jahren der Demokratie konsequent sein Engagement für die palästinensische Sache gezeigt, und wir sind auch entschlossen, die Bemühungen zu unterstützen, die palästinensischen Fraktionen näher zusammenzubringen, damit sie mit einer Stimme sprechen und eine gemeinsame Vision für den Weg in die Zukunft haben.
Die Menschen in Südafrika und Palästina teilen ein unteilbares Band der Solidarität, das durch den Schmelztiegel der jeweiligen Befreiungskämpfe der beiden Nationen geschmiedet wurde. Südafrika war seit den Anfängen der Demokratie im Jahr 1994 immer ein Verbündeter Palästinas und hat ständig die Kämpfe des palästinensischen Volkes hervorgehoben, es in internationalen Gremien unterstützt und materielle Hilfe im Rahmen seiner Möglichkeiten angeboten.
Die palästinensische Erfahrung weckt Erinnerungen an Südafrikas eigene Geschichte der Rassentrennung und Unterdrückung. Als unterdrückte Südafrikaner haben wir die Auswirkungen von Rassenungleichheit und Diskriminierung aus erster Hand erlebt und identifizieren uns voll und ganz mit dem Kampf für Freiheit und Selbstbestimmung in Palästina.
Viele Jahrzehnte lang profitierte Südafrikas Freiheitskampf stark von der internationalen Solidarität. Die Schritte zu unserer eigenen Freiheit während des Befreiungskampfes in der Zeit zwischen 1960 und 1994 beruhten auf vier Säulen, die einen wichtigen Wendepunkt im Kampf gegen die Apartheid markierten, nämlich: Massenmobilisierung; bewaffnete Operationen; Untergrundorganisation; internationale Solidaritätsarbeit. Diese Säulen verstärkten die Notlage der unterdrückten Südafrikaner weltweit, rückten damit die damalige Regierung ins Rampenlicht und erweiterten den Aufruf zum Handeln in verschiedenen multilateralen Gremien. Diese Aktionen setzten die Regierung unter Druck, Gespräche zu führen, die folgten.
Daher glauben wir, dass das Gründungstreffen der Globalen Anti-Apartheid-Bewegung zu Palästina zu Recht in Südafrika als Startrampe zur Konsolidierung der internationalen Bemühungen zum Sturz des "Apartheid"-Israels ausgerichtet wird. Auf staatlicher und politischer Ebene schlagen wir vor, dass die Konferenz als Kollektiv vorrangig eine Rolle für "Frontstaaten" in Betracht ziehen sollte, wie es die Befreiungsbewegungen in Südafrika in unserem Kampf für Freiheit und Demokratie getan haben.
Die zentrale Rolle, die die Vereinten Nationen und die Zivilgesellschaft bei der Unterstützung unserer jeweiligen Befreiungskämpfe spielen, und die Auswirkungen, die dies auf die Erlangung unserer Selbstbestimmung hatte, müssen die Vereinten Nationen und ihre Mitgliedstaaten, die internationale Gemeinschaft und die Zivilgesellschaft ermutigen, das internationale Handeln und die internationale Koordinierung zu verstärken, um internationale Normen und Standards bei der Suche nach Gerechtigkeit für die Palästinenser aufrechtzuerhalten.
Die UN-Generalversammlung und der UN-Sicherheitsrat sind verpflichtet, die von Amnesty International und anderen Menschenrechtsorganisationen vorgelegten zwingenden Beweise sowie die Beweise, die in unserem Fall vor dem IGH vorgelegt wurden, zu berücksichtigen und Israel für seine Verbrechen gegen das palästinensische Volk zur Rechenschaft zu ziehen. Die Berichte werfen ein Schlaglicht auf israelische Gesetze und Praktiken, die eine Überprüfung und angemessene Maßnahmen rechtfertigen. Das von der israelischen Regierung erlassene nationale Gesetz ist ein Beweis dafür, dass die Regierung entschlossen ist, Israel als Apartheidstaat zu erhalten.
Seit 1948 haben die Palästinenser ethnische Säuberungen, die Nakba (Katastrophe) der Vertreibung und des Exils erlitten; die Verweigerung ihres Rechts, nach Palästina zurückzukehren; und ein anhaltender Prozess der Herrschaft, der ausländischen Besatzung, der Annexion, des Bevölkerungstransfers und des Siedlerkolonialismus.
Wir versammeln uns heute hier kurz vor dem 15. Mai, dem Tag, an dem wir des Nakba-Tages gedenken, der in der Geschichte den Beginn des nie endenden Kampfes für die Unabhängigkeit des palästinensischen Volkes und die Verweigerung seiner unveräußerlichen Rechte markierte, wie sie in internationalen Pakten wie der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte festgelegt sind.
Die Nakba beinhaltete eine Kombination aus Massenmord und der Zwangsvertreibung von Hunderttausenden einheimischer Palästinenser durch zionistische Milizen, um sie durch jüdische Einwanderer zu ersetzen und das zu schaffen, was heute als "Staat Israel" bekannt ist. Jetzt erleben wir die "Nakba Zwei" in Gaza.
Diese Konferenz bietet uns die Gelegenheit, Solidarität mit dem palästinensischen Volk zu zeigen und gemeinsam die Tatsache anzuerkennen, dass den Palästinensern immer noch viele unveräußerliche Rechte vorenthalten werden, einschließlich des Rechts auf Selbstbestimmung sowie des Rechts auf Unabhängigkeit.
Seit der Gründung Israels im Jahr 1948 sind seine Politik und Gesetzgebung von einem übergeordneten Ziel geprägt: eine jüdische demografische Mehrheit zu erhalten und die jüdisch-israelische Kontrolle über das Land zum Nachteil der Palästinenser zu maximieren. Um dies zu erreichen, haben aufeinanderfolgende israelische Regierungen absichtlich ein System der Unterdrückung und Herrschaft über die Palästinenser errichtet. Die Schlüsselkomponenten dieses Systems sind die territoriale Fragmentierung; Segregation und Kontrolle; Enteignung von Land und Eigentum; und die Verweigerung wirtschaftlicher und sozialer Rechte.
Die Leitprinzipien der derzeitigen israelischen Regierung, die im Dezember 2022 gebildet wurde, erklären ausdrücklich, dass "das jüdische Volk ein exklusives und unbestreitbares Recht auf alle Gebiete des Landes Israel hat" und verpflichtet sich, "Siedlungen in allen Teilen des Landes Israel zu fördern und zu entwickeln – in Galiläa, im Negev, auf den Golanhöhen, in Judäa und Samaria (besetztes Westjordanland); und die Übertragung der administrativen Befugnisse der Besatzung auf die israelische Regierung und die Ausweitung der direkten zivilrechtlichen Autorität über die Siedlungen, was einer De-jure-Annexion gleichkommt. Damit leitet Israel seine Annexion der besetzten Gebiete ein. In den letzten Monaten haben israelische Beamte und Siedlerbewegungen die Neuansiedlung des nördlichen Gazastreifens und von Orten gefordert, die die israelische Armee während ihres anhaltenden Völkermords im Gazastreifen zerstört hat.
Wir müssen betonen, dass es keine Lösung für die Situation geben kann, solange die internationale Gemeinschaft weiterhin Israels systematische Menschenrechtsverletzungen und das koloniale Siedler-Apartheid-Projekt ignoriert und dadurch das illegale israelische koloniale Siedlerprojekt auf Kosten der palästinensischen Befreiung unterstützt.
Am 21. August 2022 haben Südafrika und Palästina einen strategischen Dialog aufgenommen, um afrikanische Länder zur Unterstützung Palästinas und zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen zu Palästina auf dem Kontinent zu mobilisieren. Das andere Ziel war ein Meinungsaustausch auf der Grundlage der südafrikanischen Erfahrungen, die dazu beitragen werden, die israelische Vorherrschaft in den palästinensischen Gebieten zu beenden und das internationale Bewusstsein für die Notlage der Palästinenser zu schärfen, insbesondere für die Ausweitung der illegalen Siedlungen durch Israel.
Südafrika hat sich aktiv für den Rückzug Israels als Beobachtermitglied der Afrikanischen Union eingesetzt und wird sich weiterhin um die Unterstützung der Zweistaatenlösung und des Rechts auf Selbstbestimmung bemühen. Wir werden weiterhin die palästinensischen Bemühungen um die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen und die Schaffung positiver, glaubwürdiger und dauerhafter internationaler Mechanismen unterstützen, um die palästinensische Sache auf der Grundlage des Völkerrechts anzugehen. Wir würden gerne die Formulierung praktischer Strategien sehen, um die palästinensische Sache vor dem IStGH und dem IGH aufzugreifen, um Israel zum Apartheidstaat zu erklären und die Zivilgesellschaft sowohl in Palästina als auch international zu mobilisieren, um die palästinensische Sache zu unterstützen.
Südafrika unterstützt die Aufrufe an die internationale Gemeinschaft, die Vereinten Nationen und die Zivilgesellschaft, durch eine Reihe von Empfehlungen gegen Israels koloniales Siedler-Apartheid-Regime vorzugehen, einschließlich der Forderung an Drittstaaten, Schritte zur vollständigen Dekolonisierung Palästinas zu unternehmen. Dies muss den Abbau aller Strukturen der Herrschaft, Ausbeutung und Unterdrückung und die Verwirklichung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes beinhalten, einschließlich der Selbstbestimmung und der Rückkehr in seine Häuser, sein Land und seinen Besitz.
Drittstaaten müssen Israels diskriminierende Gesetze, Politiken und Praktiken anerkennen und verurteilen, die kumulativ ein Apartheidregime der systemischen rassistischen Unterdrückung und Herrschaft über das palästinensische Volk errichtet haben und weiterhin aufrechterhalten. Die Mitgliedstaaten der UN-Generalversammlung sollten eine Resolution zur Neukonstituierung des UN-Sonderausschusses gegen Apartheid und des UN-Zentrums gegen Apartheid verabschieden, um die israelischen Behörden für das Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Apartheid gegen das palästinensische Volk anzugehen und diese Gremien zu ermächtigen, die Zerschlagung des kolonialen Siedler-Apartheidregimes in Israel proaktiv voranzutreiben.
Wir möchten, dass die Anklagebehörde des Internationalen Strafgerichtshofs die laufenden Ermittlungen zur Situation in Palästina unverzüglich beschleunigt, einschließlich der Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die unter anderem die Verbrechen der Apartheid, des Bevölkerungstransfers, der Aneignung und Zerstörung von Eigentum, der Plünderung, der Verfolgung, der vorsätzlichen Tötung, des Mordes und der Folter auf dem palästinensischen Gebiet umfassen.
Südafrika setzt sich weiterhin für die Beendigung der Straflosigkeit für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord ein, und es ist zu hoffen, dass die Situation in Palästina vom IStGH priorisiert wird, um den Opfern dieser schweren Verbrechen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
Südafrika gehört zu den Ländern, die vom 19. bis 26. Februar dieses Jahres bei den öffentlichen Anhörungen des Internationalen Gerichtshofs (IGH) vorstellig wurden und ein Gutachten zu den rechtlichen Konsequenzen beantragt hatten, die sich aus der Politik und den Praktiken Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ostjerusalems, ergeben. Die Anhörungen fanden vor dem Hintergrund des tödlichen militärischen Angriffs auf Gaza statt, bei dem seit dem 7. Oktober über 33.000 Palästinenser getötet wurden.
Südafrika hielt am 20. Februar dieses Jahres eine Präsentation vor dem IGH und teilte dem Gerichtshof mit, dass Israel für die Apartheid gegen die Palästinenser verantwortlich ist und seine Besatzung von Natur aus und grundlegend illegal ist und implizit das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung verletzt.
Es ist ermutigend festzustellen, dass die Mehrheit der Länder, die die palästinensische Sache unterstützen, den Standpunkt vertreten, dass Israel durch die Umsiedlung von Teilen seiner Zivilbevölkerung in die besetzten palästinensischen Gebiete gegen Artikel 49 Absatz 6 der Vierten Genfer Konvention verstoßen hat, der es den Besatzungsmächten verbietet, Teile ihrer Zivilbevölkerung in das von ihnen besetzte Gebiet zu deportieren oder umzusiedeln. Es verbietet auch "individuelle oder massenhafte Zwangsumsiedlungen sowie Deportationen geschützter Personen aus besetzten Gebieten". Dies bestätigt das Gutachten des IGH zur Mauer im Westjordanland.
Nach Abschluss der Anhörungen werden die Richter nun alle Argumente, einschließlich 57 schriftlicher Eingaben, prüfen und eine beratende Stellungnahme abgeben. Es wird erwartet, dass die Richter etwa sechs Monate brauchen, um eine Stellungnahme in dem Fall abzugeben.
Südafrika ruft die Zivilgesellschaft und die Regierungen auf der ganzen Welt auf, die anhaltende Diskriminierung, die Enteignung von Land, die Unterdrückung des gewaltlosen Widerstands, die Unterdrückung zivilgesellschaftlicher Organisationen und die wahllosen Tötungen anzuerkennen und zu verurteilen und Druck auf den Staat Israel auszuüben, sein Besatzungs- und Apartheidsystem zu beenden.
Es müssen konzertierte internationale Anstrengungen unternommen werden, um eine gerechte Lösung der Palästinafrage herbeizuführen. Dies wird nicht nur dem palästinensischen Volk sein unveräußerliches Recht auf Selbstbestimmung und unabhängige Staatlichkeit geben, sondern letztlich auch zur Schaffung von Frieden in der Region beitragen.
In diesem Zusammenhang ist es unerlässlich, das internationale Handeln neu zu beleben und Wege zur Gerechtigkeit zu suchen. Wir müssen den Ruf nach internationalem Handeln verstärken, wobei die Vereinten Nationen eine führende Rolle spielen, um eine Lösung zu finden, die auf einer gerechten Lösung mit gerechten Gesetzen beruht, die auf Rechten basieren. Wir müssen als internationale Gemeinschaft nach einer Lösung suchen, die Gleichheit und Gerechtigkeit für alle ermöglicht, die das Recht haben, in den Gebieten Israels und Palästinas zu leben. Ohne diese werden Sicherheit, Würde und Wohlstand nicht erreicht werden.
Schließlich wird die südafrikanische Regierung weiterhin im Rahmen der Institutionen der Weltordnungspolitik tätig werden, um die Rechte, einschließlich des Grundrechts auf Leben, der Palästinenser in Gaza zu schützen, die nach wie vor dringend gefährdet sind, unter anderem durch israelische militärische Angriffe, Hunger und Krankheiten, und um die faire und gleiche Anwendung des Völkerrechts auf alle zu erreichen. im Interesse unserer kollektiven Menschlichkeit.
Wir werden weiterhin alles in unserer Macht Stehende tun, um die Existenz des palästinensischen Volkes als Gruppe zu erhalten, alle Akte der Apartheid und des Völkermords gegen das palästinensische Volk zu beenden und mit ihm zur Verwirklichung seines kollektiven Rechts auf Selbstbestimmung zu gehen. Wir tun dies weiterhin in den Fußstapfen von Nelson Mandela und werden nicht ruhen, bis die Freiheit der Völker Palästinas verwirklicht ist.
Ich danke Ihnen.
Quelle: progressive Internationale, Ausgabe Mai 2024

Israel mordet weiter !!!
Aus: Ausgabe vom 13.05.2024, Seite 1 / Ausland
KRIEG GEGEN GAZA
Israel bombt auch wieder im Norden
Eskalation in gesamtem Gazastreifen. Südafrika stellt weiteren Eilantrag beim IGH zu Rafah
Von Ina Sembdner
Die Liste der Staaten, die Israel beschuldigen, im Gazastreifen seine Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention zu verletzen, wird länger. Am Sonntag erklärte Ägypten, sich Südafrikas Klage vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) anzuschließen. Zuvor hatte sich Pretoria am Freitag erneut an den IGH gewandt und in einem Eilantrag gefordert, das Gericht müsse Israel zu weiteren Schritten bewegen, um einen Völkermord an Palästinensern zu verhindern.
Unter anderem solle Israel sich sofort aus Rafah im Süden des Gazastreifens zurückziehen. Die Eskalation der Lage schaffe »neue Tatsachen, die den Rechten der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen irreparablen Schaden zufügen«. Sie stelle eine »extreme Gefahr« für die humanitären Hilfslieferungen und die Grundversorgung sowie für das Überleben des palästinensischen Gesundheitssystems dar. Innerhalb einer Woche sind vor der drohenden Eskalation 300.000 Menschen erneut vertrieben worden, mehr als eine Million harren unter Bomben und Artilleriebeschuss weiter in Rafah aus.
Dabei weitete die israelische Armee die Angriffe auf die Enklave am Wochenende noch einmal deutlich aus. Im Fokus stand das im Norden gelegene Flüchtlingscamp Dschabalija. Der Armee hätten Geheimdienstinformationen vorgelegen, denen zufolge die Hamas versucht habe, in Dschabalija ihre zuvor zerstörte Infrastruktur wieder aufzubauen. Israel hatte die mehr als 100.000 Menschen in dem Bereich vor dem neuen Angriff zur »Evakuierung« aufgerufen. Die vorgebliche »Strategie« der »präzisen« Vorstöße ist aber offenbar auch in der Armee selbst nicht mehr vermittelbar. Stabschef Herzi Halevi habe am Wochenende von einer »Sisyphus-Aufgabe« gesprochen, so die Times of Israel.
US-Außenminister Antony Blinken verteidigte am Sonntag die Entscheidung seiner Regierung, die Lieferung von 3.500 Bomben an Israel zu stoppen. Man befürchte, dass sie in Rafah eingesetzt werden könnten und Israel habe keinen »glaubwürdigen Plan«, um die Zivilisten dort zu schützen. Die Washington Post berichtete, die USA würden im Gegenzug für einen Verzicht auf die Rafah-Offensive geheimdienstlich behilflich sein.
Quelle: junge Welt 13.05.2024/ Mahmoud Issa/REUTERS
Schon so gut wie alles zerstört: Das Flüchtlingscamp Dschabalija vor dem aktuellen Angriff (22.4.2024)

Menschenrechte in BRD - Minderjährige werden weiterhin zum Militärdienst geworben !!!
Aus: Ausgabe vom 11.05.2024, Seite 8 / Abgeschrieben
Keine Rekrutierung von Minderjährigen!
In einer Pressemitteilung des Bündnisses »Unter 18 nie! Keine Minderjährigen in der Bundeswehr«, mit der Überschrift »Herr Pistorius, stoppen Sie die Rekrutierung von Jugendlichen als Soldat:innen der Bundeswehr!« heißt es:
Mit einem dringenden Appell richten sich über 32.000 Bürgerinnen und Bürger, Organisationen der Zivilgesellschaft, Kirche und Gewerkschaften, Abgeordnete und Prominente an Verteidigungsminister Boris Pistorius und fordern ihn auf, das Rekrutierungsalter für Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr auf 18 Jahre zu erhöhen, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen. Dieser sogenannte »Straight 18-Standard« zum Schutz der Kinderrechte wird international von der großen Mehrheit aller Staaten eingehalten, nämlich von über 150 Ländern, darunter 24 NATO-Staaten und 21 EU-Staaten.
Die Bundeswehr ist dagegen eine von wenigen Armeen weltweit, die noch minderjährige Soldat:innen in ihre Reihen aufnimmt, mit stark zunehmender Tendenz, im Jahr 2023 wurden 1.996 Mädchen und Jungen im Alter von 17 Jahren rekrutiert. Laut Verteidigungsministerium kommt es immer wieder zu schweren Kinderrechtsverletzungen bei minderjährigen Soldat:innen der Bundeswehr, darunter sexuelle Gewalt, Unfälle und psychische Schäden, und sehr hohen Abbrecherquoten.
»Deutschland verletzt damit zentrale Schutzpflichten und Rechte der UN-Kinderrechtskonvention und der ILO-Konvention zum Schutz Minderjähriger vor riskanter und gefährlicher Arbeit. Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes hat Deutschland deswegen mehrfach (2008, 2014, 2022) dringend aufgefordert, das Rekrutierungsalter für Soldat:innen auf 18 Jahre zu erhöhen – ebenso wie der NATO-Staat Schweden vor kurzem im UN-Menschenrechtsrat«, sagt Ralf Willinger von der Kinderrechtsorganisation Terre des hommes Deutschland, Sprecher des Bündnis »Unter 18 nie – Keine Minderjährigen in der Bundeswehr!«. »Zivile Verträge der Bundeswehr mit Minderjährigen sind erlaubt und im Einklang mit den Kinderrechten. Soldatische Verträge dürfen aber strikt erst mit Erwachsenen geschlossen werden.« (…)
Quelle: junge Welt v.1105.2024/ Stefan Trappe/imago
Grundausbildung bei der Bundeswehr

Meinungsfreiheit in Deutschland ?
Aus: Ausgabe vom 10.05.2024, Seite 4 / Inland
PRESSEFREIHEIT
Begrenzte Freiheit
Publikum konfrontiert Regierungssprecher bei Veranstaltung zu Gaza in Berlin
Von Jamal Iqrith
Wie steht es aktuell um die Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland? Diese Frage wurde nicht nur am Sonnabend in der jW-Maigalerie diskutiert, sondern auch im arabischen Kulturzentrum »Der Divan« in Berlin-Zehlendorf. Zum Internationalen Tag der Pressefreiheit waren am Dienstag abend hochkarätige Gäste auf das Podium in dem von Katar finanzierten Haus geladen: Der polnische Journalist Tomasz Lejman, der ehemalige Journalist und heutige Regierungspressesprecher Steffen Hebestreit sowie der ehemalige Direktor des katarischen Senders Al-Dschasira, Wadah Khanfar, zugeschaltet aus der Hauptstadt Doha. Moderiert wurde der Abend von dem österreichischen Journalisten Ewald König.
Die Debatte wandelte sich nach einigen allgemeinen Bemerkungen zum Zustand der Pressefreiheit in der Welt sowie der Beschränkung von Berichterstattung durch große Internetkonzerne seitens Lejman rasch zu einem hitzigen Streitgespräch. Im Fokus stand die Position der deutschen Regierung zu der von der israelischen Regierung herbeigeführten humanitären Katastrophe im Gazastreifen und der Zustand der deutschsprachigen Berichterstattung. In beide Richtungen gab es heftige Kritik.
Der ehemalige Al-Dschasira-Chef Khanfar attackierte die Position der Bundesregierung scharf und nannte sie »heuchlerisch« und »diskriminierend«. Dabei machte er unter anderem auf die hohe Anzahl an getöteten Journalisten im Gazastreifen aufmerksam, die »die höchste in einem Krieg jemals sei«. Auch vor dem aktuellen Krieg und außerhalb des Gazastreifens seien palästinensische Journalisten gezielt durch die israelische Armee getötet worden, so etwa Shireen Abu Akleh im Mai 2022 in der Stadt Jenin in der Westbank. Den »westlichen Mainstreammedien« warf er Befangenheit vor.
Staatssekretär Hebestreit erklärte daraufhin nachdrücklich, er stimme Khanfar in vielen Punkten nicht zu. Dieser habe außerdem »mit keinem Wort« den 7. Oktober erwähnt, der die »Ursache für die aktuelle Zerstörung im Gazastreifen« sei. Der Eindruck Khanfars, dass es in der Bundesrepublik zu Palästina »nur eine Meinung« gebe, teile er nicht. Vielmehr herrsche in den deutschen Medien ein breiter »Meinungsbildungspluralismus«. Dass beide Sprecher unterschiedliche Meinungen austauschen könnten, sei Teil der Meinungs- und Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Die Schließung der Al-Dschasira-Büros in Israel am Sonntag verurteile die Bundesregierung.
Radio MSH
Moderator König warf ein, dass viele Menschen hierzulande das Gefühl hätten, sich zum Nahostkonflikt nicht frei äußern zu können. Auch werde die Berichterstattung vielfach als »nicht objektiv« wahrgenommen. Hebestreit widersprach dem vehement und erklärte, man könne sich durchaus äußern, müsse aber mit der Reaktion zurechtkommen, die man sich »verdiene«.
Auf jW-Nachfrage, ob das auch für die Teilnehmer bzw. Referenten des mutmaßlich rechtswidrig verbotenen Palästina-Kongresses sowie des gewalttätig aufgelösten Protestcamps vor dem Reichstagsgebäude am 26. April und der Besetzung der Freien Universität Berlin am Dienstag gelte, lautete die Antwort, die »Verfassungsgüter der Meinungs- und Pressefreiheit« seien nun mal »begrenzt« – zum Beispiel durch die Unverletzlichkeit der Menschenwürde. Diese Antwort sorgte unter den Zuhörern für Aufregung. Ein Mann rief aufgebracht: »Und was ist mit der Würde der Menschen in Gaza?«
Insgesamt war die Diskussion mit dem Publikum durch kritische Kommentare und Nachfragen gegenüber dem Regierungsvertreter gekennzeichnet. Sowohl die politische Position der Regierung als auch die Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wurden als unangemessen charakterisiert. Auch Lejman hatte zuvor erklärt, er konsultiere bei dem Thema lieber ausländische Medien, da die deutsche Berichterstattung mit »diplomatischen Elementen« vermischt sei.
Eines jedenfalls zeigte die Veranstaltung besonders eindrücklich: Während vielen Menschen die Unzulänglichkeit der deutschen Israel-Politik und Medienberichterstattung bewusst ist, ist die politische Elite weiterhin überzeugt, man sei in dieser Hinsicht »Vorzeigeland«.
Quelle: junge Welt v.10.05.2024/ imago0471796209h.jpg Bild- Jon-Luca Klockow/Zoonar.com/imago
Polizeieinsatz gegen das Palästina-Camp vor dem Reichstagsgebäude

08.05.
2024
Argentinien verstößt gegen Menschenrechte - Meinungsfreiheit
TeleSUR stützt sich auf die Entscheidung der argentinischen Regierung
Persönlichkeiten wie die Argentinier Atilio Borón, Stela Calloni und Lautaro Rivara haben den Akt der Zensur angeprangert.
Nachdem die Regierung von Präsident Javier Milei das Signal des Multiplattform-Informationssenders teleSUR aus dem Netz des Open Digital Television (TDA) in Argentinien eliminiert hat, haben viele Persönlichkeiten ihre Unterstützung für teleSUR bekundet.
Der venezolanische Vizepräsident für Kommunikation, Kultur und Tourismus, Freddy Ñáñez, teilte die von teleSUR veröffentlichte Erklärung, in der er das Gesetz verurteilte und betonte, dass "die Medienzensur Argentinien übernimmt".
In ähnlicher Weise sagte der venezolanische Präsident Nicolás Maduro, dass "Milei Angst vor teleSUR hat", und betonte, dass die Menschen in der Lage sein werden, die Sendungen über soziale Netzwerke zu sehen.
Der Politologe Atilio Borón aus dem südamerikanischen Land schrieb auf seinem Account im sozialen Netzwerk X, dass die vom Staatsoberhaupt seines Landes hochgehaltenen Freiheitsprinzipien "eine Farce sind, sie lassen die Pressefreiheit nicht zu" und bezeichnete ihn als "aufgeklärten Despoten".
Der argentinische Soziologe Lautaro Rivara betonte unterdessen, dass dies eine "sehr ernste" Tatsache sei, und versicherte, dass "libertäre 'Freiheit' nicht so weit geht wie das Recht auf Information und Kommunikation", während er präzisierte, dass etwas Ähnliches während der Regierung von Mauricio Macri passiert sei, aber "sie konnten und werden nicht in der Lage sein".
Auch der spanische Soziologe Aníbal Garzón wies darauf hin, dass die Entscheidung der argentinischen Regierung ein weiteres Beispiel dafür sei, was "Demokratien" tun, und zwar in Anführungszeichen, und neben der Schließung der Medien durch Argentinien führte er auch die Schließung des Signals des Senders Russia Today durch die Europäische Union an; Press TV in den Vereinigten Staaten und Al Jazeera in Israel.
Der kubanische Politologe und Direktor des Mesa Redonda-Programms, Randy Alonso, betonte, dass "teleSUR mehr ist als Milei".
In diesem Sinne prangerte die Agentur Prensa Rural auch an, dass die Regierungen von Argentinien und Israel "sich rühmen zu sagen, dass sie freie und moderne Demokratien sind, die die Freiheiten und darunter die sakrosankte Pressefreiheit respektieren", aber Kanäle wie teleSUR bzw. Al Jazeera schließen.
Der französische Journalist Romain Migus seinerseits sagte: "Milei greift die Meinungsfreiheit und das Recht der Argentinier an, in pluraler Weise informiert zu werden, indem er den lateinamerikanischen Sender teleSUR zensiert."
Argentinische Politiker wie der Gründer der Partei Concertación Forja, Gustavo López, sagten, dass es in seinem Land "kein Recht auf Anhörungen, keinen Meinungsplural und keine Vielfalt" gebe. In diesem Zusammenhang prangerte er an, dass die Regierung Milei "gegen die Meinungsfreiheit" sei.
In diesem Zusammenhang prangerte die argentinische Journalistin Stella Calloni an, dass die Kommunikation vom ersten Moment an von der Rechten verfolgt wurde, denn "auch in der Macri-Regierung war das erste, was sie getan haben, das neue Projekt des audiovisuellen Mediengesetzes zu beenden, das für das Land so wichtig ist und das im Wesentlichen demokratisierend war".
In der Zwischenzeit gab der Direktor der Lateinamerikanischen Zusammenfassungsplattform, Carlos Aznárez, eine Erklärung ab, in der er die Entscheidung der Regierung Milei zurückwies.
"Für Präsident Javier Milei und die Unternehmen, die ihn unterstützen, ist Telesur zweifellos eine Gefahr, da es mit der Wahrheit informiert und das Bewusstsein in den breiten Teilen der Bevölkerung weckt, die der Sender mit seinen Inhalten erreicht. Im Zusammenhang mit dem Angriff, den diese Regierung täglich gegen die Volkssektoren ausübt, ist die Zensur also ein Instrument, das nicht nur intern ausgeübt wird (Schließung der Telam-Agentur, Entleerung der Programme des öffentlichen Fernsehens und Angriff auf die alternativen Medien), sondern auch versucht, die Tür für die spanisch-amerikanischen Medien zu schließen, die in die befreiende Ideologie eingeschrieben sind, die eher früher als später in den Vereinigten Staaten durchgesetzt wird. des Kontinents."
In diesem Sinne versicherte er, dass "wir von Resumen Latinoamericano aus weiterhin Telesur ausstrahlen werden, wie wir es seit jener Zeit getan haben, als eine andere rechtsgerichtete argentinische Regierung, die von Mauricio Macri, ebenfalls Zensurmaßnahmen gegen diesen, unseren Sender auf dem Kontinent und in der Welt eingeleitet hat. Adelante Telesur, wahrheitsgemäße Informationen aus den Dörfern sind eine befreiende Tatsache."
Der spanisch-französische Intellektuelle und Journalist Ignacio Ramonet verurteilte seinerseits das Vorgehen des argentinischen Staatschefs und bezeichnete es als "einen typischen Akt des obskurantistischen Neofaschismus. Ein weiterer Angriff auf die Freiheiten."
Auch die Bolivarische Allianz für die Völker Unseres Amerikas – Handelsvertrag der Völker (ALBA-TCP) lehnte die Abschaffung des teleSUR-Signals ab und bedauerte diese Art von Vorgehen.
"Diese Aktion untergräbt die Stimme der Menschen auf der Welt und untergräbt das Recht, sich zu informieren und informiert zu werden. Mit dieser Entscheidung wird die Doppelmoral bestätigt, die die argentinische Regierung anwendet, indem sie rhetorisch mit der Bedeutung der Freiheit prahlt und gleichzeitig die Meinungsfreiheit von Millionen ihrer Bürger beschneidet", betonte er.
Auch die panamaische Plattform Frenadeso Noticias verurteilte das Vorgehen der argentinischen Regierung und betonte, dass "wir von unserem populären Kommunikationsraum, der Teil von Frenadeso Panama ist, unsere Solidarität mit diesem Raum der Integration der teleSUR-Völker und ihrer Arbeiter zum Ausdruck bringen".
Im Namen der Landlosenbewegung Brasiliens prangerte João Pedro Stedile an, dass "die Pressefreiheit der Bourgeoisie erstens funktioniert, wenn sie Profite abwirft; zweitens, ob sich die Journalisten daran halten; und drittens, wenn sie gut über sie sprechen", beendete der argentinische Präsident die Übertragung des TeleSUR-Signals an das lateinamerikanische Fernsehen.
Die Organisationen des Freien Volkes widersetzten sich der Zensur der Multiplattform durch die Milei-Regierung; Inzwischen hat sich auch die argentinische Organisation Descamisados der Ablehnung der Aktion angeschlossen.
"Für uns ist der Entzug des teleSUR-Signals aus Argentinien nicht nur ein Angriff auf die Meinungsfreiheit, sondern auch auf die Einheit Lateinamerikas. Ein Angriff, der von einer Regierung verübt wird, die das Konzept der Öffentlichkeit zerstört und nur diejenigen bevorzugt, die nach Geschäften und den "Medien der Desinformation" streben. Wo Information kein Recht für alle ist, sondern eine Ware und ein destabilisierendes Instrument im Dienste der Interessen des Imperialismus und der regionalen Rechten", betonte er.
Descamisados sagte, dass teleSUR "in einem stetigen Tempo, mit Rebellion und Solidarität, auf dem Weg der Wahrheit und Einheit aller Völker weitergehen wird, die gegen Kolonialismus, Unterdrückung, Lügen und Gewalt der imperialen Wirtschaftssektoren kämpfen".
Der nationale Abgeordnete Juan Marino vom Block Union für das Vaterland der argentinischen Abgeordnetenkammer wies seinerseits auch die Entscheidung von Präsident Javier Milei zurück, die "das Recht auf Information, die Pluralität der Stimmen und die Meinungsfreiheit bedroht".
Auch der Journalist Víctor Hugo Morales drückte seine Solidarität mit teleSUR aus und sagte, dass die argentinische Regierung keine Probleme mit anderen US-Fernsehsendern habe, sondern Probleme mit teleSUR aufgrund eines ideologischen Problems.
"teleSUR ist ein Sender der lateinamerikanischen Linken, aber deshalb wird er nicht daran gehindert, mit dem Rest des kontinentalen Journalismus zu koexistieren", sagte er und prangerte an, dass die Entscheidung von der Regierung von Mauricio Macri im Dienste der Vereinigten Staaten getroffen worden sei.
In diesem Sinne sagte er: "Das ist es, was der Neoliberalismus in der Welt tut. Länder, die anders denken, werden eingesperrt, in die Enge getrieben, von all jenen genommen, die in der Welt unterwürfig und unterwürfig sind und dafür sorgen, dass niemand mit ihnen verhandelt, dass ihnen alles verwehrt wird. Und natürlich führen sie, sie ziehen diese Regierungen in eine Menge Probleme, manchmal direkt bis zum Scheitern."
In der Zwischenzeit haben auch Nutzer in sozialen Netzwerken ihre Verurteilung der Schließung des Multiplattform-Signals zum Ausdruck gebracht und behauptet, dass die Tatsache zeige, dass Argentinien in den Händen der Rechten sei, während die Vereinigten Staaten schweigen.
Quelle: teleSUR v.08.05.2024




Israel verletzt Menschenrechte-Meinungsfreiheit
Aus: Ausgabe vom 08.05.2024, Seite 7 / Ausland
KRIEG GEGEN GAZA
Berichte aus Trümmerwüste unerwünscht
Verbot von Al-Dschasira in Israel stößt auf heftige Kritik. Sender spricht von »kriminellem Akt«
Von Gerrit Hoekman
Es ist nicht das erste Mal, dass der panarabische Sender Al-Dschasira von israelischer Seite angegriffen wird. Allerdings kommt das Verbot, das am Sonntag mit Razzien und der Beschlagnahmung von Equipment durchgesetzt wurde, zu einem Zeitpunkt, da sich die Verhandlungen zwischen Hamas und Tel Aviv an einem kritischen Punkt befinden und der Angriff auf Rafah unmittelbar bevorsteht. In Israel ist der Sender nun weder über Kabel noch über Satellit zu empfangen. Offenbar soll die israelische Bevölkerung nicht mehr sehen, was ihre Armee im Gazastreifen anrichtet. Al-Dschasira ist eine der wenigen TV-Stationen, deren Reporter nach wie vor live aus der Trümmerwüste berichten.
»Der Hetzsender Al-Dschasira wird in Israel geschlossen«, hatte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Aktion angekündigt. Das Kabinett habe den Schritt einstimmig genehmigt. Das Parlament hatte am 1. April ein Gesetz verabschiedet, nach dem ausländische Rundfunkanstalten vorübergehend dichtgemacht werden können, wenn sie die nationale Sicherheit bedrohen. Das sieht die Regierung im Fall von Al-Dschasira als gegeben an. Die Schließung soll deshalb solange bestehen bleiben, wie der Krieg andauert. Das israelische Vorgehen ist nicht nur ein eklatanter Verstoß gegen die Pressefreiheit, sondern auch ein Schlag ins Gesicht des Emirats Katar, das gemeinsam mit Ägypten und den USA seit Wochen einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas zu vermitteln versucht. Katar finanziert den TV-Sender. Die katarische Regierung äußerte sich offiziell bis jetzt nicht zu dem Vorfall.
Das hinter dem Sender stehende »Al-Dschasira Media Network« sprach hingegen von einem »kriminellen Akt, der die Menschenrechte und das Grundrecht auf Zugang zu Informationen verletzt«. Die Fernsehstation habe das Recht, »ihrem weltweiten Publikum weiterhin Nachrichten und Informationen bereitzustellen«. Die von Israel erhobene Anschuldigung sei »eine gefährliche und lächerliche Lüge«. Bereits im vergangenen Monat beklagte Al-Dschasira »eine Reihe systematischer israelischer Angriffe«, um den Sender zum Schweigen zu bringen. Mehrere Reporter seien im Gazastreifen gezielt getötet worden, unter anderem der belgisch-palästinensische Journalist Samir Abu Dakka und Hamsa Dahduh, der älteste Sohn des Leiters des Al-Dschasira-Büros in Gaza, Wael Dahduh. Nach Angaben des »Komitees zum Schutz von Journalisten« wurden bis jetzt insgesamt 97 Kolleginnen und Kollegen im Gazakrieg getötet.
Auch international stößt das Verbot auf scharfe Kritik. Vom UN-Menschenrechtsbüro hieß es auf X: »Freie und unabhängige Medien sind für die Gewährleistung von Transparenz und Rechenschaftspflicht unerlässlich. Dies gilt um so mehr angesichts der strengen Beschränkungen für die Berichterstattung aus Gaza. Die Meinungsfreiheit ist ein zentrales Menschenrecht. Wir fordern die Regierung auf, das Verbot aufzuheben.« Der Sicherheitsberater der US-Regierung, John Kirby, erklärte am Montag: »Wir unterstützen diese Aktion nicht.« Tim Dawson von der International Federation of Journalists erinnerte gegenüber Al-Dschasira daran, dass dies leider Teil einer langen Reihe von Maßnahmen sei, »die die israelische Regierung ergriffen hat, um die freie Berichterstattung über diesen Konflikt zu verhindern«. Im Widerspruch dazu lege das Land »großen Wert darauf, eine Demokratie zu sein, und ich finde die Idee, dass es einen internationalen Sender von beträchtlichem Ruf und Geschichte einfach schließen kann, abscheulich«.
Eine Verurteilung des Vorgehens wollte man in Berlin nicht vornehmen. Auf die Frage der jungen Welt, ob die Schließung der TV-Station Auswirkungen auf die aktuell noch laufenden Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen haben könne, erklärte die Außenamtssprecherin Kathrin Deschauer auf der Bundespressekonferenz am Montag: »Wir werden alles daran setzen, auch in Gesprächen, dass das hohe Gut der Pressefreiheit gewährleistet wird.« Aber in der jetzigen Situation müssten alle Seiten Anstrengungen unternehmen, »damit es zu einer humanitären Feuerpause kommt und die Geiseln befreit werden können«. Al-Dschasira trage dazu bei, die Berichterstattung in einem Konfliktgebiet zu gewährleisten. Die Erfahrung zeigt jedoch: Appelle in Richtung der israelischen Regierung verhallen ungehört wie der Schrei eines Dromedars im Wüstensturm.
Quelle: junge Welt v.08.05.2024/Bild Nasser Nasser/AP Photo
Auch das Al-Dschasira-Büro in Ramallah ist von der israelischen Verbotsverfügung betroffen (5.5.2024)

Menschenrechte - hier Meinungs- und Versammlungsfreiheit in BRD verletzt
Aus: Ausgabe vom 08.05.2024, Seite 2 / Inland
TAG DER BEFREIUNG
»Willkürliche Anmaßungen der Exekutive«
8. und 9. Mai: Polizeiverordnungen noch um Liedgut ergänzt. Würdevolles Gedenken erschwert. Ein Gespräch mit Benjamin Düsberg
Interview: Annuschka Eckhardt
Benjamin Düsberg ist Rechtsanwalt in Berlin mit dem Schwerpunkt Strafverteidigung
Die Verordnung der Berliner Polizei für die Feierlichkeiten zum Tag der Befreiung und zum Tag des Sieges haben sich in diesem Jahr noch einmal verschärft. Was ist alles nicht erlaubt?
Ausgerechnet an den Sowjetischen Ehrenmalen Treptow, Tiergarten und Schönholzer Heide und ausgerechnet am Tag der Befreiung soll es verboten sein, Fahnen oder Wappen der Sowjetunion zu zeigen. Symbole mit Russland-Bezug sind ebenso verboten. Sogar sämtliche Varianten des bekanntesten sowjetischen Liedes zum Zweiten Weltkrieg, »Der heilige Krieg«, sind verboten. In der ersten Strophe heißt es: »Erhebe dich, gewaltiges Land, erhebe dich für den tödlichen Kampf gegen die faschistische dunkle Macht, gegen die verfluchte Bande!« Das darf nicht gesungen werden an Orten, an denen 27 Millionen getöteter Bürger der Sowjetunion und des Sieges der Roten Armee gedacht wird, der die Welt von der Geißel des deutschen Faschismus befreite. Die übrigen Details dieser geschichtsvergessenen Anordnung kann ja jeder selbst der Verfügung entnehmen.
Widersprechen diese Verordnungen nicht dem deutsch-russischen Gesetz über die Kriegsgräberfürsorge vom 16. Dezember 1992, laut dem die Polizei Berlin in der Verpflichtung steht, sowjetische Ehrenmale und Kriegsgräber vor dem Hintergrund der geschichtlichen Verantwortung Deutschlands zu schützen?
Ich würde sagen, dem Abkommen widerspricht es wohl nicht. Bei dem geht es eher um den Schutz der Grabstätten vor Zerstörung, Vandalismus und Entstellung. Allerdings verletzt die Verfügung ganz eindeutig die Versammlungsfreiheit der Menschen, die an den Gedenkstätten den Tag der Befreiung begehen möchten.
Russisches Liedgut ist laut der Verordnung verboten – das eben erwähnte sowjetische Lied »Der heilige Krieg« ebenfalls. Wie geht das Verbot des Singens sowjetischer Soldatenlieder mit dem von der Polizei geforderten »würdevolle Gedenken an die gefallenen Soldatinnen und Soldaten der damaligen Sowjetarmee« zusammen?
Beides ist gar nicht zu vereinbaren. Es ist ein Hohn, wenn die Versammlungsbehörde die unwürdigen Einschränkungen ausgerechnet mit dem würdevollen Gedenken an die Gefallenen der Sowjetarmee begründet – solches wird durch die Regelungen gerade verhindert. Und wie kann sich die Berliner Versammlungsbehörde anmaßen zu definieren, wie ein würdevolles Gedenken am Tag der Befreiung auszusehen hat?
»Im Zweifel gilt der politische Wille und nicht das Recht«, sagten Sie vergangenen Sonnabend auf einer jW-Veranstaltung. Was gibt es dem entgegenzusetzen?
Habe ich das gesagt? (lacht) So einfach ist es wohl auch wieder nicht. Die Politik denkt in einem Freund-Feind-Schema, welches einem Rechtsstaat eigentlich fremd sein sollte, aber die Justiz beeinflusst. Die Gerichte als dritte Gewalt haben willkürliche Anmaßungen der Exekutive, wie zum Beispiel diese politisch motivierte Allgemeinverfügung zum 8./9. Mai, nüchtern zurückzuweisen. Die Versammlungs- und die Meinungsfreiheit erhalten besondere Bedeutung als Minderheitengrundrechte und müssen gerade als solche geschützt werden. Leider versagt die Justiz oft genug gerade in aufgeheizten politischen Kontexten, als gerade dann, wenn ihre Nüchternheit besonders gebraucht würde.
Wie können von polizeilichen Maßnahmen Betroffene vor Ort reagieren?
Widerspruch einlegen, das Gespräch suchen, Kompromisse finden, aber sich möglichst nicht wehren gegen die polizeilichen Maßnahmen. Sonst gibt es noch ein Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.
Wie waren denn Ihre Erfahrungen in den vergangenen Jahren während dieser Tage?
Ich habe mich auch in den letzten Jahren gewundert, dass diese Verfügung überhaupt erlassen wurde und dann auch von dem Berliner Oberverwaltungsgericht gehalten wurde. Während das Berliner Verwaltungsgericht, das in erster Instanz tatsächlich mit einer sehr ausführlichen und präzisen Begründung diese Untersagung sowjetischer und russischer Symbole aufgehoben hatte, hat das Oberverwaltungsgericht dann wieder der Versammlungsbehörde recht gegeben. Das war sehr enttäuschend.
Quelle: junge Welt v.08.05.2024/Bild Funke Foto Services/IMAGO
Sowjetisches Ehrenmal im Treptower Park: Auch im vergangenen Jahr gab es Beschränkungen und Repression am Tag der Befreiung (Berlin, 8.5.2023)

Kampf um Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 30.03.2024, Seite 2 / Ausland
KRIEG GEGEN GAZA
IGH fordert erneut Schutz ein
Gaza: Gerichtshof verlangt Maßnahmen gegen Hunger. Israel bombt weiter
Von Ina Sembdner
Einstimmig kann sich der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag noch immer nicht zu den in seinem Beschluss vom 26. Januar genannten vorläufigen Maßnahmen durchringen. Einigkeit gab es am Donnerstag jedoch unter den 16 Richtern, Israel »in Übereinstimmung mit seinen Verpflichtungen aus der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes« dazu aufzufordern, unverzüglich alle notwendigen und wirksamen Maßnahmen zu ergreifen, um die Versorgung der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen mit Grundnahrungsmitteln sicherzustellen und die sich ausbreitende Hungersnot zu stoppen.
Weiterhin wird vom IGH gefordert, dass »sein Militär keine Handlungen begeht, die eine Verletzung der Rechte der Palästinenser in Gaza als geschützte Gruppe darstellen (…), einschließlich der Verhinderung der Lieferung von dringend benötigter humanitärer Hilfe«. Wie beim ersten Beschluss bleibt Israel vier Wochen Zeit, um die Umsetzung der geforderten Maßnahmen zu belegen. »Das Gericht stellt fest, dass die Palästinenser in Gaza nicht mehr nur von einer Hungersnot bedroht sind (…), sondern dass die Hungersnot bereits begonnen hat«, so die Richter in ihrem Beschluss. Die neuen Maßnahmen wurden von Südafrika im Rahmen seiner Klage beantragt, die Israel des staatlich gelenkten Völkermordes in Gaza beschuldigt.
Doch auch nach der seit Montag bindenden UN-Resolution des Weltsicherheitsrates, die einen sofortigen Waffenstillstand fordert, hat Israel sein Vorgehen – vor allem im Süden der Enklave – noch verschärft. Nach den Worten von Premier Benjamin Netanjahu wird die Militäroffensive auf Rafah, wo rund 1,4 Millionen Menschen Zuflucht gesucht haben, bereits vorbereitet. Und auch Hilfseinsätze im nördlichen Gazastreifen werden von den israelischen Behörden trotz der sich ausbreitenden Hungersnot weiterhin verweigert, wie das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten mitteilte.
Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) äußerte derweil eine ganz eigene Interpretation von Selbstbestimmung. Auf die Frage, wer im Gazastreifen nach Kriegsende das Sagen haben sollte, sagte sie der Funke-Mediengruppe (Freitag): »Die Palästinenserinnen und Palästinenser – frei von der Hamas, frei von Terror, selbstbestimmt und mit einer frei gewählten Regierung aller Palästinenser, also auch im Westjordanland.«
Quelle: junge welt v.30.03.2024/ Montecruz Foto
Unterstützung von der Straße: Protest gegen den Krieg in Gaza am Freitag im Berliner Hauptbahnhof

Israel begeht Kriegsverbrechen
KOLONIALISMUS
Israels Mehlmassaker in Gaza ist ein schreckliches Kriegsverbrechen
Israel tötete Einwohner des Gazastreifens, die auf Mehl warteten, und setzte seine Angriffe auf Zivilisten fort.
Israelische Truppen setzten den unerbittlichen Angriff auf Zivilisten in Gaza fort und töteten mehr als 100 hungernde Palästinenser, die auf Mehl aus Hilfslastwagen warteten. Ermutigt durch die Komplizenschaft der USA, beharrt Israel darauf, ungestraft in Gaza zu agieren.
Am Donnerstag im Morgengrauen feuerten israelische Truppen auf eine Menge hungernder Palästinenser, die in Gaza-Stadt auf Hilfslastwagen warteten, wobei über hundert Menschen getötet und mehr als tausend weitere verletzt wurden. Es wird erwartet, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen wird, da die meisten Krankenhäuser in Gaza ihren Betrieb eingestellt haben, da ihnen Treibstoff, Medikamente und Blut ausgegangen sind.
Aufnahmen zeigen, wie israelische Soldaten wahllos auf Tausende von Zivilisten schießen, die sich am al-Nabulsi-Kreisverkehr in der al-Rasheed-Straße versammelt hatten, um Mehl von Hilfslastwagen zu erhalten. Medizinische Quellen berichten, dass die meisten Opfer direkt in Kopf, Brust oder Bauch geschossen wurden. Jadallah al-Shafei, die Pflegedirektorin des al-Shifa-Krankenhauses im Norden des Gazastreifens, sagte gegenüber Al Jazeera: "Alle Verletzungen sind auf Schüsse und Artilleriegranaten zurückzuführen. [Israelische] Behauptungen über eine Massenpanik sind völlig erfunden."
Israelische Panzer überfuhren Tote und Verwundete. Viele Opfer wurden mit Eselskarren in Krankenhäuser gebracht, da die Krankenwagen den Ort des Geschehens nicht erreichen konnten, um alle Toten und Verwundeten einzusammeln.
Die Szene glich einem Schlachthaus. Die meisten Opfer waren Kinder. Man hörte eine untröstliche Mutter durch die Menge schreien: "Mein Mädchen ist fort; Sie hungert seit sieben Tagen.« Eine Frau im Kamal-Adwan-Krankenhaus flehte die Welt an: "Wir werden belagert. Habt Mitleid mit uns. Der Ramadan steht vor der Tür. Die Leute sollten uns anschauen. Mitleid mit uns."
Das Massaker ist ein Kriegsverbrechen zusätzlich zu einem Kriegsverbrechen, da Israel palästinensische Zivilisten abgeschlachtet hat, die es seit Monaten hungern lässt und deren einziges Verbrechen darin bestand, Schlange zu stehen, um Mehl für ihre Familien zu erhalten. Palästinensische Beamte haben das Gemetzel als "kaltblütiges Massaker" bezeichnet. Die Palästinenser haben es das Mehlmassaker genannt – oder vielleicht passender das Massaker des roten Mehls, in Anlehnung an das blutbefleckte Mehl, das auf dem Boden verstreut liegt.
Der UN-Sicherheitsrat hat eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Der Chef des Hilfswerks der Vereinten Nationen (UNRWA) sprach von einem "weiteren Tag aus der Hölle" in Gaza, während der Chef der UN-Hilfsorganisation, Martin Griffiths, das "Leben beklagte, das mit erschreckender Geschwindigkeit aus Gaza abfließt". Nach dem Massaker hat der kolumbianische Präsident Petro Gustavo die Waffenkäufe aus Israel ausgesetzt und erklärt: "Die ganze Welt sollte [Benjamin] Netanjahu blockieren."
Unterdessen bezeichnete Itamar Ben-Gvir, Israels Minister für nationale Sicherheit, die Soldaten, die das Massaker begangen hatten, als "Helden" und versprach volle Unterstützung für die israelischen Truppen in Gaza. Mit in den USA hergestellten Drohnen zeichneten die israelischen Streitkräfte das Gemetzel zum Spaß aus der Luft auf. Israelische Telegram-Kanäle haben das Massaker an hungernden Palästinensern gefeiert und die Aussicht auf Kannibalismus bejubelt. Viele Israelis haben sich dafür eingesetzt, die Palästinenser in Gaza verhungern zu lassen.
Die Zahl der palästinensischen Todesopfer hat inzwischen 30.000 überschritten, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Mehr als siebzigtausend Menschen wurden verletzt. Fast zwei Millionen Zivilisten wurden vertrieben. Die Hälfte der Bevölkerung hungert. Es wird angenommen, dass mehrere hunderttausend Palästinenser trotz des israelischen Befehls zur Evakuierung des Gebiets im Norden des Gazastreifens verbleiben. Viele sind auf den Verzehr von Tierfutter reduziert, um zu überleben. Aufnahmen von knochendünnen Kindern, die tierisches Futter erbrechen und dann sterben, haben Beoabachter schockiert. Ärzte in Gaza haben davor gewarnt, dass die wachsende Hungersnot in Gaza "Kinder in Skelette verwandelt".
Die Welt wird Zeuge, wie sich die brutale Entmenschlichung eines ganzen Volkes am helllichten Tag entfaltet, während sich täglich Tausende von hungernden Palästinensern am Strand von Gaza drängen und verzweifelt nach Hilfsflugzeugen winken, während sie Lebensmittel weit und tief ins Meer abwerfen.
Internationale Organisationen agieren hilflos. Hilfsorganisationen sagen, dass es wegen der Präsenz des israelischen Militärs fast unmöglich geworden ist, humanitäre Hilfe in Gaza zu leisten. Anfang dieses Monats kündigte das Welternährungsprogramm an, dass es die Lieferungen in den Norden wegen des wachsenden Chaos und der unerbittlichen Bombardierungen aussetzen werde, obwohl es davor gewarnt hatte, dass "eine Hungersnot unmittelbar bevorsteht".
Seit fast fünf Monaten und trotz internationaler Appelle, Hilfsgüter nach Gaza zu lassen, hat Israel dem belagerten Gazastreifen Nahrung, Wasser und Medikamente vorenthalten. Sie hat den Grenzübergang Rafah zu Ägypten abgeriegelt, während israelische Siedler und Soldaten weiterhin Hilfslastwagen am israelischen Grenzübergang Kerem Shalom blockieren. In der Zwischenzeit haben Massen israelischer Siedler, die eine Umsiedlung des Gazastreifens fordern, den Grenzübergang Erez in der Nähe der Grenzmauer zu Gaza durchbrochen, um Siedlungen auf den Ruinen vertriebener Palästinenser zu errichten.
US-Präsident Joe Biden hat in einem Lippenbekenntnis zum Leben der Palästinenser gesagt, dass die Tötung von mehr als hundert Palästinensern in der Nähe von Hilfslastwagen die Waffenstillstandsgespräche erschweren wird. Aber die Wahrheit ist, dass die Biden-Regierung sich selbst die Schuld an diesen Gräueltaten gibt, da sie ihr Veto gegen drei UN-Resolutionen eingelegt hat, die einen Waffenstillstand in Gaza forderten, während sie US-Luftwaffenteams nach Israel entsandte, um bei dessen Kriegsverbrechen und Völkermord in Gaza zu helfen.
Die Vereinigten Staaten waren auch ein Partner bei der Verhungerung der Palästinenser in Gaza, was ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und einen Akt des Völkermords darstellt. Die Biden-Regierung stoppt weiterhin die Hilfe für die UNRWA, obwohl US-Beamte davor gewarnt haben, dass sich Gaza "in Mogadischu verwandelt". Die Vereinigten Staaten, die Israel hilflos gegenüberstehen, untersuchen nun die Möglichkeit, Lebensmittel aus US-Militärflugzeugen aus der Luft nach Gaza abzuwerfen – anstatt zu versuchen, den Angriff zu stoppen, der diese Luftabwürfe notwendig macht.
Das Massaker in der Rasheed Street unterstreicht Israels unverhohlene Verhöhnung der internationalen Justiz. Einen Monat zuvor hatte der Internationale Gerichtshof Israel angewiesen, seinen "plausiblen Völkermord" in Gaza zu beenden. Er kommt nur einen Tag, nachdem das Europäische Parlament zu einem dauerhaften Waffenstillstand in Gaza aufgerufen hat.
Ermutigt durch die Komplizenschaft der USA, agiert Israel weiterhin ungestraft in Gaza, was eine eklatante Verletzung internationaler Gesetze und Normen darstellt. Aber da Israel weiterhin die bedingungslose Unterstützung der Biden-Regierung genießt, ist es schwer einzusehen, warum es aufhören sollte, Palästinenser zu massakrieren.
Seraj Assi ist ein palästinensischer Schriftsteller, der in Washington, D.C. lebt. Mein Leben als Alien (Tartarus Press).
Foto: Palästinenser trauern nach einem Vorfall am frühen Morgen, als Einwohner am 29. Februar 2024 in Gaza-Stadt auf Hilfslastwagen zustürmten und von israelischen Schüssen getroffen wurden. (AFP via Getty Images)
Quelle:progressiv international v.29.03.2024

Israel angeklagt wegen Völkermord
Krieg im Nahen Osten
Urteil von UN-Gericht: Israel muss mehr Hilfe für Menschen in Gaza zulassen
Israel steht international unter Druck. Die Notlage im Gazastreifen verschärft sich. Hilfsorganisationen warnen vor einer Hungersnot. Nun schaltet sichdas höchste UN-Gericht ein. Im laufenden Völkermord-Verfahren gegen Israel hat der Internationale Gerichtshof das Land verpflichtet, schnell die Lieferung von deutlich mehr Hilfsgütern in den Gazastreifen zuzulassen. Eine Hungersnot müsse vermieden werden. Es müssten mehr Grenzübergänge für den Transport von Nahrungsmitteln sowie medizinischer Hilfe geöffnet werden, ordnete das höchste Gericht der Vereinten Nationen am Donnerstag in Den Haag an.
Das Gericht entsprach damit einem Antrag Südafrikas. Seine Entscheidungen sind bindend. Israel muss nun innerhalb eines Monats dem Gericht berichten, welche Maßnahmen es zur Umsetzung ergreift.
UN-Gericht: "Die katastrophalen Lebensbedingungen der Palästinenser haben sich verschlechtert"
Bereits Ende Januar hatte das Gericht Sofortmaßnahmen angeordnet und Israel aufgetragen, alles zu tun, um einen Völkermord im Gazastreifen zu verhindern. Angesichts der sich verschlimmernden Lage in dem Kriegsgebiet und einer drohenden Hungersnot hatte Südafrika zusätzliche Maßnahmen verlangt. Dem entsprach das Gericht nun.
Seit der Entscheidung vom 26. Januar hätten sich die "katastrophalen Lebensbedingungen der Palästinenser im Gazastreifen weiter verschlechtert", heißt es in der Entscheidung. Die Richter nennen dabei insbesondere die Hungerkrise. Es bestehe nicht mehr nur das Risiko einer Hungersnot, sondern diese habe bereits eingesetzt. Das Gericht zitiert auch einen UN-Bericht, nach dem schon mindestens 31 Menschen, darunter 27 Kinder, an Unterernährung und Austrocknung gestorben sind.
Israel müsse bei der Lieferung der Hilfsgüter eng mit den Vereinten Nationen zusammen arbeiten, heißt es weiter in der Gerichtsentscheidung. Zu den dringend benötigten Hilfsgütern zählen die Richter auch Wasser, Strom, Kleidung sowie Zelte.
Israel hatte die Vorhaltungen Südafrikas zurückgewiesen: Die Lieferungen humanitärer Hilfe würden nicht blockiert. Doch dieser Darstellung folgten die Richter nicht.
Das Gericht ermahnte Israel dafür zu sorgen, dass Soldaten die Rechte der Palästinenser nicht verletzen, die als Bevölkerungsgruppe unter dem Schutz der Völkermord-Konvention stünden. Dazu gehöre auch, die Lieferung dringend benötigter Hilfsgüter zu verhindern.
Auslöser des Gaza-Kriegs war das beispiellose Massaker mit mehr als 1200 Toten, das Terroristen der Hamas und anderer islamistischer Gruppen am 7. Oktober vergangenen Jahres in Israel verübt hatten.
Südafrika wirft Israel Verletzung der Völkermord-Konvention vor
Israel reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive. Angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer und der katastrophalen Lage im Gazastreifen steht Israel international immer stärker in der Kritik.
Südafrika hatte Israel vor dem Gericht verklagt und dem Land die Verletzung der Völkermord-Konvention vorgeworfen. Israel hatte die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. Das Hauptverfahren in dieser Sache hat noch nicht begonnen. Zunächst hatte Südafrika sogenannte Sofortmaßnahmen von dem Gericht verlangt. Und die wurden nun weiter verschärft. Wann das Hauptverfahren beginnen wird, ist unklar.
Das Gericht hat zwar selbst keine Möglichkeit, die Durchsetzung seiner Entscheidungen zu erzwingen. Doch bei einem Verstoß dagegen kann der internationale Druck auf Israel noch weiter zunehmen. (dpa/br)
Quelle: news.28.03.2024

Israel verstößt gegen das Völkerrecht
Israel und das Völkerrecht: Regierungssprecher widerspricht Regierungssprecher
Hält sich Israel bei seinem Vorgehen im Gazastreifen an das Völkerrecht oder muss es sein Vorgehen ändern? Aus der Bundesregierung kommen da widersprüchliche Signale. Der Sprecher des Bundeskanzlers Steffen Hebestreit wollte oder konnte in der Bundespressekonferenz auf eine Frage von Florian Warweg hin den Widerspruch nicht auflösen.
https://vk.com/video-134310637_456275620
UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, erklärte auf einer Sitzung vor dem UN-Menschenrechtsrat, dass seinem Büro "viele Vorfälle" vorliegen, "die auf Kriegsverbrechen durch israelische Streitkräfte" hindeuten sowie auf Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht.
Der Sprecher des Bundeskanzlers, Steffen Hebestreit, erklärte, man habe keine Zweifel daran, dass Israel sich an das Völkerrecht hält. Der Sprecher der Bundesaußenministerin, Sebastian Fischer, erklärte, man würde Israel auffordern, die Kriegsführung zu ändern.
Der deutsche Journalist Florian Warweg bat auf der Bundespressekonferenz um eine Auflösung des Widerspruchs: Israel hält sich an das Völkerrecht – soll aber sein militärisches Vorgehen ändern, um sich an das Völkerrecht zu halten?
RTd.28.03.2024

Israel verstößt gegen Menschenrechte
Israel blockiert 7.000 Lastwagen mit humanitärer Hilfe an der Einreise nach Gaza
UNRWA-Chef Philippe Lazzarini sagte, das letzte Mal, dass die Organisation in der Lage gewesen sei, einen humanitären Hilfskonvoi in den Norden des Gazastreifens zu bringen, sei vor zwei Monaten gewesen.
Die ägyptischen Behörden prangerten am Samstag an, dass die israelischen Besatzer den Zugang zum Gazastreifen durch den Grenzübergang Rafah mit 7.000 Lastwagen mit humanitärer Hilfe verhindern, während die Palästinenser nach mehr als fünf Monaten der Bombardierungen und der Blockade von Grundnahrungsmitteln durch das zionistische Gebilde Hunger und Epidemiegefahr leiden.
An diesem Tag besuchte der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, den bereits erwähnten Landübergang an der Grenze zwischen Gaza und Ägypten. Dort bestätigte der Gouverneur der ägyptischen Provinz Nordsinai, Mohamed Shosha, Guterres, dass 7.000 Lastwagen mit humanitärer Hilfe auf ägyptischer Seite darauf warten, dass Tel Aviv ihnen die Einreise in den Gazastreifen erlaubt.
Der Beamte sagte, dass die von den Besatzungsbehörden geforderten strengen Einschränkungen und umfangreichen Inspektionsverfahren den Fluss der Hilfsgüter verzögern.
"Auf der einen Seite der Tür blockierte sich eine lange Schlange von Hilfslastwagen, auf der anderen Seite der lange Schatten des Hungers. Das ist mehr als tragisch. Es ist eine moralische Schande", sagte Guterres und forderte Tel Aviv zu einem sofortigen Waffenstillstand.
Unterdessen hat der Leiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA), Philippe Lazzarini, angeprangert, dass Israel fast 170 Tage nach Beginn seiner Aggression gegen den Gazastreifen weiterhin die Einfuhr von Lebensmitteln in das palästinensische Gebiet verhindert.
"Heute haben die israelischen Behörden einem weiteren UNRWA-Konvoi die Einreise in den Norden des Gazastreifens verweigert, wo die Menschen am Rande einer Hungersnot stehen", sagte der Beamte. Er erinnerte daran, dass die UNRWA das letzte Mal vor zwei Monaten in der Lage war, einen Konvoi in dieses Gebiet des Gazastreifens zu bringen.
Er betonte, dass dies das zweite Mal in dieser Woche sei, dass die Besatzungsmacht, die verpflichtet ist, die Grundrechte der besetzten Bevölkerung zu garantieren, die Ankunft humanitärer Konvois in diesem Teil des Gazastreifens verhindert habe.
In diesem Zusammenhang forderte er die sofortige Reaktivierung der Lieferungen mit Nahrungsmitteln und Hilfsgütern. "Noch immer sterben Kinder vor unseren Augen an Unterernährung und Dehydrierung. Was unerträglich ist, kann nicht normalisiert werden", sagte er.
Seit Oktober letzten Jahres haben israelische Streitkräfte mehr als 32.000 Palästinenser getötet und mehr als 74.000 verwundet.
Quelle: teleSUR v.24.03.2024

Israel verstößt gegen Menschenrechte
Israelischer Angriff auf humanitären Konvoi tötet 19 Menschen in Gaza
Die Regierung von Gaza hat berichtet, dass mehr als 400 Gazaner bei israelischen Angriffen auf humanitäre Konvois, Hilfslager und Lebensmittelverteilungen getötet wurden.
Bei einem weiteren Angriff der israelischen Besatzungstruppen auf den Kuwait-Kreisverkehr in Gaza-Stadt wurden mindestens 19 Palästinenser, die auf humanitäre Hilfe warteten, getötet und etwa 23 verletzt, während die Belagerung des Shifa-Krankenhauses den sechsten Tag in Folge andauert.
Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza eröffneten Panzer der israelischen Armee das Feuer auf Menschen, die auf humanitäre Hilfe warteten, darunter Säcke mit Mehl, an einem Ort, der keine Bedrohung für die Besatzung darstellte.
Dieser Angriff ist ein weiterer Anschlag, der sich in jüngster Zeit auf dem Weg nach Gaza-Stadt ereignet hat, wo Dutzende von Menschen unter ähnlichen Umständen ihr Leben verloren haben. Ein solcher Fall war das "Mehlmassaker", bei dem hundert Gazaner während einer chaotischen Lebensmittelverteilung getötet wurden, bei der israelische Truppen das Feuer abfeuerten.
Die Regierung von Gaza hat berichtet, dass mehr als 400 Gazaner bei israelischen Angriffen auf humanitäre Konvois, Hilfslager und Lebensmittelverteilungen getötet wurden.
Der Generalkommissar des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA), Philippe Lazzarini, bedauerte, dass die israelischen Behörden zum zweiten Mal in dieser Woche einen Konvoi mit dringend benötigten Lebensmitteln daran gehindert hätten, nach Norden zu fahren, wo die Bevölkerung am Rande einer Hungersnot stehe. Das letzte Mal, dass sie in diesem Gebiet Lebensmittel ausliefern konnten, war vor zwei Monaten.
Im Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt geht die israelische Militäroperation den sechsten Tag in Folge weiter. Fünf Verwundete, die in diesem Zentrum behandelt wurden, starben aufgrund der Belagerung durch israelische Truppen, zusätzlich zu den 13 Intensivpatienten, die in den letzten Tagen aufgrund des Mangels an Elektrizität und medizinischer Behandlung gestorben sind.
Das Gesundheitsministerium berichtete auch, dass die israelischen Streitkräfte 240 Patienten und Angehörige sowie ein Dutzend Mitarbeiter des Gesundheitswesens festgenommen haben. Das israelische Militär erklärte, es habe mehr als 800 Verdächtige verhört, darunter mindestens 360 "Terroristen" mit mutmaßlichen Verbindungen zur Hamas oder zum Islamischen Dschihad, und 170 mutmaßliche Kämpfer getötet.
Das israelische Militär sagt, es führe die Operation durch, ohne Zivilisten, Patienten, medizinisches Personal oder medizinische Ausrüstung zu verletzen. Sie behaupten, die Kranken und Verletzten an einen sicheren Ort innerhalb des Krankenhauses evakuiert zu haben, um Schaden zu vermeiden, und den Zugang zu Medikamenten, Lebensmitteln und Wasser erleichtert zu haben.
UN-Generalsekretär António Guterres, der Ägypten besucht, bezeichnete die Hindernisse für die Einfuhr humanitärer Hilfe in den Gazastreifen als "moralische Schande". Nach Angaben der ägyptischen Behörden warten mehr als 7.000 Lastwagenladungen mit Hilfsgütern auf Anweisungen Israels, um in die palästinensische Enklave einzudringen.
Guterres sagte, die lange Schlange von Hilfslastwagen, die auf der einen Seite der Tür blockiert sind, und der Schatten des Hungers auf der anderen Seite seien mehr als eine Tragödie, sie stellten eine moralische Empörung dar.
In den letzten 24 Stunden wurden mindestens 72 Einwohner des Gazastreifens bei israelischen Angriffen im Gazastreifen getötet, womit die Gesamtzahl der Todesopfer seit Beginn des Krieges am 7. Oktober auf 32.142 gestiegen ist, so die jüngste Zählung des Gesundheitsministeriums.
Quelle: teleSUR v.24.03.2024

23.03.
2024
Kampf um Menschenrechte der indigenen Minderheiten in Kolumbien
Dissidenten ermorden indigene Führerin Carmelina Yule
Herausgegeben von Editora Bogotá / Menschenrechte
CI.- Die Vereinigung der indigenen Räte des Nordkaukasus bestätigte, dass die indigene Majora Carmelina Yule an den Verletzungen starb, die sie erlitten hatte, als die Mitglieder der Dissidenten des Zentralen Generalstabs wahllos auf die Bevölkerung schossen. Die Regierung Petro setzte den bilateralen und vorübergehenden Waffenstillstand in Cauca, Nariño und Valle del Cauca aus.
Der Kampf des Volkes der Naza
Die Gemeinschaft des Nasa-Volkes von Toribio und die Neehnwe'sx Ancestral Authorities des Nasa Project Life Plan haben angeprangert, dass die bewaffnete Gruppe Dagoberto Ramos am 16. März einen Minderjährigen, einen Schüler der Bildungseinrichtung El Sesteadero und ein Gemeindemitglied aus dem Dorf
La Palma entführt hat.
Die indigene Gemeinschaft mobilisierte sich, um das Gemeindemitglied zu retten, schaffte es, es zu befreien und das Fahrzeug, in dem die Dissidenten die Entführung durchführten, stillzulegen. Die Ureinwohner umzingelten das Auto und forderten die Mitglieder der EMC auf, sich für diesen Angriff auf die Gemeinschaft zu verantworten.
Die Reaktion der Dissidenten bestand darin, wahllos auf die indigene Gemeinschaft zu schießen. Major Kiwe Thëgnas Carmelina Yule Paví wurde schwer verletzt und starb am 17. März an ihren Verletzungen.
Bei dem Angriff wurde auch das Gemeindemitglied Rodrigo Ul Músicue verletzt. Nachdem sie die Gemeinde angegriffen hatten, flüchtete die paramilitärische Gruppe der Dissidenten Dagoberto Ramos in einem Pickup-Truck, der auf die indigene Gruppe schoss
In der Nacht zum 17. März prangerte der Verband der indigenen Räte von Nordkauca (ACIN) an, dass Dissidenten der Dagoberto-Ramos-Front der EMC die indigene Garde zwischen den Dörfern La Luz und Gallinaza erneut angegriffen hätten. Die Gruppe feuerte Gewehrgeschosse ab und warf Granaten auf die unbewaffnete Gemeinde, die das Territorium kontrolliert. ACIN bestätigte, dass bei dem jüngsten Angriff niemand aus der Gemeinde verletzt wurde.
Ein Angriffsplan der Dissidenten gegen die Nasa-Leute
In ähnlicher Weise prangerte die Vereinigung der indigenen Räte von Toribio, Tacueyo und San Francisco die Existenz eines Angriffs- und Vernichtungsplans gegen das Nasa-Volk von Toribio und ihre Ahnenbehörden an und machte Albeiro Mestizo, alias "Zapata", Florentino Boyocue, alias "Amazonas", und Alberto Rivera Pavi, neben anderen Mitgliedern des Zentralen Generalstabs (EMC) verantwortlich.
"Diese Aktion zeigt den Zerfall und die kriminellen Handlungen dieser bewaffneten Gruppe, die sich selbst als 'revolutionär' bezeichnet, aber bei der Entführung, dem Verschwindenlassen, der Ermordung und der Nötigung unserer Gemeinschaft bösartig ist, indem sie sich weigert, mit ihr zu sprechen, während sie sich gleichzeitig damit brüstet, Friedensgespräche mit der nationalen Regierung zu führen", sagte die indigene Organisation Proyecto Nasa.
Regierung setzt bilateralen und vorübergehenden Waffenstillstand mit EMC aus
Aufgrund des erneuten Angriffs des Zentralen Generalstabs auf die Gemeinden kündigte die Regierung die Aussetzung des bilateralen und vorübergehenden Waffenstillstands in den Departements Cauca, Nariño und Valle del Cauca an.
Vor der Ankündigung des Präsidenten verurteilten mehrere soziale Organisationen das Verbrechen der Dissidenten und forderten die Regierung auf, den Friedensprozess auszusetzen, den sie mit dieser Gruppe durchführt, die von mehreren Gemeinschaften als paramilitärische Gruppe angeprangert wird.
Präsident Petro seinerseits sagte auf seinem Account auf X: "Die EMK von Cauca hat an ihren verschiedenen Fronten von Anfang an kein Zeichen dafür gegeben, dass sie einen ernsthaften Friedensprozess will. Er glaubte fälschlicherweise, dass die Verhandlungen dazu dienten, sich militärisch zu stärken, und dass ihre Stärkung dadurch erfolgte, dass die Bevölkerung ihren Strukturen unterworfen und sich mit der illegalen Wirtschaft und mit großem illegalen Kapital finanziert wurde."
Ebenso sagte Petro, dass "die Regierung nicht zulassen kann, dass die EMC wie die ehemaligen spanischen Sklavenhalter denkt, dass es legitim ist, indigene und arme Menschen aus den Gebieten Kolumbiens zu töten". Der Präsident bat auch Minderjährige, die sich in den Reihen dieser Gruppe befinden, sich um den Ruhestand zu bemühen.
Sonstige von Dissidenten begangene Straftaten
Die Gemeinden haben bei mehreren Gelegenheiten angeprangert, dass die Dissidenten kontinuierlich gegen den mit der Regierung unterzeichneten bilateralen und vorübergehenden Waffenstillstand verstoßen haben.
Vom 13. bis 15. März fand in Cali die Minga des sozialen und gemeinschaftlichen Widerstands statt. Die indigenen Völker von Norte del Cauca prangerten die schwierige humanitäre Lage in ihren Gebieten an.
Während der Minga sagte der indigene Führer Nilson Sauca: "Bilaterale Beendigungen sind sehr wichtig, aber ein anderes ist das Verhalten, das heute in den Gemeinden, in den indigenen, bäuerlichen und Afro-Territorien stattfindet. Leider fallen Brüder und Schwestern, die für diese Prozesse von grundlegender Bedeutung sind, weiter."
Nur wenige Stunden nach dem Ende der Minga, als die indigenen Gemeinschaften des Nordkaukasus den jüngsten Angriff der Dissidenten verurteilten, die die indigenen Völker bei anderen Gelegenheiten angegriffen hatten.
Die Ermordung von Josué Castellanos durch Dissidenten in Arauca
Obwohl die Regierung das Verbrechen der Dissidenten verurteilte, setzte sie nur den bilateralen und vorübergehenden Waffenstillstand in den Departements Cauca, Nariño und Valle del Cauca aus. In anderen Regionen prangern die Gemeinden die EMK jedoch weiterhin an.
Am 5. März wurde der Sozial- und Gemeindeführer und Menschenrechtsverteidiger Josué Castellanos in der Gemeinde Tame, Arauca, von Dissidenten entführt und ermordet.
Nach der Ermordung des sozialen Führers prangerte die Politische Massenbewegung "Sozial und Volk des zentralen Ostens Kolumbiens" an, dass die Regierung, während sie einen Friedensprozess mit den Dissidenten vorantreibe, soziale Führer im Departamento Araukanien ermorde.
Obwohl es in mehreren Regionen wie Arauca zu Beschwerden gegen die EMC gekommen ist, sagte Präsident Petro auf seiner Seite X: "Ich muss anerkennen, dass verschiedene Fronten der EMC in anderen Teilen des Landes den Friedensprozess mehr respektiert haben, und ich bedauere, dass sie sich, wenn auch unbeabsichtigt, zurückgezogen haben..."
Bisher gibt es keine bekannte Stellungnahme der Dissidenten zu den Verbrechen gegen die indigene Bevölkerung oder zu anderen Handlungen, die von den Gemeinschaften angeprangert wurden. Ebenso wenig äußerten sie sich zur Aussetzung des bilateralen und vorübergehenden Waffenstillstands in Cauca, Nariño und Valle del Cauca durch die Regierung.
Majorin Carmelina Yule Paví
Die indigene Anführerin Carmelina Yule Paví war eine angesehene und bekannte Nasa-Mehrheit des Dorfes La Bodega im indigenen Reservat Toribio. Sie war auch eine Kiwe Thegna, eine Handwerkerin und diente als Kapitänin.
Carmelina Yule war 2019 die lokale Koordinatorin des Programms "Frauen des Territoriums von Toribio". In diesem Raum baute sie zusammen mit den indigenen Frauen von Nord-Cauca mehrere Entwürfe auf.
Laut Indepaz erhöht sich die Zahl der ermordeten Anführer von Yule auf 33 im Jahr 2024.
Quelle: https://www.colombiainforma.info/ Bilder: Josué Castellanos, ermordeter Bauernführer der Politischen Massen-, Sozial- und Volksbewegung Zentral-Ostkolumbiens; Iván Mordisco, Anführer der Dissidenten. Lizenziert unter Creative Commons
CI FC/17/03/2024/19:20

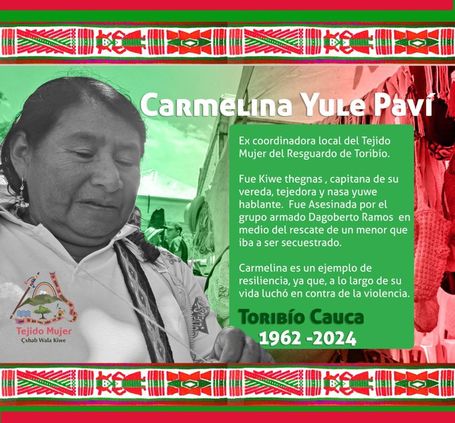

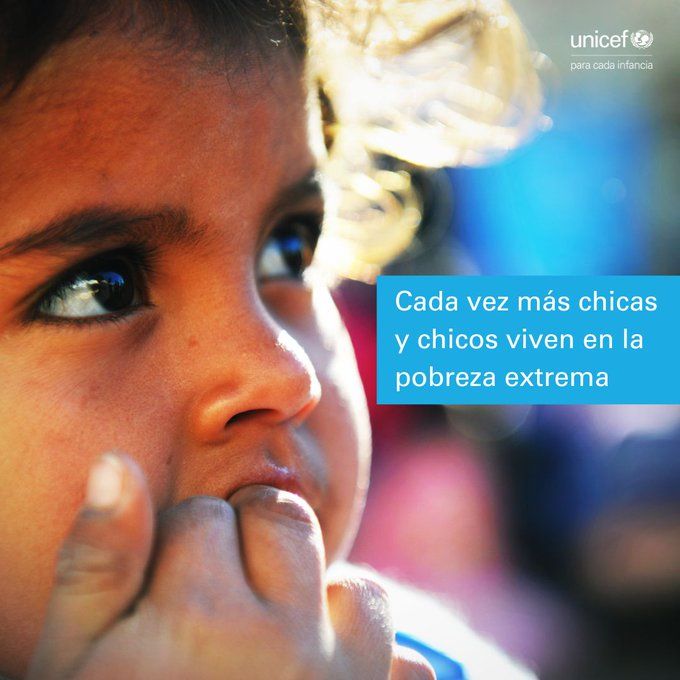
Argentinien verletzt Menschenrechte
Misshandlungen und Drohungen gegen Menschenrechtsaktivisten in Argentinien angeprangert
"Sie wurde gefesselt, geschlagen, sexuell missbraucht, unsere Schwester erhielt Morddrohungen", prangerte die Gruppe an.
Die argentinische Menschenrechtsorganisation H.I.J.O.S. verurteilte am Donnerstag die Misshandlungen und Drohungen gegen einen ihrer Aktivisten und beschuldigte die nationale Regierung, nachdem der Slogan "Lang lebe die verdammte Freiheit" des rechtsextremen Präsidenten Javier Milei an die Wand des Opfers geschrieben worden war.
"Wir verurteilen den politischen Angriff auf unsere militante Genossin von H.I.J.O.S., deren Identität wir bewahren, die von zwei Personen angegriffen wurde, die in ihrem Haus auf sie warteten, nachdem sie die Tür aufgebrochen und illegal eingedrungen war. Sie wurde gefesselt, geschlagen, sexuell missbraucht, unsere Schwester erlitt Morddrohungen von ihren Entführern", sagte die Behörde in einer Erklärung.
Das Nationale Netzwerk sagte, dass die Angreifer die Drohungen durch den Einsatz von Schusswaffen verursachten, während sie die Botschaft vermittelten, dass sie nicht in das Haus gingen, um zu stehlen. "Wir sind gekommen, um dich zu töten. Dafür werden wir bezahlt", sagten die Angreifer.
In diesem Sinne beschrieb die Gruppe den Angriff als "politischen Angriff", der gegen das Opfer wegen ihrer Militanz für Menschenrechte und Feministinnen gerichtet war, während sie präzisierten, dass nichts von Wert aus dem Haus gestohlen wurde, sondern nur Dokumente der Entität.
"Die Täter der Tat malten das Akronym "VLLC" an die Wand. (Lang lebe die verdammte Freiheit)", heißt es in der Mitteilung. Ebenso wies H.I.J.O.S darauf hin, dass die Ereignisse "einen klaren Zusammenhang mit den Aktionen und Hassreden haben, die die höchsten Autoritäten des Landes täglich äußern".
In diesem Zusammenhang hebt die Organisation hervor, dass die Exekutive "zu Gewalt gegen diejenigen von uns aufstachelt, die sich für die Menschenrechte einsetzen". Zugleich forderte er von der Justiz Aufklärung des Vorfalls.
Nachdem die Gruppe die nationale Regierung für die Ereignisse verantwortlich gemacht hatte, erinnerte sie daran, dass sie sich wenige Tage nach dem neuen Jahrestag des Staatsstreichs ereigneten.
Quelle: teleSUR v.21.03.2024
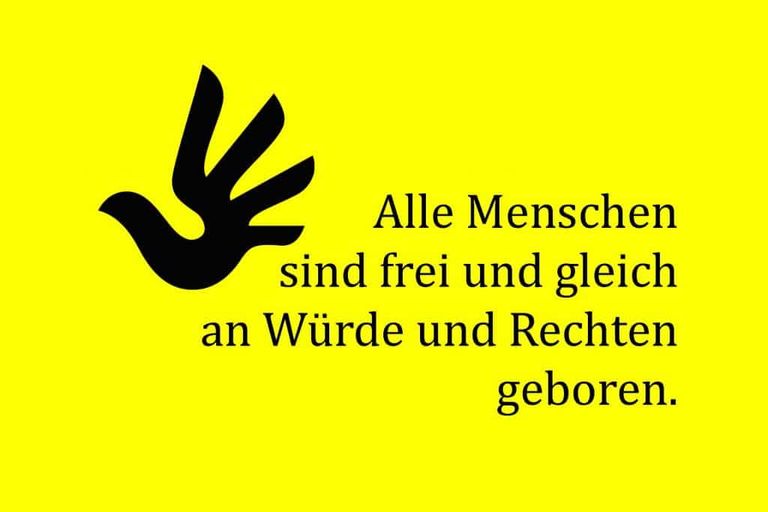
Menschenrechtsverletzungen durch Israel
Hochkommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte warnt vor Israels Militäraktion in Rafah
15 Mär. 2024 13:25 Uhr
Der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte Volker Türk befürchtet eine "Katastrophe" im Falle einer israelischen Militäroffensive in Rafah. Er sehe auch nicht, wohin man die Zivilbevölkerung evakuieren könne.
Quelle: AFP © Fabrice Coffrini
Der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte Volker Türk nach seinem Bericht über die Lage in den besetzten palästinensischen Gebieten während der 55. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates in Genf am 29. Februar 2024
Der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte Volker Türk warnt im Fall einer israelischen Militäroffensive in Rafah am Südende des Gazastreifens vor einer "Katastrophe".
In einem Interview mit dem österreichischen Fernsehsender ORF am Donnerstagabend forderte Türk am Donnerstag erneut einen "Waffenstillstand aus humanitären Gründen".
"Ich weiß gar nicht, welche Worte ich noch verwenden soll. Aber das wäre undenkbar", warnte er, als er auf einen möglichen israelischen Angriff auf Rafah angesprochen wurde.
Der UNO-Beamte wies in dem Gespräch darauf hin, dass in Rafah rund 1,5 Millionen Menschen auf engem Raum leben.
Laut Türk ist der Gazastreifen ohnehin eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt, weshalb er Zweifel an der israelischen Ankündigung habe, die Zivilbevölkerung vor einem militärischen Angriff in sichere Zonen bringen zu wollen oder zu können.
Weiter erklärte der 59-jährige österreichische Jurist, dass vor allem der Norden des Gazastreifens größtenteils bereits zerstört sei. Er wisse nicht, "wo die Menschen noch Schutz finden können", sagte Türk.
Er wies auch darauf hin, dass den Vereinten Nationen irgendwelche israelischen Pläne zu Evakuierungen nicht bekannt seien und fügte hinzu:
"Und es scheint mir fast unmöglich, so etwas durchzuführen."
Die humanitäre Situation im Gazastreifen sei "äußerst prekär".
Vor allem im Norden sei es "fast unmöglich, zu wirklicher humanitärer Hilfe zu gelangen", die Bevölkerung leide unter extremen Bedingungen, warnte Türk.
Was im Gazastreifen gebraucht werde, sei humanitäre Hilfe, "aber die kommt nicht in dem Ausmaß hinein, wie es notwendig ist", fügte der UNO-Hochkommissar hinzu.
Israel lasse Hilfslieferungen nicht im notwendigen Ausmaß zu. In den vergangenen Monaten sei es "zu einer extremen Verschlechterung" gekommen.
Der österreichische Jurist sprach sich in dem Gespräch mit ORF erneut für einen "Waffenstillstand“ aus humanitären Gründen" aus. Er hoffe, dass bei den aktuellen Verhandlungen darüber die "Vernunft durchbricht", resümierte Türk.
Quelle: RTD v.15.03.2024/Der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte Volker Türk nach seinem Bericht über die Lage in den besetzten palästinensischen Gebieten während der 55. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates in Genf am 29. Februar 2024

Ukraine verletzt die Menschenrechte
Bischof der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche berichtet dem UN-Menschenrechtsrat über Verfolgung
15 Mär. 2024 12:32 Uhr
Die Verfolgung der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche (UOK) und ihrer Gläubigen durch das aktuelle Regime in Kiew schreitet unermüdlich voran. Ein Hierarch der UOK durfte nun vor dem UN-Menschenrechtsrat darüber sprechen.
Von Alexej Danckwardt
Am 8. März 2024 hat der Metropolit der kanonischen Ukrainisch-Orthodoxen Kirche (UOK) Theodosius von Tscherkassy und Kanew vor dem UN-Menschenrechtsrat im Rahmen einer Podiumsdiskussion zum Thema "Bekämpfung von religiösem Hass" gesprochen und dabei über die Diskriminierung und Verfolgung seiner Glaubenskongregation in der heutigen Ukraine berichtet.
Der ukrainische Geistliche erklärte unter anderem, dass die derzeitigen ukrainischen Behörden auf verschiedenen Ebenen Gläubige der UOK dazu zwingen, zu der neuen religiösen Organisation überzutreten, die 2019 von Patriarch Bartholomäus in der Ukraine gegründet wurde. Dies geschieht unter anderem durch aggressive Medienkampagnen und öffentliche Erklärungen von Politikern, aber auch mit roher Gewalt gegen Gläubige. Die staatliche Propaganda beschuldigt die ukrainisch-orthodoxen Gläubigen und geistlichen Würdenträger fälschlich der Kollaboration mit Russland, wodurch religiöser Hass gegen die Konfession geschürt werde.
In diesem Zusammenhang rief Metropolit Theodosius die internationale Gemeinschaft dazu auf, so oft wie möglich Stellung zu nehmen und Situationen rechtlich zu bewerten, in denen die Rechte der Gläubigen der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche verletzt werden.
Auch wenn es durch andere Ereignisse in den letzten Monaten in den Hintergrund getreten ist, geht die Verfolgung der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche in der Ukraine weiter. Das Gesetz, mit dem ein vollständiges Verbot dieser traditionellen Mehrheitskonfession des Landes durchgesetzt werden soll, wird vom ukrainischen Parlament in zweiter Lesung in den Ausschüssen beraten und soll demnächst endgültig angenommen werden. Mehrere Hierarchen der Kirche unterliegen weiter der Strafverfolgung und befinden sich teilweise in Untersuchungshaft. Aus ihrem traditionellen Hauptsitz, dem Kiewer Höhlenkloster, ist die UOK ausgeschlossen und darf nur noch eine kleinere Kirche auf dem Gelände für Gottesdienste nutzen.
Ein besonders absurder Fall der Strafverfolgung von Geistlichen wurde Anfang März bekannt. Gegen Michail Benz, Rektor eines Männerklosters der UOK in Chust, und Wassilij Rossocha, Priester der St.-Nikolaus-Kirche in Peretschin (beide Orte im westukrainischen Transkarpatien), wurde ein Strafverfahren wegen der "Verbreitung kommunistischer Symbole" nach Art. 436-1 des Strafgesetzbuchs der Ukraine eingeleitet. Darauf stehen in der "demokratischen" Ukraine bis zu fünf Jahre mit Beschlagnahme von Vermögen. Ihr Verbrechen: Sie hatten in sozialen Netzwerken etwas über den Großen Vaterländischen Krieg gepostet.
In der Ukraine läuft es geradezu wörtlich nach Niemöller, einem christlichen Theologen:
"Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Gewerkschaftler holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschaftler.
Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Jude.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte."
Den Punkt mit den Juden hat das Regime in Kiew allerdings übersprungen, das käme bei seinen Sponsoren in Übersee nicht so gut an, wie die Verfolgung von Kommunisten, Gewerkschaftern und orthodoxen Christen.
Quelle:RTD.15.03.2024/Metropolit Theodosius während seines Auftritts vor dem UN-Menschenrechtsrat
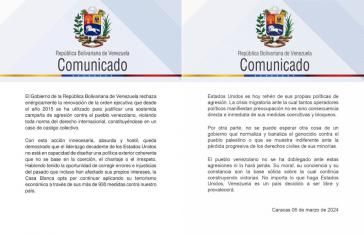
USA-Sanktionen verstoßen gegen Völkerrecht
07.03.2024 Venezuela / USA / Politik / Menschenrechte
"Wirtschaftsterrorismus": Venezuela weist Verlängerung der US-Sanktionen zurück
Von Vilma Guzmán
amerika21
venezuela_gegen_us-sanktionen_3-24.jpg
Kommuniqué der Regierung: "Eine anhaltende Kampagne der Aggression gegen das venezolanische Volk"
QUELLE:@YVANGIL
Caracas. Die Regierung von Venezuela hat die Erneuerung der seit neun Jahre geltenden US-Exekutivanordnung "energisch" abgelehnt. In einem Kommuniqué von Außenminister Iván Gil dazu heißt es, die Anordnung werde seit 2015 benutzt, "um eine ständige Aggressionskampagne" gegen die venezolanische Bevölkerung zu rechtfertigen, "die gegen jede Regel des Völkerrechts verstößt und einen Fall von kollektiver Bestrafung darstellt".
US-Präsident Joe Biden hatte am Dienstag den Kongress informiert, dass er die Executive Order 13.692 "über den 8. März 2024 hinaus" verlängert.
"Die Situation in Venezuela stellt weiterhin eine ungewöhnliche und außergewöhnliche Bedrohung für die nationale Sicherheit und die Außenpolitik der USA dar. Aus diesem Grund habe ich entschieden, dass es notwendig ist, den in der Executive Order 13.692 erklärten nationalen Notstand in Bezug auf die Situation in Venezuela fortzusetzen", heißt es in seinem Schreiben.
Dieses von Präsident Barack Obama erstmals verfügte und seitdem jährlich verlängerte Dekret hat Washington als Argument gedient, um eine ganze Reihe von einseitigen Zwangsmaßnahmen gegen Venezuela anzuwenden, die dem Land nach offiziellen Schätzungen in den letzten zehn Jahren 232 Milliarden US-Dollar entzogen haben.
"Das Weiße Haus, das die Möglichkeit hatte, die Fehler und Ungerechtigkeiten der Vergangenheit zu korrigieren, die sogar seine eigenen Interessen beeinträchtigt haben, zieht es vor, seinen Wirtschaftsterrorismus mit mehr als 930 Maßnahmen gegen unser Land fortzusetzen", so die Regierung von Venezuela. Die einseitigen Sanktionen seien Teil einer "unnötigen, absurden und feindseligen" Strategie, die nur beweise, dass "die dekadente Führung der USA nicht in der Lage ist, eine kohärente Außenpolitik zu entwerfen, die nicht auf Zwang, Erpressung oder Respektlosigkeit beruht".
"Von einer Regierung, die den Völkermord am palästinensischen Volk billigt und verharmlost oder dem fortschreitenden Verlust der Bürgerrechte ihrer Minderheiten gleichgültig gegenübersteht, kann nichts anderes erwartet werden". Die venezolanische Bevölkerung habe sich "diesen Aggressionen nicht gebeugt" und "wird sich niemals beugen. Ganz gleich, was die USA tun, Venezuela ist ein Land, das entschlossen ist, frei zu sein, und das sich behaupten wird", heißt es in dem Kommuniqué abschließend.
Die Entscheidung Bidens stieß auch bei oppositionellen Kräften auf Kritik. So wandte sich der Kandidat der Partei Acción Democrática für die mittlerweile für den 28. Juli terminierten Präsidentschaftswahlen via X an den US-Präsidenten:
"Die Sanktionen, die die US-Regierung gegen das venezolanische Volk verhängt, tragen nur dazu bei, das Narrativ der Maduro-Regierung zu verstärken und ihre Position zu stärken. Sie wissen, dass die Sanktionen gescheitert sind und schwere wirtschaftliche und soziale Schäden in Venezuela verursachen. Wir haben bereits einen Wahltermin. Lassen Sie zu, dass wir Venezolaner Maduro auf friedliche Weise durch Wahlen von der Macht entfernen, wir können es und wir werden es tun", schrieb Luis Eduardo Martínez.
@Luisemartinezh Kommuniqué der Regierung: "Eine anhaltende Kampagne der Aggression gegen das venezolanische Volk"
QUELLE:@YVANGIL

Info über IGH
IGH: Südafrika fordert ein weiteres Mal schärfere Maßnahmen gegen Israel
7 Mär. 2024 21:53 Uhr
Südafrika, das Ende vergangenen Jahres vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag Klage gegen Israel wegen Genozids erhoben hatte, fordert angesichts der Hungerkatastrophe im Gazastreifen erneut, die Anordnung des Gerichts an Israel um eine Forderung nach Waffenruhe und Aufhebung der Blockade zu ergänzen.
Quelle: www.globallookpress.com © Wang Xiangjiang
Die Regierung Südafrikas hat bei ihrer Klage gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof noch einmal nachgefasst. Das ist der zweite Versuch, den IGH angesichts der von Israel betriebenen humanitären Katastrophe im Gazastreifen zu deutlicheren Maßnahmen zu veranlassen. Am 26. Januar hatte der IGH die Notwendigkeit provisorischer Maßnahmen bestätigt, die als Teil der südafrikanischen Klage gefordert worden waren, hatte es aber lediglich bei der Anordnung an Israel belassen, das Völkerrecht einzuhalten, und keine konkreteren Anordnungen – wie etwa die zu einem sofortigen Waffenstillstand – erlassen.
Bereits am 12. Februar hatte Südafrika erstmals versucht, zusätzliche provisorische Maßnahmen des IGH zu erwirken. Schwerpunkt in diesem Schreiben war der drohende israelische Angriff auf Rafah, der das Leben von 1,4 Millionen dorthin Geflüchteter bedrohen würde. Ergebnis dieses Schreibens war ein Beschluss des Gerichts, der zwar vermerkte, "dass die jüngsten Entwicklungen im Gazastreifen und insbesondere in Rafah 'das, was bereits ein humanitärer Alptraum mit regionalen Konsequenzen ist, exponentiell verschlimmern würde', wie das der Generalsekretär der Vereinten Nationen erklärte". Dennoch wurde Israel nur ein weiteres Mal dazu aufgefordert, die Anordnung vom 26. Januar umzusetzen.
Das neue Schreiben Südafrikas befasst sich vor allem mit der im Gazastreifen mittlerweile herrschenden Hungersnot:
"Den Palästinensern droht nicht länger 'die unmittelbare Gefahr des Hungertods'. Mindestens 15 palästinensische Kinder – darunter Säuglinge – sind in Gaza allein in der vergangenen Woche bereits Hungers gestorben, und die tatsächlichen Zahlen dürften weit höher sein. Diese Todesfälle sind 'menschengemacht, vorhersehbar und absolut vermeidbar'. Vorhersagen lauten, dass sie ohne eine Einstellung der militärischen Handlungen und eine Aufhebung der Blockade nicht linear, sondern exponentiell steigen werden."
Die sichtbare und völlige Missachtung der Anweisungen des Gerichts durch Israel mache eine Ergänzung der provisorischen Maßnahmen erforderlich. Kernpunkte der südafrikanischen Forderungen an Israel sind eine sofortige Einstellung der militärischen Handlungen im Gazastreifen, eine Aufhebung der Blockade, die Rücknahme aller anderen Maßnahmen, die direkt oder indirekt den Zugang der Palästinenser im Gazastreifen zu humanitärer Hilfe und grundlegenden Diensten behindern, und die Sicherstellung von genug und angemessener Nahrung, Wasser, Treibstoff, Unterkunft, Kleidung sowie die Befriedigung der hygienischen und medizinischen Bedürfnisse.
Israel habe nicht nur die Anweisungen des Gerichts ignoriert, es habe auch mehrfach seiner Verachtung für dieses Gericht Ausdruck verliehen. Die unmittelbare Bedrohung, der sich die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen gegenübersehe und die der Hochkommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte mit den Worten beschrieb "Es scheint keine Grenzen – keine Worte, sie zu fassen – zu geben in dem Schrecken, der sich vor unseren Augen in Gaza entfaltet", mache es nötig, die provisorischen Maßnahmen zu ergänzen.
"Südafrika fürchtet, dass dieser Antrag die letzte Gelegenheit darstellt, die dieses Gericht haben könnte, um die Palästinenser in Gaza, die bereits Hungers sterben und jetzt 'einen Schritt' vom Hungertod entfernt sind, zu retten … Südafrika fordert das Gericht respektvoll auf, wieder jetzt zu handeln – ehe es zu spät ist – um alles zu tun, was in seiner Macht steht, um die Palästinenser in Gaza vor einem genozidalen Hungertod zu retten."
Da der Antrag Südafrikas auf Grund der Eilbedürftigkeit die Bitte mit einschloss, über ihn ohne weitere Anhörung zu entscheiden, dürfte eine Entscheidung in Den Haag in den nächsten Tagen ergehen.
Quelle RT v.07.03.2024/ Der Internationale Gerichtshof (IGH) der UNO in Den Haag
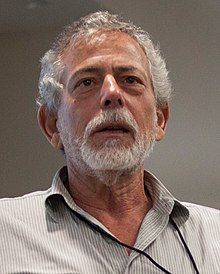
Verstoß gegen Menschenrechte
Menschenrechtsverband verurteilt Anzeige gegen IDL
(Lima, 28. Februar 2024, servindi).- In Peru hat die rechtskonservative Partei Fuerza Popular (FP) Strafanzeige gegen die Menschenrechtsorganisation Instituto de Defensa Legal (IDL) und den Investigativjournalisten Gustavo Gorriti gestellt. Nach Ansicht der Nationalen Menschenrechtskoordination (CNDDHH) entbehrt diese Anzeige jedoch jeder Grundlage. Sie sei die Rache für die erfolgreiche Verurteilung von Exdiktator Alberto Fujimori und den bevorstehenden Prozess gegen dessen Tochter Keiko Fujimori. Das Aufdecken von Korruption im Journalismus „ist kein Verbrechen“, so die CNDDHH.
Die Klage gegen das IDL ziele darauf ab, „eine Menschenrechtsorganisation zu kriminalisieren, die seit 40 Jahren Wahrheit und Gerechtigkeit in Peru für alle Peruanerinnen und Peruaner sucht“, erklärt die CNDDHH.
Das IDL hat zusammen mit anderen Mitgliedsorganisationen der CNDDHH die Opfer und Angehörigen der Massaker von La Cantuta und Barrios Altos (vom Militär begangene Tötungen während des internen bewaffneten Konfliktes unter der Regierung Fujimori) vertreten und erreicht, dass der Diktator Fujimori zu 25 Jahren Haft verurteilt wurde. Am 6. Dezember wurde er jedoch freigelassen, angeblich aus humanitären Gründen.
Die CNDDHH solidarisiert sich mit dem IDL angesichts dieses Angriffs durch die Fuerza Popular und fordert die Staatsanwaltschaft auf, „diese infame Anzeige“ fallen zu lassen.
Quelle: Nachrichtenpool Lateinamerika März 2024/ Der Investigativjournalist Gustavo Gorriti, Gründer von IDL-Reporteros, ist Ziel von Angriffen der politischen Rechten und Mafiagruppen. Foto: Knight Centre for Journalism in the Americas/Wikipedia (CC BY-SA 4.0 Deed)

Anklage wegen Völkermord
Gustavo Petro wirft Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und den Vereinigten Staaten vor, den „Völkermord“ in Gaza zu unterstützen
Gustavo Petro wirft Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und den Vereinigten Staaten vor, den „Völkermord“ in Gaza zu unterstützen.
Während eines Kolloquiums auf dem VIII. Celac- Gipfel versicherte der Präsident Kolumbiens , Gustavo Petro , dass die Ereignisse in Palästina widerspiegeln, dass die Welt „sich nicht länger auf zivilisierten internationalen Beziehungen oder auf dem auf dem Zweiten Weltkrieg aufgebauten Völkerrecht stützen kann“.
Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro beschuldigte am Freitag auf dem Celac-Gipfel die USA , die Europäische Union (EU) und das Vereinigte Königreich , Israel dabei zu unterstützen , Bomben gegen das Volk in Palästina abzuwerfen , dessen Sache ein vehementer Verteidiger ist.
Petro versicherte, dass „es nicht die alte Dynamik des palästinensisch-israelischen Konflikts ist“, die derzeit erlebt wird, sondern dass es Mächte gibt, die versuchen, „das zu bewahren, was existiert (...), was uns als Menschheit tötet“ und dass Es sei „zutiefst gewalttätig“.
„Deshalb unterstützt Deutschland den Völkermord, und Frankreich und die Europäische Union sowie das Vereinigte Königreich und insbesondere die Vereinigten Staaten von Amerika in ihrer demokratischen Version unterstützen den Abwurf von Bomben auf Menschen“, äußerte er sich beim América-Kolloquium. Lateinamerika und die Karibik als Friedenszone, des VIII. Gipfels der Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Karibischer Staaten ( Celac ), der in Kingstown, der Hauptstadt von St. Vincent und den Grenadinen, stattfindet.
Der Präsident betonte, dass „ein Völkermord“ vor aller Augen stattfindet, und forderte eine Dekarbonisierung, da er der Ansicht sei, dass die derzeitige Wirtschaft zum Krieg in Gaza geführt habe.
Gustavo Petro , ein scharfer Kritiker Israels, gab am Donnerstag bekannt, dass Kolumbien als Reaktion auf den Angriff bei der Verteilung von Nahrungsmitteln und humanitärer Hilfe in Gaza- Stadt , bei dem mehr als zwei Menschen starben, „alle Waffenkäufe aus diesem Land einstellt“. Gestern wurden hundert Menschen und weitere 700 verletzt.
Schlachten
Nach neuesten Daten des Gesundheitsministeriums des Gazastreifens starben mindestens 112 Bewohner des Gazastreifens und weitere 760 wurden in der Al-Rashid-Straße im Südosten von Gaza-Stadt verletzt , während sie auf die Ankunft humanitärer Hilfe in einem Konvoi von 32 Lastwagen warteten .Streifen.
Die israelische Armee bestritt diese Behauptung jedoch und behauptet, dass die meisten Todesopfer durch eine „Lawine“ verursacht wurden, die von einer hungrigen Menge verursacht wurde, die die Lastwagen mit Hilfsgütern plünderte und umzingelte, was sie zum Rückzug veranlasste.
In diesem Sinne versicherte Gustavo Petro , dass die Ereignisse in Palästina widerspiegeln, dass die Welt „nicht länger auf zivilisierten internationalen Beziehungen oder auf dem Völkerrecht aufbauen kann, das auf dem Zweiten Weltkrieg, auf den Trümmern der Nazis aufbaut“.
Quelle: von RPP Editorial /Bild Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro ist ein scharfer Kritiker der israelischen Invasion in Palästina. | Quelle: AFP

Deutschland wird angeklagt wegen Beihilfe zum Völkermörd
Nicaragua verklagt Deutschland wegen Beihilfe zu Völkermord vor dem IGH
2 Mär. 2024 12:11 Uhr
Deutschland positioniert sich an der Seite Israels. Dies hat nun Konsequenzen. Nicaragua verklagt Deutschland vor dem IGH wegen Beihilfe zum Völkermord. Israel wird vorgeworfen, Genozid an den Palästinensern zu begehen. Deutschland unterstützt Israel finanziell und mit Waffen.
Quelle: www.globallookpress.com © Bernd von Jutrczenka
Reif für Den Haag? Nicaragua verklagt Deutschland wegen Beihilfe zum Völkermord.
Nicaragua hatte bereits angekündigt, Deutschland wegen Beihilfe zum Völkermord vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) verklagen zu wollen. Nun hat das Land diesen Schritt vollzogen. In einer Pressemitteilung informiert der IGH über den Eingang der Klageschrift. Nicaragua wirft Deutschland den Verstoß gegen seine Verpflichtung zur Verhütung und Bestrafung von Völkermord vor.
Hintergrund ist die Klage Südafrikas gegen Israel wegen des Genozids an den Palästinensern, die ebenfalls vor dem IGH behandelt wird. Mit einer Eilentscheidung hat der IGH deutlich gemacht, dass er die Klage Südafrikas als berechtigt ansieht. Das Hauptverfahren steht allerdings noch aus. Deutschland positioniert sich dessen ungeachtet an der Seite Israels – aus Gründen der Staatsräson, wie es offiziell heißt.
Einer Pressemitteilung des Bundeskanzleramts zufolge habe Olaf Scholz (SPD) am 18. Oktober 2023 erklärt:
"Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson – es ist die Maxime, nach der die Bundesregierung handelt. … Es sei in der aktuellen Situation völlig klar, dass Israel das völkerrechtlich verbriefte Recht – und auch die Pflicht – habe, sich gegen diesen Terror zu wehren."
Deutschland sieht sich vor der Erfahrung des Holocausts in einer moralischen Verantwortung gegenüber Israel und legt diese Verantwortung als Pflicht zur bedingungslosen Unterstützung aus. Das umfasst allem Anschein nach auch die Unterstützung Israels beim Völkermord. Deutschland liefert Waffen und Waffensysteme, mit denen Israel nach allgemeiner Auffassung gezielt und mit äußerster Brutalität gegen Zivilisten und die zivile Infrastruktur in Gaza vorgeht.
In einer Pressekonferenz Ende Oktober äußerte der Bundeskanzler, er habe "keine Zweifel", dass sich Israel an das Völkerrecht halte. Das wirkte bereits damals angesichts der enormen Zerstörungen in Gaza und der hohen Zahl ziviler Opfer zynisch.
Die Haltung Deutschlands stößt international auf Kritik. Das deutsche Narrativ, Israel sei ausschließlich Opfer, verfängt im Ausland nicht. Die begrenzte Reichweite der deutschen Auffassungen zu Ereignissen von geopolitischer Bedeutung wird in Deutschland regelmäßig übersehen.
In der Klage vor dem IGH argumentiert Nicaragua, dass Deutschland durch die Bereitstellung politischer, finanzieller und militärischer Unterstützung für Israel und die Streichung der Finanzierung des Hilfswerks der Vereinten Nationen für das Palästinensische Flüchtlingshilfswerk im Nahen Osten (UNRWA) den Genozid Israels an den Palästinensern aktiv unterstützt.
"Deutschland erleichtert die Verübung eines Völkermords und ist seiner Verpflichtung eindeutig nicht nachgekommen, alles zu tun, um einen Völkermord zu verhindern", heißt es in der Klage.
Ursprünglich hatte Nicaragua angekündigt, auch die Niederlande wegen Beihilfe zum Genozid zu verklagen. Allerdings hat ein niederländisches Gericht angesichts der anhängigen Klage Südafrikas gegen Israel die Auslieferung weiterer Kampfjets an Israel untersagt.
Mit der Klage Nicaraguas ist klar, dass im Fall einer Entscheidung des IGH im Hauptverfahren zugunsten Südafrikas der aktuellen Bundesregierung juristische Konsequenzen drohen. Es wäre das erste Mal, dass sich Mitglieder einer deutschen Regierung in Den Haag wegen der Unterstützung von Völkermord rechtfertigen müssten und mit einer Bestrafung zu rechnen hätten.
Quelle: RTD 02.03.2024/Bild Reif für Den Haag? Nicaragua verklagt Deutschland wegen Beihilfe zum Völkermord.

Deutsche Politik unterstützt Völkermord in Palästina !?
Aus: Ausgabe vom 17.02.2024, Seite 8 / Ansichten
Vernebelungstaktik
Berlin und der Völkermord in Nahost. Gastkommentar
Von Patrik Köbele
Patrik Köbele ist Vorsitzender der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP)
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) klagt Israel an, dass seit November nur 40 Prozent der von der WHO angeforderten Hilfslieferungen in den nördlichen Gazastreifen erfolgt seien; diese Zahl sei seit Januar weiter gesunken. Gleichzeitig seien nur 45 Prozent der angeforderten UN-Einsätze im südlichen Gazastreifen möglich gewesen; alle anderen seien verweigert, behindert oder verschoben worden. In Rafah werden mindestens 1,3 Millionen Menschen aus der Luft bombardiert, sie müssen ständig mit der Bodenoffensive Israels rechnen. Mindestens eine Million dieser Menschen sind von der israelischen Armee aus dem Norden des Gazastreifens vertrieben worden, der ist weitgehend zerstört. Jetzt sollen sie wieder vertrieben werden, in Zeltstädte, die angeblich im Norden errichtet werden sollen.
Immer noch auf dem Tisch liegt allerdings auch das Memorandum eines israelischen Ministeriums, das die »Umsiedlung« der gesamten Bevölkerung des Gazastreifens (2,3 Millionen Menschen) in den Norden der ägyptischen Sinaihalbinsel fordert. Ein Narr, wer bei diesen Vertreibungsplänen übersieht, dass die palästinensischen Menschen sowohl bei den Plänen, mit dem Ben-Gurion-Kanal eine Alternative zum Suezkanal zu schaffen, als auch bei der profitablen Ausbeutung der Gasfelder im Meer vor Gaza stören.
Und Frau Baerbock? Vermutlich stolz, dass Deutschland der zweitgrößte Waffenlieferant Israels ist, wird sie zitiert mit der Erkenntnis, dass die Menschen in Rafah sich ja nicht in Luft auflösen könnten und Israel sichere Korridore schaffen solle. Sie weiß natürlich genau, dass es sichere Korridore nicht geben kann und alle Wege nur dorthin führen, wo schon alles durch die israelische Armee zerstört wurde. Dieser Staat, dessen Bürger ich bin, war Israel schon zur Seite gesprungen, als es von Südafrika, völlig zu Recht des Völkermords angeklagt wurde. Dieser Staat, seine Regierung und seine Außenministerin versuchen mit allen Mitteln, gemeinsam mit der NATO den Verlust der weltweiten Hegemonie des Imperialismus zu verhindern – da ist die Zerstörung der Lebensgrundlagen von 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen lediglich ein Kollateralschaden. Aber dafür braucht es Ruhe im Land – darum muss Solidarität mit dem palästinensischen Volk als antisemitisch diffamiert werden, darum muss jeglicher Widerstand und Friedenskampf als »rechtsoffen« denunziert werden.
Zu dieser Vernebelungstaktik gehört auch ein scheinbar antifaschistisches Bündnis der Kriegstreiberparteien CDU, FDP, Grüne und SPD gegen die von ihnen hochgepäppelte Kriegstreiberpartei AfD. Hier muss klargemacht werden: Die Losung »Nie wieder Krieg – nie wieder Faschismus« ist unteilbar. Hier müssen Klarheiten ausgesprochen werden. Dazu gehört auch: Frau Baerbock ist eine Kriegstreiberin und eine Kumpanin des Völkermords.
Quelle: junge Welt v.17.2.2024/ Joshua Regitz/jW Protest gegen den Besuch des israelischen Präsidenten Isaac Herzog in Berlin (16.2.2024)
Bild_ GeFiS-Archiv

Völkermord in Palästina
Aus: Ausgabe vom 15.02.2024, Seite 8 / Abgeschrieben
Lemkin-Institut für Völkermordprävention warnt vor Angriff auf Rafah
Das Lemkin-Institut für Völkermordprävention in den USA veröffentlichte am Dienstag seinen fünften SOS-Alarm bezüglich der Situation in Gaza
Das Lemkin-Institut ist entsetzt über die Entscheidung der israelischen Regierung, eine Militäroperation gegen die Stadt Rafah, die südlichste Stadt des Gazastreifens, durchzuführen. Rafah ist derzeit ein Zufluchtsort für mehr als 1,3 Millionen Palästinenser, die bereits von der vorrückenden israelischen Armee vertrieben wurden. (…)
Wie das Lemkin-Institut in seiner Erklärung vom 29. Dezember 2023 zum Thema »Warum wir den israelischen Angriff auf Gaza als Völkermord bezeichnen« feststellte, »ist bei der Betrachtung der [völkermörderischen] Auswirkungen der israelischen Vergeltungsmaßnahmen die Abfolge der Ereignisse bemerkenswert: zuerst [die Anordnung zur] Evakuierung des nördlichen Gazastreifens, gefolgt von der Bombardierung der Infrastruktur, Krankenhäuser, Schulen usw. in dieser Region. Anschließend entsteht ein ähnliches Muster im zentralen Gazastreifen, wodurch die Palästinenser schließlich in immer kleinere Teile des südlichen Gazastreifens gedrängt werden, wo sie ebenfalls weiterhin bombardiert werden. Es ist offensichtlich, dass [Israels völkermörderische] Rhetorik in die Tat umgesetzt wurde und immer größere Gebiete im Gazastreifen für die palästinensische Zivilbevölkerung praktisch unbewohnbar gemacht werden. Nach Angaben israelischer Zeitungen erklärte Ministerpräsident Netanjahu auf einem Treffen der Likud-Partei am 26. Dezember seinen Anhängern, er suche nach Ländern, die Palästinenser aus dem Gazastreifen »aufnehmen« könnten, was darauf hindeutet, dass er die Vertreibung der gesamten Bevölkerung erzwingen will. (…)
Rafah, »die letzte Zuflucht für vertriebene Palästinenser«, liegt an der Grenze zu Ägypten und wurde früher als sichere Zone für Palästinenser ausgewiesen, die aus dem Norden, dem Zentrum und kürzlich aus der Stadt Khan Junis im Süden flohen. Die Palästinenser haben keine sicheren Orte mehr und sitzen zwischen der vorrückenden israelischen Armee und der stark militarisierten ägyptischen Grenze fest. (…)
Zusammen mit der kürzlichen Aussetzung der Finanzierung des UNRWA und dem möglichen Ende seiner Aktivitäten im Gazastreifen haben die Angriffe in Rafah die ohnehin schon schreckliche humanitäre Lage in dem Gebiet noch verschlimmert und die Bewohner, die um ihre ungewisse Zukunft bangen, in akute Angst versetzt. (…) Wir rufen die Regierungen, die Israel unterstützen, namentlich die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Deutschland und andere westliche Nationen, auf, ihre Unterstützung zu nutzen und Israel zu drängen, den Angriff auf Rafah einzustellen. In diesem Sinne fordert das Lemkin-Institut auch den UN-Sicherheitsrat auf, dringend einzugreifen und einen sofortigen Waffenstillstand durchzusetzen, um ein weiteres Massaker und die Zwangsvertreibung von Palästinensern zu verhindern. Das Leben und Wohlergehen der Palästinenser muss um jeden Preis geschützt werden. Der Völkermord muss gestoppt werden, und humanitäre Hilfe muss in den Gazastreifen zugelassen werden. Nur eine politische Lösung wird langfristig Frieden und Stabilität in der Region bringen.(…)
Übersetzung aus dem Englischen: jW
Quelle: junge Welt v.15.02.2024/ Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS Kinder in einem durch einen Luftangriff zerstörten Haus in Rafah im südlichen Gazastreifen (12.2.24)

Israel verletzt die Menschenrechte
UNO nennt möglichen israelischen Einmarsch in Rafah erschreckend
Der UN-Menschenrechtskommissar warnte, dass der militärische Einmarsch in die Grenzstadt das Ende der humanitären Hilfe bedeuten könnte.
UN-Menschenrechtskommissar Volker Turk bezeichnete am Montag die bevorstehende israelische Militäroperation gegen die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen, in der mehr als 1,5 Millionen vertriebene Palästinenser leben, als erschreckend.
Der hochrangige UN-Beamte sagte in einer Erklärung, dass jeder mögliche groß angelegte militärische Einmarsch Israels in die palästinensische Stadt an der Grenze zu Ägypten erschreckend sei.
Volker Turk fügte hinzu, dass die mögliche israelische Invasion von Rafah zu einer großen Zahl von zivilen Opfern führen könnte, vor allem Kindern und Frauen.
Turk warnte davor, dass der militärische Einmarsch in die Grenzstadt das Ende der humanitären Hilfe in das palästinensische Gebiet des Gazastreifens bedeuten und weitere Verbrechen bedrohen könnte.
Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens berichtete am Montag, dass seit dem 7. Oktober 28.340 Palästinenser durch israelische Angriffe auf palästinensisches Gebiet getötet wurden.
Nach Angaben der Gesundheitsbehörde wurden 67.984 Verletzte gemeldet, während es in den letzten 24 Stunden 164 Todesopfer und 200 Verletzte durch die intensiven Angriffe gab.
Quelle: teleSUr v.13.02.2024/Der UN-Menschenrechtskommissar fügte hinzu, dass die mögliche israelische Invasion von Rafah zu einer großen Zahl ziviler Opfer führen könnte. | Foto: EFE

Fortsetzung des Völkermordes!!!
IFRC-Präsidentin: "Die größte humanitäre Krise, die ich je erlebt habe"
10 Feb. 2024 20:24 Uhr
Das Krankenhaus von Chan Yunis im Süden des Gazastreifens wird seit mehreren Wochen belagert. Der Rote Halbmond hat wiederholt um Versorgung und Schutz gebeten. Es fehlt an allem, von Nahrungsmitteln über medizinische Versorgung bis hin zu Treibstoff.
Die Präsidentin der Internationalen Föderation des Roten Kreuzes, Kate Forbes, bezeichnete die Lage im Gazastreifen als schlimmste humanitäre Krise und forderte mehr Hilfe für die Region. "In den 43 Jahren, in denen ich im humanitären Bereich tätig bin, ist dies die größte humanitäre Krise, die ich je erlebt habe", sagte sie.
Israel setzt seine Militäroperationen im Gazastreifen fort. Premierminister Benjamin Netanjahu forderte die Evakuierung der Bewohner der Stadt Rafah. Der Sprecher des UN-Generalsekretärs, Stéphane Dujarric, zeigte sich besorgt über Netanjahus Pläne: "Wir wollen keine erzwungene Massenvertreibung".
Quelle: RTD

Israel verstößt gegen die Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 06.02.2024, Seite 7 / Ausland
PALÄSTINA
Gesetzloses Töten in der Westbank
Amnesty-Bericht dokumentiert außergerichtliche Hinrichtungen durch Israels Armee
Von Gerrit Hoekman
Während sich die mediale Aufmerksamkeit auf den Gazastreifen konzentriert, bleibt die Situation im Westjordanland häufig unter dem Radar. In einem am Montag veröffentlichten Bericht wirft Amnesty International (AI) der israelischen Besatzungsmacht nun vor, außergerichtliche Exekutionen zu verüben. Die Soldaten würden außerdem Sanitäter regelmäßig gewaltsam daran hindern, Verletzte zu versorgen. AI untersuchte drei Vorfälle aus dem Oktober und November, bei denen 20 Menschen rechtswidrig getötet worden seien, darunter sieben Kinder.
Erst am 30. Januar drang ein israelisches Kommando, als Ärzte und Patienten verkleidet, ins Ibn-Sina-Hospital in Dschenin ein und ermordete drei junge Palästinenser, die in einem Krankenzimmer schliefen. Einer von ihnen wurde dort wegen einer Lähmung der Beine behandelt, die anderen beiden wollten ihm Gesellschaft leisten, so das medizinische Personal. Laut israelischer Armeeführung hätten die Männer einen großen Anschlag geplant. Das reichte aus, um sie zu erschießen. Ohne Gerichtsurteil und ohne Möglichkeit einer Verteidigung. Für Aurel Sari hat das Kommando gegen internationales Recht verstoßen, weil es sich verkleidet hat, »um das Vertrauen des Gegners zu gewinnen und ihn dann zu töten oder zu verletzen«, erklärte der Professor für Völkerrecht an der Universität in Exeter gegenüber ABC News. »Die Regel ist Teil des Völkergewohnheitsrechts sowohl in internationalen als auch nicht internationalen bewaffneten Konflikten, was bedeutet, dass Israel daran gebunden ist.«
Menschenrechtsgruppen wie AI fordern den Internationalen Gerichtshof in Den Haag auf, endlich gegen das gesetzlose Verhalten der israelischen Besatzungsmacht einzuschreiten. Es geht nicht nur um außergerichtliche Exekutionen, sondern auch um exzessive Gewalt bei Festnahmen oder um die ungesetzliche Zerstörung von Häusern. Am Montag riss die israelische Armee das Haus einer palästinensischen Familie in der Nähe von Al-Khalil (Hebron) ein, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur WAFA. Sieben Menschen sind jetzt obdachlos. Besonders gefürchtet sind die Razzien, die oft bei Nacht stattfinden.
In Nur Schams, dem Flüchtlingslager von Tulkarem, dauerte eine Razzia am 19. Oktober laut WAFA sage und schreibe 30 Stunden. Bulldozer kappten im ganzen Lager Strom- und Wasserleitungen. 13 Palästinenser wurden getötet, darunter sechs Minderjährige. 15 Personen wurden festgenommen. Ein israelischer Soldat kam ebenfalls ums Leben, neun wurden verletzt. Während der Razzia durchsuchte und beschädigte die Armee mehr als 40 Häuser. Zu den Toten gehörte der 15 Jahre alte Mahamid Taha. Israelische Soldaten erschossen ihn vor dem Elternhaus, als er nachschauen wollte, ob die Israelis abgezogen waren. Drei Kugeln trafen den unbewaffneten Jungen. Ins Bein, in den Bauch und in den Kopf. Als ihn sein Vater in Sicherheit bringen wollte, wurde auch er durch Schüsse verletzt – obwohl er den Soldaten seine erhobenen, leeren Hände gezeigt habe, erzählte die Tochter AI. Der Vater überlebte schwerverletzt, sein Sohn starb. Zwölf Stunden später kehrten die Soldaten zurück und durchsuchten stundenlang das Haus der Familie. Am 3. Januar war Nur Schams WAFA zufolge erneut das Ziel einer Razzia mit Kampfdrohnen und Scharfschützen auf den Dächern der höchsten Gebäude – anderthalb Tage lang.
Die Razzien führen immer wieder zu meist friedlichen Protesten der Bevölkerung. Manchmal schmeißen Jugendliche Steine auf die Soldaten. Die Besatzungsmacht reagiert häufig mit scharfer Munition, auch wenn nach internationalen Standards der Tod von Demonstranten nur dann in Kauf genommen werden darf, wenn eine unmittelbare Gefahr für das Leben der Soldaten besteht. Scharfe Munition »ist keine angemessene Reaktion auf das Werfen von Steinen«, so AI. Als Besatzungsmacht ist Israel an die Genfer Konvention gebunden. Menschenrechtsgruppen zufolge hält sich Israel kaum noch daran.
Auch in der Nacht zu Montag überzog die israelische Armee die Westbank mit Razzien. 33 Personen seien verhaftet worden, berichtete der israelische Sender I 24 News. Seit dem 7. Oktober sind nach Angaben des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet und der israelischen Armee mehr als 3.000 Menschen festgenommen worden.
Quelle: junge Welt v.06.02.2024/ Nasser Ishtayeh/IMAGO/SOPA Images Kopfschuss im Krankenbett: Tatort im Ibn-Sina-Krankenhaus in Dschenin (30.1.2024)

Verletzt die Ukraine die Menschenrechte ?
The Guardian entdeckt plötzlich Justizunrecht und Folter in der Ukraine
4 Feb. 2024 08:07 Uhr
Entdeckt die britische Presse jetzt, dass es in der Ukraine keineswegs so demokratisch und rechtsstaatlich zugeht, wie man es dem Leser bislang weismachen wollte? In der Londoner Zeitung "The Guardian" ist am Samstag ein Artikel über zu horrenden Strafen verurteilte und gefolterte Ukrainer mit "prorussischen Ansichten" erschienen.
Der Londoner The Guardian hat in seiner Ausgabe vom Samstag unerwartet etwas entdeckt, wovon RT DE in der Vergangenheit wiederholt berichtet hatte: die Verfolgung Andersdenkender, Justizunrecht und Folter in der Ukraine, jener von demselben Guardian über Jahre romantisierten "Verteidigerin demokratischer Werte".
Im Artikel wird nur ein kleiner Teil des Grauens aufgedeckt, das in ukrainischen Gefängnissen Alltag ist und dem insbesondere politische Gefangene ausgesetzt sind, also ukrainische Staatsbürger, die wegen ihrer "prorussischen" Ansichten als "Kollaborateure" diffamiert werden. Immerhin wird hier erstmals in der westlichen Presse die Tatsache, dass in den Gefängnissen gefoltert wird, anerkannt: Es gibt sogar ein Foto eines Inhaftierten, und er wird mit der Aussage zitiert, dass die auf seiner Stirn sichtbare "Ork"-Tätowierung von Mithäftlingen mit Gewalt gestochen wurde.
Berichtet wird auch über eine 30-jährige Bewohnerin von Tschassow Jar, die zu 15 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Ihr Ehemann, sagt sie, habe für die Russen ukrainische Stellungen ausgespäht. Weil die Beweise im gemeinsamen Haus aufgefunden wurden und sie durch das Geständnis auf einen Austausch nach Russland hoffte, habe sie die Schuld auf sich genommen. Erreicht hat sie dadurch weder eine mildere Strafe – 15 Jahre sind das Höchstmaß für Frauen – noch die erhoffte Aufnahme in die Austauschlisten. Sie ist mit ihrer zweijährigen Tochter inhaftiert und hat Angst, dass man sie ihr wegnimmt, wenn das Kind das dritte Lebensjahr vollendet.
Weitere Neuigkeiten für britische Leser: Ein 34-jähriger Lehrer aus Slawjansk, das dritte Beispiel im Artikel, sitzt in Haft, weil er versucht hat, zu Freunden auf der Krim zu fliehen.
In Cherson wurden zahlreiche Personen wegen ihrer Beteiligung an der Organisation des Referendums im Herbst 2022 verhaftet, auch das spricht der Guardian zu unser aller Überraschung an.
Dabei hat, auch das ergibt sich aus dem Bericht, der SBU dem Guardian seine Interviewpartner ausgesucht. Deshalb haben die Reporter auch nur diejenigen Inhaftierten zu Gesicht bekommen, die wenigstens noch alle Organe beisammen haben, und nur solche, die tatsächlich in der einen oder anderen Form mit Russland zusammengearbeitet haben. Das wird dann im Artikel so zusammengefasst:
"Einige haben eindeutig ukrainische Leben in Gefahr gebracht, indem sie Informationen und Koordinaten an die Russen weitergegeben haben. In anderen Fällen, wie z. B. bei einer Frau, die für fünf Jahre ins Gefängnis kam, weil sie während des gefälschten russischen Referendums in der Region Cherson logistische Unterstützung leistete, zeigen die Fakten, zu welch schwierigen Entscheidungen die Menschen gezwungen waren, als sie mit einer Besatzungsmacht konfrontiert waren, die behauptete, sie sei da, um zu bleiben."
Nicht begegnet sind die britischen Reporter den Häftlingen, die für nichts anderes als harmlose Posts in sozialen Netzwerken zu langen Haftstrafen verurteilt wurden. Nicht den Schullehrern oder den Mitarbeitern kommunaler Dienste, die unter "russischer Besatzung" wie gewohnt ihren beruflichen Pflichten nachgingen. Und schon gar nicht jenen Hunderten, vielleicht sogar Tausenden, die in den Gebieten Cherson und Charkow nach der "Befreiung" durch die Ukraine ohne Gerichtsverhandlung erschossen und in Massengräbern verscharrt wurden, wovon es Videos und zahlreiche Zeugenberichte gibt.
Insgesamt sind in den zurückliegenden zwei Jahren 195.776 Strafverfahren gegen Ukrainer mit tatsächlich oder vermeintlich "prorussischen" Einstellungen eingeleitet worden. Das hat die Nachrichtenplattform ukraina.ru durch minutiöse Auswertung der öffentlich zugänglichen Verfahrensregister ermittelt. Der Guardian hat sich vom SBU einen Bären aufbinden lassen, wenn er von nur rund 8.000 derartiger Verfahren berichtet.
Auf den Leser der Mainstreampresse im Westen, ob Großbritannien oder Deutschland, warten noch viele Enthüllungen über die ihm bislang so angepriesene "demokratische" Ukraine, der Guardian hat jetzt nicht einmal die Spitze des Eisbergs angeschnitten.
Das Schicksal der ukrainischen Oppositionellen übrigens, die im März 2022 vom SBU oder nationalistischen Banden entführt wurden, ist auch heute – fast zwei Jahre später – nur zu einem geringen Teil aufgeklärt.
Quelle: RTd.04.02.2024/ Russische Kriegsgefangene in einem ukrainischen Gefangenenlager (April 2023)/ Quelle: Gettyimages.ru © Paula Bronstein/Getty Images

Meinungsfreiheit - ein hohes Gut der Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 05.02.2024, Seite 3 / Schwerpunkt
MEINUNGS- UND PRESSEFREIHEIT
»Kritik zum Verstummen bringen«
EU-Medienfreiheitsgesetz zementiert Macht der Big-tech-Konzerne und erlaubt Hacken von Journalisten. Ein Gespräch mit Patrick Breyer
Von Mawuena Martens
Welche Auswirkungen auf die Medien- und Pressefreiheit sehen Sie, sollte das EU-Medienfreiheitsgesetz in seiner jetzigen Form verabschiedet werden?
In Ländern wie Ungarn, wo Victor Orbán eine sogenannte illiberale Demokratie aufbauen will, schützt diese neue Verordnung tatsächlich die Meinungsfreiheit. In Ländern wie Deutschland allerdings, in denen es eine freie Presse gibt, kann die Verordnung Zensur sogar begünstigen, zum Beispiel durch das geplante Europäische Gremium für Mediendienste.
Was ist an dem geplanten Gremium problematisch?
Das Sekretariat, also quasi die Mitarbeiter dieses neuen Gremiums, sollen von der EU-Kommission gestellt werden. Zwar sollen sie weisungsunabhängig sein, Fakt ist aber, dass sie Mitarbeiter der EU sind und das Gremium damit politisch und nicht vollständig unabhängig sein kann. Aufgabe des Gremiums ist es auch, Maßnahmen gegen ausländische Medien zu koordinieren, die die öffentliche Sicherheit schwer gefährden. Das läuft letztlich auf Zensur hinaus, weil man es als Gefährdung der öffentlichen Sicherheit ansieht, wenn aus dem Ausland heraus Propaganda betrieben wird. Stichwort Staatssender, Stichwort RT Deutsch. Natürlich verbreitet jedes Land im Sinne seiner eigenen Interessen Informationen im In- und Ausland. Wenn wir aber anfangen, den Zugang unserer eigenen Bürger zu ausländischen Informationsquellen abzuschneiden, ist das nicht vereinbar mit den Grundsätzen eines freien Landes und eines mündigen Bürgers. Ich halte es für den völlig falschen Weg, unter dem vermeintlichem Deckmantel des Schutzes der öffentlichen Sicherheit Auslandsmedien zensieren zu wollen.
Seit Bekanntwerden des Gesetzesvorhabens gibt es Protest von seiten Medienschaffender und Zivilgesellschaft, die ein Ausspionieren von Journalisten durch Spähsoftware befürchten. Ist das durch die Einigung im Dezember vom Tisch?
Der Einsatz von Spyware gegen Journalisten wird ja durch das Vorhaben offiziell reguliert und damit zugelassen, und ich finde es skandalös, dass hier kein Verbot erfolgt ist. Mitgliedstaaten können zum Schutz der nationalen Sicherheit ohne Einschränkungen und unbemerkt Handys von Journalisten hacken. Fairerweise muss man sagen, dass das auch das EU-Medienfreiheitsgesetz nicht ändern kann, weil die EU im Bereich der nationalen Sicherheit nicht eingreifen darf. Hier also den Anschein zu erwecken, das Gesetz würde vor Missbrauch schützen, ist falsch.
Die EU-Verordnung regelt auch den Umgang mit der Löschung von Inhalten oder Accounts von Mediendienstanbietern. Onlinedienste müssen diesen Schritt demnach mitteilen und die Möglichkeit einer Antwort einräumen. Ist damit alles gut?
Normalerweise unterliegen die gedruckten oder gesendeten Inhalte von Medien keiner Zensur, der Staat darf nicht eingreifen. Anders leider im Internet: Wenn Medien Kanäle auf Facebook und Co. betreiben, maßen sich ausländische Internetkonzerne tatsächlich an, diese Pressefreiheit quasi an den von ihnen diktierten Geschäftsbedingungen zu messen. Diese sind oft völlig willkürlich und enthalten schwammige Begriffe. Big-tech-Konzerne können dann tatsächlich aufgrund eigener, selbst festgelegter Regeln Inhalte der freien Presse entfernen oder behindern. Nach meiner Überzeugung dürfen legale Inhalte aber nicht wegen willkürlich gesetzter Regeln eingeschränkt werden. Das EU-Medienfreiheitsgesetz sieht keinen solchen Schutz legaler Medieninhalte vor. Denn darin ist nur eine Erklärungspflicht der Internetplattformen sowie die Möglichkeit einer Stellungnahme von seiten des Medienanbieters bestimmt. Damit haben die AGB der Unternehmen quasi Vorrang vor der Pressefreiheit. Das ist wirklich skandalös und hoch bedenklich.
Welchen weiteren Weg geht der Gesetzestext nun, und gibt es noch eine Möglichkeit, Einfluss auf seinen Inhalt zu nehmen?
Inzwischen steht das Ergebnis der intransparenten Verhandlungen fest und ist veröffentlicht worden. Auch der Kulturausschuss des Parlaments hat ihn bestätigt. Voraussichtlich im März wird es vom Europäischen Parlament offiziell angenommen werden. Dann muss noch der Rat zustimmen. Theoretisch also ist noch möglich, das Gesetz abzulehnen und neu aufzumachen, praktisch aber ausgeschlossen.
Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat in der vergangenen Woche ein stärkeres Vorgehen gegen »gezielte Desinformation« aus dem Ausland, insbesondere seitens Russland, gefordert. Was meint er damit, und welche Bemühungen gibt es, die Bereitstellung von Informationen gezielt zu steuern?
Es ist in der Tat so, dass Russland Europa destabilisieren und spalten sowie autoritäre Parteien hierzulande stärken will. Richtig ist auch, dass dazu Propaganda im Netz verbreitet wird, die scheinbar von Bürgern kommt. Was die EU nun macht, ist, Propagandasender wie RT als Sanktionsmaßnahme oder auch über einen neuen Krisenmechanismus des sogenannten Digital Service Acts aus Europa fernzuhalten. Sie will solche Propagandamaßnahmen quasi unterbinden. Ich halte das für falsch und teilweise auch kontraproduktiv, weil man Propaganda sehen und verstehen können muss, um sie zu widerlegen. Des weiteren plant die EU neben dem Vorgehen gegen offizielle Medienkanäle, sogenannte Desinformation im Netz zu zensieren. Aber da ist ja schon die Grundfrage: Wer entscheidet eigentlich, was Desinformation ist und was Wahrheit? Wir wollen ja kein staatliches Wahrheitsministerium, das festlegt, was wir glauben dürfen und was nicht. Nicht zuletzt verlangt die EU, gegen anonyme Accounts im Netz vorzugehen, dabei schützt die Anonymität im Netz auch viele Menschen hierzulande, beispielsweise vor Nachstellungen und Stalking. Gegen die Anonymität vorzugehen ist daher gefährlich und kontraproduktiv. Besser wären Gegendarstellungen, Mahnungen oder Fact-Checking. Außerdem ist es wichtig, die Medienkompetenz und das Vertrauen in das System durch mehr Transparenz, echte Mitbestimmung für Bürger und die Einführung der direkten Demokratie auf EU-Ebene zu stärken. Die EU sieht ja oftmals schon ausländische Kritik an sich selbst als Propaganda an. Natürlich steckt dahinter eine Agenda, aber in der Sache wird die EU auch hierzulande von den eigenen Bürgern vielfach und zu Recht kritisiert, vor allem dafür, wie sie im Moment funktioniert, nämlich als Einfallstor für Kapitalinteressen, wo der Bürgerwille wenig zählt. Wer das Vertrauen in die Institutionen stärken möchte, müsste ja zuerst einmal die berechtigte Kritik angehen und sich an die eigene Nase fassen können. Das gerät hier völlig unter die Räder, wenn der Ansatz ist, Kritik zum Verstummen bringen zu wollen.
Quelle: junge Welt; 05.02.2024/ IMAGO/Bihlmayerfotografie Patrick Breyer ist EU-Abgeordneter der Piratenpartei und in der Bürgerrechtsbewegung aktiv

Meinungsfreiheit - ein hohes Gut der Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 05.02.2024, Seite 3 / Schwerpunkt
MEINUNGS- UND PRESSEFREIHEIT
Schlupflöcher bleiben
EU-Verordnungen sollen für mehr Sicherheit im Netz und einheitliche Standards sorgen, richten sich aber auch gegen Meinungs- und Pressefreiheit
Von Mawuena Martens
Die Meinungs- und Pressefreiheit ist der Europäischen Union ein Dorn im Auge. Anscheinend, denn die EU-Kommission hat gleich mehrere Vorhaben in Arbeit, die wichtige Grundpfeiler einer liberalen Demokratie zum Einsturz bringen können. Grundpfeiler, auf die sich der Staatenbund emphatisch beruft, wenn es darum geht, andere Länder zu maßregeln.
Schon in zwei Wochen tritt das Gesetz über Digitale Dienste (Digital Services Act) in Kraft. Es bestimmt unter anderem, dass auch nicht rechtswidrige Eintragungen auf großen Onlineplattformen als löschungspflichtig gelten können. Denn unterschieden wird zwischen rechtswidrigen Inhalten sowie »irreführenden oder täuschenden Inhalten einschließlich Desinformationen«. Als Desinformation definiert die EU-Kommission solche Informationen, die »öffentliche Schäden« anrichten. Dadurch, so der ehemalige Richter Manfred Kölsch in einem Gastbeitrag für die Berliner Zeitung, können »politisch unliebsame Meinungen, ja wissenschaftlich argumentierte Positionen gelöscht werden«.
Ein weiteres Instrument im Maßnahmenkasten der EU: das sogenannte Medienfreiheitsgesetz. Der Name klingt vielversprechend, doch mit Schutz von Medienfreiheit hat das Vorhaben wenig zu tun. Seit einer Einigung mit dem EU-Parlament im Dezember ist das Gesetzesvorhaben dennoch fast in trockenen Tüchern. Schon im Juni hatten 400 Verlage, Pressevertreter und Verbände einen offenen Brief an die EU verfasst, um ihre Besorgnis auszudrücken. Bauchschmerzen bereiteten ihnen vor allem eine mögliche Einschränkung der Pressefreiheit durch die Einführung eines EU-Mediengremiums sowie ein mangelnder Schutz der Meinungsfreiheit und -vielfalt im Netz vor der Zensur durch große Onlineplattformen. Zwar finden sich im angepassten Text nun mehrere Verweise auf die Unabhängigkeit von Medien sowie die Rechte von Medienschaffenden. Kritische Punkte wurden jedoch nicht beseitigt, und Schlupflöcher bleiben bestehen. So können Journalisten aufgrund nationaler Bestimmungen ausgespäht werden, auch ist das EU-Mediengremium abhängig von der EU-Kommission und große Digitalkonzerne erhalten das Recht auf Zensur.
Doch damit nicht genug. Wenn es nach dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell ginge, müsse die EU im Superwahljahr 2024 noch mehr gegen »Desinformation« tun. Im Januar schlug er vor, wie die EU weiter gegen »Einmischung aus dem Ausland« agieren soll: »Entlarvung von Falschmeldungen, Einschränkung der Verbreitung manipulierter Inhalte, Entfernung von Websites oder Kanälen, Sichtbarmachung zuverlässiger Inhalte, Identifizierung und Begrenzung finanzieller Anreize oder rechtliche Maßnahmen, einschließlich Sanktionen«. Wenig überraschend bezog er sich dabei vor allem auf Russland und rühmte den Stopp der Übertragung von Russia Today und Sputnik in der EU. Bei soviel Aktionismus der EU darf der Bürger gespannt bleiben, welche Maßnahmen nun noch aus dem Ärmel gezaubert und demnächst umgesetzt werden – sofern er davon dann noch etwas mitbekommt.
Quelle: junge Welt v.05.02.2024/ IMAGO/Future Image Recht auf Zensur: Onlineplattformen wie X dürfen eigenmächtig gegen »Desinformation« vorgehen

Kampf um Menschenrechte
Welche Gräueltaten noch? Israelische Todesschwadron ermordet Patienten in Krankenhausbetten
2 Feb. 2024 08:54 Uhr
Am selben Tag, an dem die abscheuliche Operation Israels im Westjordanland stattfand, wurde der Sprecher des US-Außenministeriums in einer Pressekonferenz in Washington nach deren Rechtmäßigkeit befragt. Millers Antwort, die nachfolgend protokolliert ist, spricht in ihrem widerlichen und monströsen Versuch, das israelische Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu rechtfertigen, für sich.
Von Rainer Rupp
Zu dem Vorfall hat der Klartext sprechende AP-Korrespondent Matt Lee den Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, befragt. Als Hintergrund ist der Vorfall wie folgt kurz zusammengefasst:
In Zivil: Israelische Streitkräfte stürmen palästinensisches Krankenhaus und töten drei Männer
Eine als medizinisches Personal und als Zivilisten verkleidete Gruppe zionistischer Mörder war im besetzten Westjordanland mit Maschinenpistolen und Handgranaten bewaffnet in ein palästinensisches Krankenhaus eingedrungen, wo sie – ganz in der Tradition faschistischer Todesschwadronen – gezielt einige Patienten in ihren Krankenbetten liquidiert beziehungsweise außergerichtlich hingerichtet haben. Damit stand bei der Pressekonferenz des US-Außenministeriums die Frage im Raum, ob diese Operation des US-Schützlings als angemessenes Verhalten eines Staates angesehen werden kann, der von sich immer wieder behauptet, der einzige zivilisierte und demokratische Staat im Nahen Osten zu sein.
Frage von Matt Lee: (...) Und hier meine zweite Frage, die mit der Operation zu tun hat, die die Israelis im Krankenhaus von Jenin durchgeführt haben. Was haben Sie dazu zu sagen? Ist das etwas, das Sie für problematisch halten, oder ist es etwas, auf das Sie mit Neid blicken, weil das eine Art großartige "Mission: Impossible"-Mission gewesen ist, etwas, das wir (USA) uns wünschen, dass wir auch so was machen könnten?
Antwort von Matthew Miller:Tja, ich würde sagen, dass wir dringend zur Vorsicht mahnen, wenn Operationen das Potenzial haben, Zivilisten und zivile Einrichtungen zu beeinträchtigen. Dazu gehören natürlich auch Krankenhäuser. Wir erkennen aber auch die sehr realen Sicherheitsherausforderungen an, mit denen Israel konfrontiert ist, und sein legitimes Recht, sein Volk und sein Territorium gegen Terrorismus zu verteidigen. Israel hat natürlich das Recht, Operationen durchzuführen, um Terroristen vor Gericht zu bringen, aber diese Operationen müssen in voller Übereinstimmung mit dem humanitären Völkerrecht durchgeführt werden.
Lee: Nun, zu diesen Operationen gehört es, in Krankenhäuser zu gehen und Menschen in ihren Betten zu ermorden, unabhängig davon, ob sie mutmaßliche oder sogar bekannte Terroristen sind. Ist das okay für Sie?
Miller: Die Prämisse dieser Frage war also sehr wichtig. Offensichtlich wussten sie – wir auch – dass sie da reingingen ...
Lee: Nun, Sie glauben nicht, dass sie hineingegangen sind ...
Pepe Escobar: Wird das Urteil gegen Israel den Genozid stoppen?
Pepe Escobar: Wird das Urteil gegen Israel den Genozid stoppen?
Miller: Wir – nun, warten Sie.
Lee: ... und Menschen getötet haben, die völlig unschuldig sind, nicht wahr?
Miller: Wir – also lassen Sie mich sagen, dass ...
Lee: Denn, wenn Sie das glauben würden, dann würden Sie es verurteilen, nicht wahr?
Miller: Das würden wir auf jeden Fall, aber ich würde sagen, dass Israel gesagt hat, dass es sich um Hamas-Aktivisten handelte. Sie sagten, dass einer von ihnen zum Zeitpunkt der Operation eine Waffe bei sich trug. Ich bin also nicht in der Lage, über die Fakten der Operation zu sprechen. Man müsste eine Art juristisches Urteil fällen – alle Fakten der Operation kennen. Aber im Allgemeinen haben sie (die Israelis) das Recht, Operationen durchzuführen, um Terroristen vor Gericht zu bringen, aber sie müssen in vollem Umfang ...
Lee: Auch in Krankenhäusern?
Miller: Wir wollen also, dass sie ihre Operationen in Übereinstimmung mit dem humanitären Völkerrecht durchführen. Wir würden im Allgemeinen sagen, dass wir nicht wollen, dass sie Operationen in Krankenhäusern durchführen, aber nach dem humanitären Völkerrecht verlieren Krankenhäuser einen Teil ihres Schutzes, wenn sie zur Durchführung von terroristischen Operationen missbraucht werden.
[Lee versucht zu unterbrechen.]
Miller: Also nochmals, ich bin nicht in der Lage, eine Einschätzung abzugeben, ohne all diese Fakten zu kennen. Einige der Fakten, die von Israel vorgelegt wurden, besagen, dass einer von ihnen eine Waffe trug und dass sie planten, terroristische Operationen durchzuführen oder zu starten. Sie müssten sich also all diese Fakten ansehen, um eine spezifische Bewertung dieser Operation vornehmen zu können. Aber generell wollen wir, dass die Krankenhäuser geschützt werden. Es ist wichtig, dass bei dieser Operation keine Zivilisten zu Schaden gekommen sind, aber – und wie gesagt, wir wollen – wir glauben, dass Israel –
Lee: Woher wissen Sie das – woher wollen Sie das wissen?
Miller: Es gibt keine Berichte über Zivilisten, die bei dieser Operation verletzt wurden.
Lee: Kann ich später darauf zurückkommen?
Miller: Nur zu.
Lee: Vielen Dank. Aber in diesem speziellen Fall meine ich, dass Israel das gesamte Westjordanland besetzt. Es steht unter israelischer Kontrolle. Sie müssen sich nicht als Sanitäter verkleiden und ein Krankenhaus stürmen, um dort Menschen zu ermorden, die ihr Nicht-Zivilisten nennt. Eigentlich sind sie aber Zivilisten, aber das ist offensichtlich nebensächlich.
Und damit war dieser Punkt der Pressekonferenz abgehakt. Die Mitschrift und das Video der Pressekonferenz findet man auf der Webseite des U.S. Department of State unter diesem Link. Und hier ist ein Link zu einem CNN-Video mit Bildern dieser verruchten Tat, welche die moralische Verderbnis der faschistischen Realität unter der gegenwärtigen Regierung in Israel widerspiegelt.
Auch die Scheinheiligkeit des US-Außenamtssprechers Miller ist sagenhaft. Man stelle sich doch nur mal vor, man würde die Akteure austauschen – wenn es Hamas-Kämpfer gewesen wären, die auf diese Weise in ein israelisches Krankenhaus eingedrungen wären und israelische Soldaten oder Kommandeure getötet hätten! Wie ganz anders wäre dann wohl diese Pressekonferenz im US-Außenamt verlaufen.
Außerdem ist es lächerlich, mit welch einer fadenscheinigen Erklärung die Israelis die Ermordung von drei Menschen rechtfertigen, nur weil einer der Opfer angeblich eine Pistole bei sich gehabt haben soll. Wie bereits zuvor am 7. Oktober 2023 bei den angeblich von der Hamas enthaupteten 40 israelischen Babys und ähnlichen Horrorgeschichten aus kranken Gehirnen, ist die angeblich im Krankenhausbett gefundene Pistole wahrscheinlich auch wieder eine dreiste Lüge. Aber um der Argumentation willen sollten wir mal annehmen, es wäre wahr. Könnte der Ermordete diese Vorsichtsmaßnahme nicht gerade deshalb getroffen haben, weil er die skrupellose Vorgehensweise der Israelis kannte und er befürchten musste, dass sie durchaus in der Lage sein würden, diese Gräueltaten sogar in einem Krankenhaus zu begehen?
Israel wird mit Unterstützung der USA sicherlich weiter machen wie bisher, und in der ganzen Welt werden immer mehr Menschen hinter der scheinheiligen Maske von Tugendhaftigkeit, Menschenrechten und Demokratie ihre wirklichen mörderischen Fratzen erkennen. Mit jedem weiteren Verbrechen erleichtern sie den Job des Internationalen Gerichtshofs und bereits heute stehen sie zunehmend allein da.
Quelle: RTd v.02.02.2024 / Bilder GeFiS-Archiv

Kampf um Frieden, Menschenrechte und Völkerrecht
Der juristische Arm der NATO
Internationaler Gerichtshof (IGH) weist Klage der Ukraine gegen Russland zurück. Berlin, Washington und NATO planen Sondertribunal zur Aburteilung Moskaus unter Vermeidung der etablierten Weltjustiz.
02
FEB
2024
KIEW/DEN HAAG/BERLIN (Eigener Bericht) – Der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag hat eine Klage der Ukraine gegen Russland weitestgehend abgewiesen und damit zum zweiten Mal binnen weniger Tage klar gegen westliche Interessen geurteilt. Kiew hatte bereits im Jahr 2017 ein Verfahren gegen Moskau angestrengt; die Vorwürfe lauteten vor allem auf finanzielle Unterstützung ostukrainischer Separatisten und auf Unterdrückung der ukrainischen und der tatarischen Minderheit auf der Krim. Der IGH teilt die Auffassung nicht; er wirft Moskau lediglich vor, auf der Krim den ukrainischsprachigen Schulunterricht nicht ausreichend zu fördern. Mit Blick darauf, dass die Internationale Justiz inzwischen manchmal auch gegen den Westen entscheidet, beginnen Berlin, Washington und die NATO mit dem Aufbau von Parallelstrukturen. So soll ein Sondertribunal eingerichtet werden, um Russlands Angriff auf die Ukraine aburteilen zu können. Es soll nur zu diesem Zweck installiert werden; so sollen Klagen wegen des Führens völkerrechtswidriger Angriffskriege gegen den Irak oder Jugoslawien verhindert werden. Damit verabschiedet sich der Westen vom Gedanken der Gleichheit aller Staaten vor dem Völkerrecht.
Klage gegen Russland
Der Internationale Gerichtshof in Den Haag (IGH) hat am Mittwoch eine Klage, die die Ukraine bereits 2017 gegen Russland angestrengt hatte, in den meisten Punkten abgewiesen. Kiew hatte Moskau vorgeworfen, seit 2014 prorussische Separatisten im Donbas sowie auf der Krim zu finanzieren, sie mit Waffen auszurüsten und sie militärisch auszubilden. Damit habe es gegen die UN-Konvention zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus verstoßen.[1] Zudem habe es sich eines Bruchs der UN-Konvention zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung schuldig gemacht, indem es auf der Krim Tataren und Ukrainer unterdrücke; der Anwalt der Ukraine hatte behauptet, auf der Halbinsel würden seit ihrer Aufnahme in die Russische Föderation die Rechte dieser beiden Minderheiten verletzt und ihre „Kultur ausgemerzt“.[2] Die Ukraine hatte damals Schadensersatz von Russland gefordert und dies auch auf den Abschuss des malaysischen Flugzeuges MH17 im Juli 2017 über der Ostukraine bezogen, bei dem alle 298 an Bord befindlichen Menschen zu Tode kamen. Schließlich hatte Kiew den IGH noch aufgefordert, in einer einstweiligen Verfügung die russische „Aggression“ zu stoppen. Der IGH kam Letzterem nur insofern nach, als er verlangte, beide Seiten müssten jeglichen Schritt zu einer Eskalation unterlassen.
Weitestgehend abgewiesen
Am Mittwoch gab der IGH der Ukraine lediglich in wenigen marginalen Punkten recht. So stellte er fest, Russlands Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 habe die Lage eskaliert und damit gegen die einstweilige Verfügung verstoßen.[3] Darüber hinaus habe Moskau Vorwürfe aus Kiew, russische Bürger finanzierten Terrorismus in der Ukraine, nicht sorgfältig genug untersucht. Zudem habe es auf der Krim den Schulunterricht in ukrainischer Sprache nicht im erforderlichen Umfang gefördert. Sämtliche weiteren Vorwürfe gegen Russland wies der IGH ganz ausdrücklich zurück. So sei eine finanzielle Unterstützung für ukrainische Separatisten durch Russland nicht nachzuweisen. Die Frage, ob Moskau Separatisten in der Ostukraine oder auf der Krim mit Waffen ausgestattet oder militärisch ausgebildet habe, falle nicht unter die zitierte UN-Konvention. Auch für eine angeblich umfassende Diskriminierung der ukrainischsprachigen Minderheit oder der Krim-Tataren habe die Ukraine in Den Haag keine einschlägig aussagekräftigen Belege präsentiert. Der IGH kam nun in seinem Urteil am Mittwoch zu dem Schluss, die ukrainischen Vorwürfe seien in der überwiegenden Mehrheit unzutreffend. Davon, Russland zur Zahlung von Schadensersatz zu verpflichten, sah der Gerichtshof dementsprechend ab.[4]
Gegen die Interessen des Westens
Die Entscheidung des IGH ist bereits die zweite innerhalb kurzer Zeit, bei der das oberste Gericht der Vereinten Nationen nicht im Sinne der westlichen Staaten und ihrer Verbündeten Recht spricht. Zuletzt war dies am vergangenen Freitag bei der einstweiligen Anordnung des IGH gegen Israel der Fall gewesen, in der die israelische Regierung dazu verpflichtet wurde, Maßnahmen zur Verhinderung eines Genozids im Gazastreifen zu treffen (german-foreign-policy.com berichtete [5]).
Das Sondertribunal
Weil sich offenbar nicht mehr verhindern lässt, dass die internationale Justiz auch gegen Interessen der westlichen Staaten entscheidet, beginnen diese nach neuen Wegen zu suchen, um Rivalen und Gegner justiziell abzuurteilen. Das betrifft aktuell Bemühungen, Russlands Präsidenten Wladimir Putin wegen Führens eines Angriffskrieges vor Gericht zu stellen. Prinzipiell denkbar wäre, diesbezüglich Anklage vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zu erheben. Allerdings wurden, wie Beobachter bereits vor einem Jahr feststellten, die formalen Voraussetzungen für eine Verurteilung durch den IStGH wegen des Führens eines Angriffskrieges auf Druck der westlichen Staaten „eng formuliert“: Es habe „Furcht“ bestanden, „selbst vor den IStGH gezogen zu werden“ – dies „zum Beispiel wegen des Krieges im Irak“.[6] Um zu vermeiden, dass ein Verfahren gegen Russland zum Präzedenzfall für ein Verfahren gegen die USA (wegen des Irak-Kriegs) oder gar gegen die Bundesrepublik (wegen des Angriffskriegs gegen Jugoslawien 1999) wird, plädiert etwa Außenministerin Annalena Baerbock schon seit mehr als einem Jahr dafür, speziell für den Ukraine-Krieg ein „Sondertribunal“ zu schaffen.[7] Es solle zumindest „internationale Elemente“ enthalten und womöglich in Den Haag angesiedelt werden, hieß es.
Nur gegen Russland
Inzwischen konkretisieren sich die Pläne. Zuletzt wurden sie am 19. Januar von Vertretern von rund 40 westlichen Staaten sowie einigen multinationalen Organisationen bei einem Treffen in Luxemburg vorangetrieben. Die Entwürfe, die zur Diskussion standen, stammten von der EU-Kommission und vom Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD). Ihnen zufolge soll eine kleine Gruppe von Staaten ein Sondertribunal organisieren; als Core Group, die aktuell mit den Planungen befasst ist und nach Lage der Dinge als Organisatorin eines Tribunals in Frage käme, werden Deutschland und Frankreich, weitere EU-Staaten und EU-Institutionen, Großbritannien sowie die USA genannt, darüber hinaus die Parlamentarische Versammlung der NATO.[8] Das Sondertribunal soll sich ausschließlich gegen Personen richten, „die verdächtigt oder beschuldigt werden, das Verbrechen der Aggression gegen die Ukraine begangen zu haben“. Eingegrenzt werden soll das auf Personen, die „tatsächlich die Kontrolle über das politische oder militärische Handeln der Russischen Föderation“ innehaben. Das treffe, so heißt es, nur auf einige wenige Personen zu, insbesondere auf Präsident Wladimir Putin, Außenminister Sergej Lawrow und Verteidigungsminister Sergej Schojgu. Das Sondertribunal soll ausschließlich auf Antrag Kiews tätig werden dürfen.
Keine Gleichheit vor dem Recht
Sorgen machen sich die Initiatoren, wie berichtet wird, noch um die Legitimierung ihres Sondertribunals. Idealerweise solle die UN-Generalversammlung die Pläne absegnen, heißt es. Unklar ist freilich, welches Interesse insbesondere der Globale Süden daran haben soll, zumal ein Tribunal, das einzig und allein der Aburteilung eines Staates dient, von der zentralen Idee der Gleichheit aller vor dem Völkerrecht endgültig Abschied nähme. Richtet der Westen aber ein Sondertribunal ohne Legitimierung durch die Vereinten Nationen ein, dann müsste er damit rechnen, dass der Globale Süden seinerseits Sondertribunal errichtete, so zum Beispiel gegen die Aggressoren des Krieges gegen den Irak.
[1] World court rejects bulk of Ukraine’s terrorism charges against Russia. news.un.org 31.01.2024.
[2] Ukraine verklagt Russland vor Internationalem Gerichtshof. rsw.beck.de 07.03.2017.
[3] World court rejects bulk of Ukraine’s terrorism charges against Russia. news.un.org 31.01.2024.
[4] IGH weist Klage gegen Russland weitgehend ab. rsw.beck.de 01.02.2024.
[5] S. dazu Der Westen, der Süden und das Recht.
[6] Matthias Wyssuwa: Wer kann russische Kriegsverbrecher verurteilen? Frankfurter Allgemeine Zeitung 17.01.2023.
[7] Baerbock wirbt für Sondertribunal. Frankfurter Allgemeine Zeitung 17.01.2023. S. dazu Das Sondertribunal.
[8] Jan Diesteldorf, Paul-Anton Krüger: Ein Gericht, maßgeschneidert für Putin und seine Helfer. Süddeutsche Zeitung 19.01.2024.
Quelle: https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9473/Bild GeFiS-Archiv

Kampf um Menschenrechte
Proteste gegen Milei-Reformen: Polizei setzt Tränengas und Gummigeschosse ein
2 Feb. 2024 14:55 Uhr
Bei Protesten gegen die Wirtschaftsreformen des argentinischen Präsidenten Javier Milei ist es am Donnerstag in Buenos Aires zu Ausschreitungen gekommen.
Während Regierungsberatungen kam es vor dem Parlament zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und den Demonstranten. Den zweiten Tag in Folge debattierten die Abgeordneten über das umstrittene Gesetzespaket. Nach Regierungsangaben verließen mehrere Abgeordnete der Linken und anderer Oppositionsparteien wegen der Spannungen das Plenum.
Die Polizei ging mit Wasserwerfern, Tränengas und Gummigeschossen gegen die Demonstranten vor. Nach Angaben der Pressegewerkschaft von Buenos Aires wurden mindestens ein Dutzend Journalisten von Gummigeschossen getroffen. Lokale Medien berichten von drei Verletzten und zwei Festnahmen.
Quelle: RTd.02.02.2024/ Bild GeFiS Archiv

Kampf um Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 01.02.2024, Seite 3 / Schwerpunkt
MEINUNGSFREIHEIT
»Identifizierung ist die Vorstufe der Stigmatisierung«
Wie deutsche Kulturinstitutionen »problematische Gesinnung« aufspüren. Ein Gespräch mit Eran Schaerf
Von Stefan Ripplinger
Eran Schaerf ist ein jüdisch-israelisch-deutscher Künstler und Autor. Er veröffentlichte zuletzt »Gesammeltes Deutsch« (siehe Auszug oben)
Vor drei Jahren wollten Sie sich an der Gestaltung der »Gärten der Welt« in Berlin-Marzahn beteiligen. Davon zeugt Ihr wunderschöner Band »Ein jüdischer Garten« von 2022. Könnten Sie berichten, weshalb Sie am Ende doch nicht dabei waren?
Ich wurde mit zwei Kolleginnen gebeten, bei der Auswahl der Pflanzen in dem jüdischen Garten mitzuwirken. Wir schlugen vor, literarische Geschichten von jüdischem Leben, in denen Pflanzen eine Rolle spielen, zu recherchieren und ein Bestimmungsbuch für eine unbestimmbare jüdische Identität zusammenzustellen. Auf die Präsentation der Forschungsergebnisse bei Grün Berlin folgte ein Feedback der Springer-Stiftung, die das Projekt mit gefördert hat: Rosa Luxemburg sei nicht als Jüdin, sondern als Kommunistin bekannt, Elfriede Jelinek sei nach dem religiösen Gesetz »Vaterjüdin« und wie schon Sartre bemerkt habe, sei Jude, wer von anderen als Jude gesehen werde. Diese Bestimmung der jüdischen Identität durch die Springer-Stiftung schien uns ein wohltätiger Antisemitismus zu sein. Alarmiert berief Grün Berlin die Jury erneut ein und teilte uns mit: Ein Bezug auf die Schoah möge im Garten nicht zu prominent ausfallen. »Die räumliche Nähe zum Märchenwald z. B. böte sich für eine Referenz zum Antisemitismus in der deutschen Kultur an.«
Sie wollen nicht märchenhaft sein, und das kreidet man Ihnen an.
Den Auftakt zur Verdachtskultur gab der BDS-Beschluss des Bundestags 2019. Bis dahin hieß es, wenn es um komplexere Sichtweisen auf die palästinensisch-israelisch-deutsche Geschichte ging: »›Du als Jude‹ kannst das sagen, ich als Deutscher nicht.« Der Rückzug auf Identität verengt nicht nur die Aussicht auf internationale Solidarität, Identifizierung ist die Vorstufe zur Stigmatisierung. Ein Unrecht fragt mich nicht, wer ich bin, bevor es mir ins Auge sticht.
Für den Kölner Dom wünschte man sich eine künstlerische Reaktion auf mittelalterliche judenfeindliche Skulpturen. Dabei wurden alle ausgesiebt, die die israelkritische Resolution der Zeitschrift Artforum unterzeichnet haben. Was wissen Sie darüber?
Ich war zwar zusammen mit einer Kollegin für den Wettbewerb nominiert, aber auf der Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden wir uns nicht wieder. Ohnehin mussten sich dann alle zur Arbeitsdefinition von Antisemitismus der IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance, jW) bekennen. Schon seit einiger Zeit gibt es eine neue Funktion in der deutschen Kultur: den Berater oder die Beraterin. Diese Mutation des Antisemitismusbeauftragten soll eine »problematische Gesinnung« (Domradio.de) aufspüren, die der Fachjury entgehen könnte.
Sind israelische oder jüdische Künstlerinnen und Künstler besonders von der Cancel-Welle betroffen?
Die staatlich geduldete Ausgrenzung trifft jemanden, dessen Vorfahren im Deutschland der 30erJahre ihren Beruf nicht ausüben durften, anders als jemanden, der in Deutschland Zuflucht gefunden hat. Aber die Ausgrenzung ruiniert nicht nur Existenzgrundlagen von Kulturschaffenden, sie betrifft auch mich und Sie als Publikum. Wollen wir Ausstellungen in staatlich geförderten Kulturinstitutionen besuchen, wissend, dass sie »selbstgesäubert« sind, wie es der Zentralrat der Juden im Kulturausschuss des Bundestags forderte? Soll nun Kunst nach einem abzuhakenden Kriterienkatalog gelehrt, produziert und rezipiert werden? Als Beitrag zu einer Leitkultur, mit der die CDU als AfD-light zurückkehrt?
Quelle: junge Welt v.02.02.2024/ IMAGO/Funke Foto Services »Alarmiert berief Grün Berlin die Jury erneut ein und teilte uns mit: Ein Bezug auf die Schoah möge im Garten nicht zu prominent ausfallen« (Jüdischer Garten in den Gärten der Welt, Berlin)

Kampf um Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 01.02.2024, Seite 3 / Schwerpunkt
MEINUNGSFREIHEIT
Verdammte dieser Erde
Heftige Repressionen gegen israelkritische Künstlerinnen, Künstler und Intellektuelle
Von Stefan Ripplinger
Dokumentiert Sprachratgeber
Komplett anzeigen
Washington, 5. Dezember 2023, Kongressanhörung zu Protesten an Universitäten. »Verstehen Sie, dass der Gebrauch des Begriffs ›Intifada‹ im Zusammenhang mit dem israelisch-arabischen Konflikt zweifellos gewaltsamen Widerstand gegen den Staat Israel bedeutet, eingeschlossen Gewalt gegen Zivilisten und den Genozid an Juden?« Anstatt zu erklären, dass »Intifada« das arabische Wort für »Aufstand« ist und im Lauf der Geschichte alle möglichen Bedeutungen angenommen hat, stottert Harvard-Präsidentin Claudine Gay herum. Nicht besser schlagen sich Elizabeth Magill von der Universität Pennsylvania und Sally Kornbluth vom MIT.
Kein Zufall
Magill ist die erste, die gehen muss. Donald Trump frohlockt, die anderen würden ebenfalls rausgekegelt. Dann geht Gay. Die Anhörung der drei Unipräsidentinnen ist der Triumph nicht nur der republikanischen Inquisitorin Elise Stefanik, sondern auch der Rechten weltweit. Endlich haben sie ein Mittel gefunden, den verhassten Liberalen und Linken in Wissenschaft, Politik und Kunst heimzuleuchten. Ironischerweise ist dieses Mittel der Vorwurf des Antisemitismus. – Ironisch deshalb, weil Stefanik selbst die Lehre des »Großen Austauschs« verbreitet hat, wonach Juden die weiße Bevölkerung durch eine dunkle ersetzen wollten.
Berlin, 8. Januar 2024, Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses. Zur Debatte steht die »Antidiskriminierungsklausel« der CDU. Mittels der IHRA-Definition des Antisemitismus soll die Förderung von israelkritischen Künstlerinnen und Künstlern unterbunden werden. Am folgenden Tag erklärt die Rektorin des Wissenschaftskollegs, Barbara Stollberg-Rilinger, im Deutschlandfunk: »Es müsste zu denken geben, dass gerade eine jüdische Kulturschaffende sehr gewarnt hat vor dieser Antidiskriminierungsklausel, während Vertreter der AfD sie engagiert verteidigt haben.« Das ist kein Zufall. Es war die AfD, die die erste Resolution gegen die Israel-Boykottbewegung BDS in den Bundestag eingebracht hat. In Israel sind Gesinnungsgenossen an der Macht, man fühlt sich ausnahmsweise solidarisch.
Mittlerweile ist die CDU-Klausel wegen rechtlicher Bedenken suspendiert. Doch längst hat in einer Atmosphäre der Einschüchterung auch der Weltfremde begriffen: Wer gegen den Wind der Hegemonie segelt, wird nicht mehr landen. Wer missliebige Resolutionen unterschreibt, wird bei Ausschreibungen ausgesiebt, Förderungen werden gestrichen, Preise aberkannt, Verträge gekündigt, Ausstellungen abgesagt.
Nur einige Beispiele neben den bekannten (Jeremy Corbyn, Masha Gessen, Nicolas Jaar, Sharon Dodua Otoo, Adania Shibli): Wegen Israelkritik wurde die Holocaustüberlebende Marione Ingram von Hamburger Schulen ausgeladen, durfte der renommierte Dichter Ramy Al-Asheq kein Nachbar bei »Meet Your Neighbours« sein, verlor der Künstler Adam Broomberg seine Gastprofessur in Karlsruhe und wurde die queere Künstlerin Angelica Summer aus einem Jazzfestival gemobbt. Unwillig, sich einer Gesinnungsprüfung zu unterziehen, trat die Performerin Laurie Anderson von einer Professur zurück. Schon im November sagte das Saarlandmuseum eine Ausstellung der jüdischen Künstlerin Candice Breitz über Sexarbeit in Südafrika ab. Kultusministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) erklärte das nun damit, Breitz habe von einem Genozid in Gaza gesprochen. Dabei warnt sogar der Internationale Gerichtshof davor, die Gefahr eines Genozids zu verharmlosen (Le Monde, 27. Januar). Erwartungsgemäß begrüßte Israels Generalkonsulin Talya Lador-Fresher die Zensur. Antiisraelische Proteste erklärte sie zu Recht damit, dass »viele Kulturmenschen auf der linken Seite verortet sind« (Saarbrücker Zeitung, 25. Januar).
Eine Erklärung
Wenn aber alle, die nicht der siedlernahen Regierung Benjamin Netanjahus zujubeln wollen, nun als Antisemiten gelten sollen, trifft das auch diejenigen jüdischen und israelischen Intellektuellen, die erklären, die Grausamkeiten in Gaza geschähen »not in our name«. Dass liberale Medien das gutheißen, kann überraschen. Unterstützen die, die sich zuletzt »kriegstüchtig« meldeten, nun jeden Krieg des Westens? Orbánisieren sich die Urbanen? Vielleicht. Eine andere Erklärung hat mehr für sich. Palästinenser sind Araber. Araber und Afrikaner aber gehören zu jenen Verdammten dieser Erde, die der Westen als Bedrohung seines Reichtums sieht. Um diese Menschen abzuwehren, ist jede Verleumdung ihrer Unterstützer recht.
Quelle: junge Welt v.02.02.1014/ IMAGO/Matthias Reichelt Wer gegen den Wind der Hegemonie segelt, wird nicht mehr landen: Die Künstlerin Candice Breitz bei einer Kundgebung für einen Waffenstillstand in Gaza (Berlin, 10.11.2023)

Kampf um Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 01.02.2024, Seite 8 / Inland
ANTIFASCHISTEN IM VISIR
»Bespitzelung erfolgte aus meinem Umfeld heraus«
Inlandsgeheimdienst lässt Tochter von verfolgten Widerstandskämpfern weiter »beobachten«. Ein Gespräch mit Silvia Gingold
Interview: Gitta Düperthal
Silvia Gingold war ehemals Sprecherin der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, VVN-BdA, Hessen
Im Jahr 2017 klagten Sie, Tochter der durch das Naziregime verfolgten jüdischen kommunistischen Widerstandskämpfer Ettie und Peter Gingold, gegen das Hessische Landesamt für Verfassungsschutz. Ziel war, dass die Beobachtung durch den Inlandsgeheimdienst eingestellt wird und über Sie gesammelte Daten gelöscht werden. Nun urteilte der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) er dürfe Sie weiterhin beobachten. Wie wurde das begründet?
Der VGH hat unsere Berufung gegen das Urteil im Jahr 2017 abgelehnt und dabei alle Argumente des vergangenen Urteils, sowie die des Verfassungsschutzes übernommen: Ich würde in angeblich linksextremistischen Bezügen und ebensolchen Gruppierungen auftreten; um sie zu begünstigen, die Bekanntheit meiner Familie benutzen. Im Zentrum steht dabei die aus Sicht der Gerichte als »linksextremistisch beeinflusste« Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Auf unseren Einwand, dass die VVN-BdA in Landesberichten des Geheimdienstes nicht mehr auftaucht, hielt man entgegen: Das heiße nicht, dass sie nicht weiterhin unter Beobachtung steht.
1975 wurden Sie aus dem Schuldienst entlassen, weil es Zweifel an Ihrer »Verfassungstreue« gab. Welche Sicht eröffnet all das auf die politische Verfasstheit der Justiz?
Dass ausgerechnet in antifaschistischer Tradition Aktive wieder Repressionen und Verfolgung ausgesetzt sind, zeigt, wie wenig glaubwürdig aktuelle Lippenbekenntnisse gegen rechte Tendenzen sind. Durch die Geschichte meiner Familie zieht es sich wie ein roter Faden bis heute: Die Gerichte und der Verfassungsschutz diskreditieren den Widerstand meiner Eltern gegen das Naziregime, weil sie mein Engagement in deren Sinn als linksextremistisch anlasten.
Sie erwägen, Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einzulegen. Die VVN-BdA Hessen ermutigt dazu – weshalb?
Die ebenso als Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes verunglimpfte VVN-BdA wehrt sich gegen verleumderische Darstellungen, dass ihre Bestrebungen »gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung« gerichtet seien. Mit der Begründung war ihr die Gemeinnützigkeit entzogen worden; was nach öffentlichen Protesten zurückgenommen werden musste. In Zeiten des Rechtsrucks, die älteste antifaschistische Organisation in der BRD, gegründet von Überlebenden des Holocausts und Widerstandskämpfern gegen den Faschismus, zu kriminalisieren, ist infam. Einerseits staatlich gegen Antisemitismus vorgehen zu wollen, andererseits betroffene Nachfahren zu verfolgen: Das passt nicht.
Ein AfD-Politiker wie Björn Höcke ist dagegen durch Beamtenrecht geschützt.
In der Tat kann der zur Zeit aufgrund seiner Tätigkeit im Thüringer Landtag im Lehramt pausierende Höcke Beamter bleiben und danach wieder in den hessischen Schuldienst zurückkehren: Geschichte lehren – als wäre nichts gewesen. Ihm wurde anhand konkreter Aussagen nachgewiesen, wie er rassistisch und antisemitisch als Verfassungsfeind agiert. Wer aber den Faschismus bekämpft, bekommt den repressiven Staat zu spüren. Welche Doppelmoral!
Wirkt das Bespitzeln in Ihren Alltag hinein?
Vorgeworfen wurde mir, dass ich bei Lesereisen aus dem Buch meines Vaters lese oder gegen die Bundeswehr aktiv bin: in teils geschwärzten Akten. Auf die Frage meines Anwalts, warum nicht alles offengelegt wird, hieß es: Zum Teil handele es sich um Informationen aus persönlichen Gesprächen. Bespitzelung erfolgte aus meinem Umfeld heraus. Warum gelten Schutzrechte für mich als Opfer der Verfolgung weniger als für etwaige Verfassungsschutzquellen? Ich lasse mich nicht einschüchtern, vom friedenspolitischen und antifaschistischen Engagement abhalten.
Die VVN-BdA fordert Hessens Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) auf, das Landesamt für Verfassungsschutz anzuweisen, das Bespitzeln von Antifaschisten einzustellen. Macht der Appell Sinn?
Ja. Denn wir fordern ihn öffentlich auf, sich zu positionieren. In all meinen Verfahren habe ich erlebt, dass der einzige Schutz eine demokratische Öffentlichkeit ist. Nur durch den öffentlichen Druck wurde ich als Lehrerin wieder eingestellt.
Quelle: junge Welt v.02.02.2024/ Klaus Rose/IMAGO Proteste gegen Berufsverbote: Familie Gingold mit Peter, Silvia und Ettie (Oldenburg, 12.11.1977)
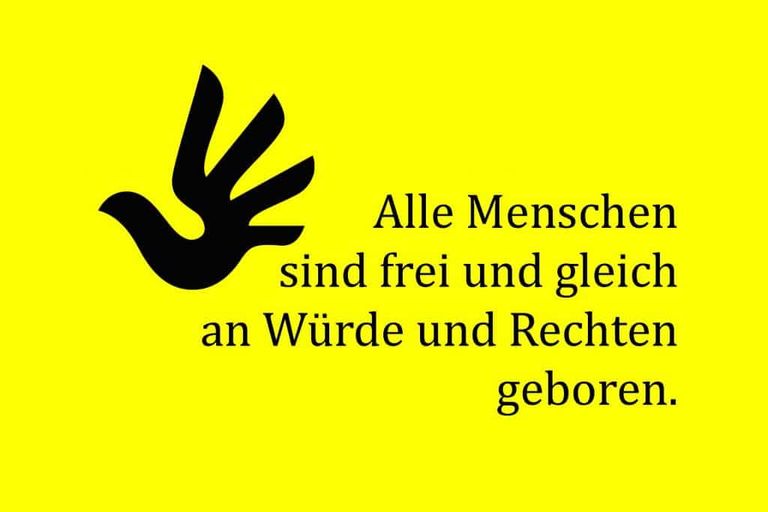
Kampf um die Menschenrechte
Exklusiv: Khiam – Israels Foltergefängnis im Südlibanon
1 Feb. 2024 12:22 Uhr
Das berüchtigte Gefängnis Khiam liegt nur rund vier Kilometer von der israelischen Grenze entfernt nahe der libanesischen Stadt Al-Khiam. Während des Krieges zwischen der Hisbollah und der IDF 2006 wurden schätzungsweise 5000 Menschen dort gefangen gehalten und gefoltert.
Vor kurzem wurden Details aus den geheimen Berichten veröffentlicht, die grausame Details ans Licht bringen. Israel bestreitet die im Gefängnis begangenen Verbrechen. Die Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" hingegen fordert, dass Israel zur Rechenschaft gezogen wird. Unser RT Korrespondent Yasin Eken berichtet aus dem Gefangenenlager in Khiam.
Quelle: RTd.v.01.02.2024/Quelle: RT

Kampf um die Menschenrechte - das Recht indigener Minderheiten
Yanomami erneut von Goldabbau bedroht
(Washington D.C., 22. Januar 2024, insight crime).- Erneut sind illegale Gold-Abbaustätten in den Gebieten der indigenen Yanomami in Brasilien entdeckt worden. Der Fund lässt an der Effektivität der Maßnahmen zweifeln, die die den illegalen Goldabbau 2023 stoppen sollten.
Lokalen Medienberichten zufolge haben Polizeieinheiten am 16. Januar die erste Operation 2024 gegen den illegalen Bergbau im Gebiet der Yanomami im nordbrasilianischen Bundesstaat Roraima durchgeführt. Obwohl die Polizei niemanden festnehmen konnte, entdeckte sie ein Bergbaucamp mitsamt schwerem Gerät, das die Flüchtigen gerade verlassen haben mussten. Nachdem die Beamt*innen die Ausrüstung beschlagnahmt hatten, verbrannten sie das Camp.
Diese Operation ist nur eine von vielen auf einer Liste der Aktionen gegen den illegalen Bergbau seit Luiz Inácio „Lula“ da Silva im Januar 2023 erneut Präsident Brasiliens geworden ist. Lulas Fokus liegt dabei insbesondere auf dem Territorium der Yanomami.
Das Schutzgebiet war jahrzehntelang wegen seiner reichen Goldvorkommen ein begehrtes Ziel für den illegalen Bergbau. Auch die Flusswege kommen den Kriminellen entgegen, denn sie erleichtern den Transport des Minerals aus den Minen heraus.
Illegaler Bergbau hat sich verlagert
Während seines Wahlkampfs hatte Präsident Lula versprochen, die Zerstörung des Amazonasgebietes zu stoppen. Zurück an der Macht startete er eine umfassende Kampagne zur Vertreibung der illegalen Bergleute, auch Garimpeiros genannt. Das hatte jedoch auch zur Folge, dass sich der Bergbau in Nachbarländer wie Venezuela und Guyana verlagerte.
Der anfängliche Erfolg seiner Kampagne gegen die Kriminalität verlor jedoch an Schwung. Nach jüngsten Operationsberichten, die von der Bundespolizei im Dezember veröffentlicht wurden, haben die Garimpeiros inzwischen ihre Aktivitäten im Gebiet der Yanomami wieder aufgenommen.
Lulas Strategie geht die Luft aus
Eine Analyse des Online-Mediums InSight Crime hat festgestellt, dass Lulas Operationen zunächst einen positiven Effekt im Yanomami-Gebiet hatten. Dennoch braucht es mehr bewaffnete Aktionen, um die Zerstörung des indigenen Schutzgebiets zu stoppen. Die rasante Verringerung von Bergbaustätten im Gebiet der Yanomami wurde als Erfolg von Lulas fokussierter Strategie gefeiert. Daten des polizeilichen Satellitensystems Operação Libertação, das das brasilianische Amazonasgebiet überwacht, bestätigen dies: Im April und Mai 2023 wurden lediglich 33 neue Minen entdeckt. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum 2022 waren es 538 neue Minen.
Dennoch zeigt sich nicht mal ein Jahr nach Beginn der Operationen, dass der illegale Bergbau zurück in der Region ist. Der Strategie Lulas geht die Luft aus. „Wenn der erste Notfall in den Yanomami-Gebieten behoben ist, zieht die Polizei ab und wird an anderen Orten eingesetzt. Denn das Amazonasgebiet ist gigantisch mit vielen Problemzonen“, so Melina Risso, Direktorin für Forschung am Institut Igarapé, einem brasilianischen Think-Tank mit Fokus auf Entwicklung, Sicherheit und Klima. „Mit dem Rückgang der Kontrollen werden die Garimpeiros in diesem riesigen Gebiet wieder aktiv“, fügt Risso hinzu.
Bergbau als Existenzgrundlage
Schon in der Vergangenheit hat InSight Crime auf die Schwächen dieses militaristischen Ansatzes hingewiesen. Er dient zwar dazu, das rasante Wachstum des Bergbaus einzudämmen, geht aber nicht auf die systematische Armut der in diesen Gebieten lebenden Menschen ein. Für diese ist der Bergbau nicht selten ihre einzige Existenzgrundlage.
Im Gebiet der Yanomami wird diese Problematik noch verstärkt durch die zunehmende Präsenz krimineller Gruppen wie dem PCC (Primeiro Comando da Capital). Diese erhöhen den Druck auf indigene Gemeinschaften und pumpen Geld in die illegalen Bergbau-Aktivitäten. „Um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen, muss es regelmäßige Kontrollen geben sowie eine permanente Präsenz der Behörden in den entsprechenden Gebieten“, so Risso.
Quelle: Nachrichtenpool Lateinamerika; Ausgabe Feb.2024/Illegales Camp zum Goldabbau in Brasilien. Foto: InSight Crime (CC BY-NC)
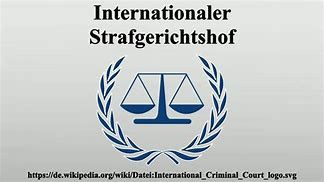
Kampf um die Einhaltung des Völkerrechts
Der Westen, der Süden und das Recht
Die IGH-Anordnung gegen Israel widerlegt die Behauptung Berlins, Südafrikas Klage entbehre „jeder Grundlage“, und bringt erstmals den Globalen Süden vor der Weltjustiz in die Offensive.
29
JAN
2024
DEN HAAG/BERLIN (Eigener Bericht) – Die Bundesregierung muss mit der einstweiligen Anordnung des Internationalen Gerichtshofs (IGH) in Den Haag im Genozidverfahren gegen Israel einen herben Schlag hinnehmen. Mitte Januar hatte sie offen behauptet, der gegen Tel Aviv erhobene „Vorwurf des Völkermords“ „entbehrt jeder Grundlage“. Der IGH hat jetzt Israel zu Maßnahmen verpflichtet, die deutlich machen, dass er konkrete Anhaltspunkte für genozidale Absichten und Handlungen erkennt. Käme er im Hauptverfahren zu dem Schluss, Israel habe sich tatsächlich genozidaler Aktivitäten schuldig gemacht, dann sähe sich Berlin dem Vorwurf ausgesetzt, es habe – etwa mit seinen Waffenlieferungen – Beihilfe dazu geleistet. Das IGH-Verfahren bringt schon heute gravierende Konsequenzen für Deutschland mit sich. Bislang konnte sich Berlin sicher sein, dass die internationale Justiz weitgehend im Sinne des Westens funktionierte; so wurden etwa vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) Verfahren ausschließlich gegen nichtwestliche Staaten eingeleitet, während die Kriegsverbrechen des Westens ohne Folgen blieben. Im aktuellen IGH-Verfahren gehen nun Staaten des Globalen Südens gegen Israel und seine westlichen Unterstützer vor.
Die Anordnung des IGH
Der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag, das höchste Gericht der Vereinten Nationen, hat am Freitag in einer einstweiligen Anordnung den Eilanträgen Südafrikas in dessen Genozidverfahren gegen Israel teilweise stattgegeben.[1] Eine sofortige Einstellung der Angriffe im Gazastreifen, wie Pretoria sie gefordert hatte, verlangt er nicht; doch hat er Israel aufgefordert sicherzustellen, dass seine Kriegführung keinen der Tatbestände erfüllt, die in Artikel II der Völkermord-Konvention als kennzeichnend für einen Genozid festgehalten sind. Damit hat die klare Mehrheit der IGH-Richter, so heißt es in einem Fachbeitrag, sehr „deutlich“ gemacht, dass es auf israelischer Seite zumindest „plausible Anhaltspunkte“ für genozidale Absichten oder Handlungen gibt.[2] Der IGH hat Israel mit seiner einstweiligen Anordnung zu sechs Maßnahmen verpflichtet. Insbesondere dringt er darauf, die Versorgungslage im Gazastreifen zu verbessern und jegliche öffentliche Anstachelung oder gar Aufforderung zum Genozid an den Palästinensern zu unterbinden respektive zu bestrafen. Letzteren beiden Anordnungen stimmte nicht zuletzt auch der von Israel entsandte Richter Aharon Barak zu. Israel muss nun innerhalb eines Monats einen Bericht vorlegen, in dem es sämtliche Maßnahmen zur Verhinderung eines Genozids dokumentiert.
„Ohne jede Grundlage“
Die einstweilige Anordnung des IGH ist ein herber Schlag für die Bundesregierung. Diese hatte am 12. Januar erklärt, sie weise den „gegen Israel erhobenen Vorwurf des Völkermords ... entschieden und ausdrücklich zurück“: „Dieser Vorwurf entbehrt jeder Grundlage“.[3] Dem IGH-Entscheid zufolge kann die Berliner Behauptung jetzt nicht mehr aufrechterhalten werden. Die Bundesregierung hatte zudem erklärt, sie „intendier[e], in der Hauptverhandlung als Drittpartei zu intervenieren“. Erfüllt Israel die vom IGH geforderten Maßnahmen nicht, dann geriete Berlin in eine Lage, in der es als Verteidiger womöglich genozidaler Aktivitäten aufträte. Tatsächlich räumt Außenministerin Annalena Baerbock jetzt offen ein, die vom IGH verlangten Schritte seien „völkerrechtlich verbindlich: Daran muss sich Israel halten.“[4] Davon abgesehen geht die Bundesregierung nicht nur mit der politischen Unterstützung für die israelische Kriegführung, sondern auch mit der Lieferung von Waffen und Munition [5] ein erhebliches Risiko ein. Käme der IGH in seiner Hauptverhandlung, die sich allerdings über Jahre hinziehen kann, zu dem Ergebnis, es seien einer oder gar mehrere Tatbestände für einen Genozid erfüllt, dann hätte die Bundesregierung Beihilfe zum Völkermord geleistet. Der politische Schaden für Berlin, das sich stets als Vorreiter in Sachen Völkerrecht inszeniert, wäre enorm.
Der „Afrika-Gerichtshof“
Dabei bringt das IGH-Verfahren bereits per se weitreichende Konsequenzen für Berlin mit sich. Lange Zeit konnten sich die Bundesrepublik und die anderen westlichen Staaten darauf verlassen, dass die internationale Justiz für ihre politischen Zwecke nutzbar war. Ein Beispiel bot der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag, der seit Beginn seiner Arbeit zum 1. Juli 2002 über viele Jahre hin lediglich Verfahren gegen Bürger afrikanischer Staaten eröffnete, die dem Westen politisch nicht zu Willen waren. Auf dem Kontinent wurde der IStGH deshalb als „Afrika-Gerichtshof“ verspottet. Im Jahr 2016 kündigten mehrere Staaten Afrikas, darunter Südafrika, ihre Trennung von ihm an (german-foreign-policy.com berichtete [6]). Südafrika machte diesen Schritt wenig später rückgängig. Um dem Vorwurf einseitigen Vorgehens zu entkommen, leitete der IStGH ab 2016 reguläre Ermittlungen auch gegen Bürger ausgewählter nicht-afrikanischer Staaten ein, darunter Georgien, Venezuela und Myanmar; diese teilten allerdings die Eigenschaft, dass ihre Regierungen vom Westen klar abgelehnt wurden. Zuletzt hat der IStGH am 17. März einen Haftbefehl gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin erlassen, dem er die gezielte Verschleppung ukrainischer Kinder vorwirft.[7] Der Haftbefehl schränkt Putins Reisemöglichkeiten erheblich ein.
Folgenlose Verbrechen
Das Vorgehen des IStGH gegen dem Westen missliebige Staaten kontrastiert scharf damit, dass der Gerichtshof gegen Bürger westlicher Staaten untätig bleibt. Einen Versuch, dies zu durchbrechen, unternahm die damalige IStGH-Chefanklägerin Fatou Bensouda Ende 2017, als sie beantragte, Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen in Afghanistan aufnehmen zu dürfen, darunter soche, die von US-Militärs und der CIA begangen wurden.[8] Der Versuch scheiterte: Washington kündigte an, es werde Ermittlungen des Gerichtshofs nicht zulassen; am 11. Juni 2020 gab US-Präsident Donald Trump Sanktionen gegen Bensouda und einen weiteren Funktionär des IStGH bekannt, die am 2. September 2020 in Kraft traten.[9] Auch mit anderen internationalen Gerichtshöfen gibt es ähnliche Erfahrungen. Ein Beispiel bietet der Streit um die Chagos-Inseln im Indischen Ozean, die Großbritannien bis heute unter Kontrolle hält, um den Vereinigten Staaten den Unterhalt ihres Militärstützpunktes Diego Garcia zu ermöglichen (german-foreign-policy.com berichtete [10]). Der IGH forderte Großbritannien am 25. Februar 2019 in einem Gutachten dazu auf, die Inseln „so rasch wie möglich“ an ihren rechtmäßigen Besitzer Mauritius zurückzugeben. Der Internationale Seegerichtshof der Vereinten Nationen (ISGH) in Hamburg schloss sich dem am 28. Januar 2021 in einem rechtsverbindlichen Urteil an. London verweigert sich bis heute.
Die Wende
Das aktuelle IGH-Verfahren sowie weitere Verfahren vor dem IStGH gegen Israel wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen scheinen strukturell eine Wende zu bringen. Die Verfahren werden sämtlich von Staaten des Globalen Südens angestrengt, die bislang stets damit rechnen mussten, vom Westen vor internationale Gerichtshöfe gezerrt zu werden. Gleichzeitig richten sie sich implizit auch gegen Israels westliche Unterstützer. Das IGH-Genozidverfahren selbst wurde von Südafrika angestrengt; es wird von anderen Ländern des Globalen Südens, darunter Brasilien, Namibia und Malaysia, zudem von der Organization of Islamic Cooperation (OIC) und der Arabischen Liga unterstützt. Verfahren gegen Israel wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen vor dem IStGH wurden inzwischen von Mexiko und von Chile initiiert. Berechnungen zeigen, dass die Länder, die sich in der einen oder anderen Form hinter die Verfahren gestellt haben – es ist die überwiegende Mehrheit der Staaten Asiens, Afrikas und Lateinamerikas –, für 59 Prozent der Bevölkerung des Globalen Südens stehen.[11] Dass es nicht mehr sind, liegt vor allem daran, dass die zwei Länder mit der größten Bevölkerung, Indien und China, sich nicht offiziell positioniert haben. Zum ersten Mal erheben sich damit bedeutende Teile des Globalen Südens geschlossen und im großen Stil vor internationalen Gerichten gegen die tradierte globale Dominanz des Westens.
[1], [2] Max Kolter: IGH verpflichtet Israel zu präventiven Sofortmaßnahmen
[3] Erklärung der Bundesregierung zur Verhandlung am Internationalen Gerichtshof. bundesregierung.de 12.01.2024.
[4] Außenministerin Annalena Baerbock zur IGH-Entscheidung im einstweiligen Rechtsschutzverfahren Südafrika v. Israel. auswaertiges-amt.de 26.01.2024.
[5] S. dazu Waffen für Israel und Waffen für Israel (II).
[6] S. dazu Das Recht der Macht.
[7] Haftbefehl gegen Putin erlassen. tagesschau.de 17.03.2023.
[8] Afghanistan and the International Criminal Court. hrw.org 20.11.2017.
[9] US Sanctions on the International Criminal Court. hrw.org 14.12.2020. S. auch Der Club der Kriegsverbrecher.
[10] S. dazu Illegal besetzte Inseln (II).
[11] Sarang Shidore, Dan M. Ford: Mapping it: Global South states charging war crimes in Gaza war. responsiblestatecraft.org 24.01.2024.
Quelle: german foreign-policy.com 29.01.2024
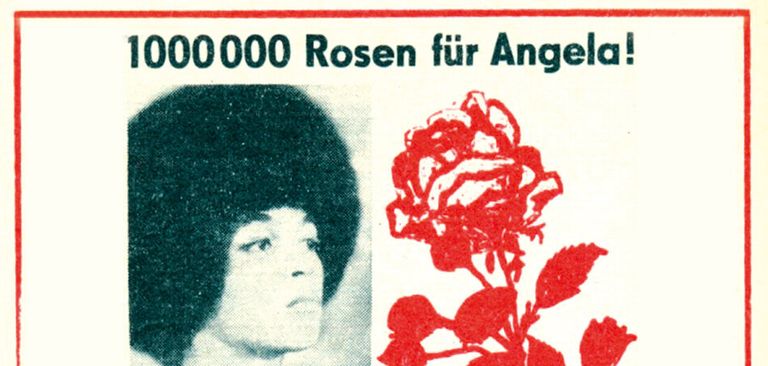
Kampf um Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 27.01.2024, Seite 11 / Feuilleton
IKONE DES WIDERSTANDS
Rosen für Angela
Von Nick Brauns
Am 26. Januar 1971 starten die Freie Deutsche Jugend und die Junge Welt die Kampagne »Eine Million Rosen für Angela Davis« zum 27. Geburtstag der Kommunistin. Die Philosophiedozentin war mit dem konstruierten Vorwurf der Terrorunterstützung inhaftiert worden. Ihr drohte unter Kaliforniens Gouverneur Ronald Reagan die Todesstrafe. Nicht nur aus der DDR trafen körbeweise Postkarten im Gefängnis ein, weltweit kämpften Millionen für die junge Afroamerikanerin. Mit Erfolg. Davis wurde 1972 in allen Anklagepunkten freigesprochen.
Die erfahrene Solidarität war für ihr politisches Leben ebenso prägend wie die Erfahrung rassistischen Terrors durch den Ku-Klux-Klan und Apartheid in ihrer Kindheit in Alabama. Nach kurzer Mitgliedschaft bei den Black Panthers trat sie 1968 der kommunistischen Partei bei. Anstatt Identitäts- gegen Klassenpolitik zu stellen, zeigte sie in ihrem Buch »Women, Race & Class« (1981) den Zusammenhang zwischen verschiedenen Unterdrückungs- und Ausbeutungsformen auf und plädierte für entsprechende politische Koalitionen.
Bis heute ist Angela Davis politisch aktiv – etwa gegen das Gefängnissystem, in der »Black Lives Matter«-Bewegung und für die Freiheit von Palästina. Am Freitag ist sie 80 Jahre alt geworden. Junge Welt gratuliert und wünscht noch viele gesunde und kämpferische Jahre.
Quelle: junge Welt v.27.01.2024/ jW Archiv

BRD - Verstoß gegen Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 22.01.2024, Seite 8 / Inland
OPFER DES KAPITALISMUS
»Der Staat stellt viel zu wenige Ressourcen zur Verfügung«
Nicht nur im Winter ist das Leben auf der Straße gefährlich. Ein Gespräch mit Stephan Nagel
Interview: Kristian Stemmler
Stephan Nagel ist Referent für Wohnungslosen-, Suchtkrankenhilfe und Armut beim Diakonischen Werk Hamburg
In Hamburg sind in diesem Winter bereits vier obdachlose Menschen auf der Straße gestorben. Was wissen Sie über die Todesfälle und welche Rolle spielte dabei die Kälte?
Obdachlos auf der Straße zu leben, ist sehr gefährlich und gesundheitsgefährdend – nicht nur im Winter. Die meisten obdachlosen Menschen, die auf der Straße versterben, sterben nicht an Unterkühlung, oft sterben sie an behandelbaren Krankheiten. Über die Umstände und Ursachen der vier Todesfälle haben wir keine Kenntnisse.
In jedem Winter erfrieren Obdachlose. Warum müssen überhaupt Menschen in einer reichen Stadt wie Hamburg die Nacht auf der Straße verbringen?
Armut, der Mangel an erschwinglichen Wohnungen, Diskriminierung vieler Gruppen beim Zugang zu Wohnungen sind hier zu nennen – aber auch der Ausschluss von Sozialleistungen und der öffentlich-rechtlichen Unterbringung durch entwürdigende respektive überfordernde Verfahren oder per Gesetz, etwa bei vielen EU-Bürgern.
Angesichts der zunehmenden Wohnungsnot und der sehr stark ansteigenden Wohnungslosigkeit stellt der Staat viel zu wenige Ressourcen zur Verfügung: Das betrifft Wohnungen, die für Notfälle reserviert sind, menschenwürdige vorübergehende Unterbringung und unterstützende soziale Dienste. Im Ergebnis bleiben die Schwächsten auf der Strecke, und viele landen in der Obdachlosigkeit.
Das Winternotprogramm der Stadt soll einen Erfrierungsschutz bieten. Warum wird es von manchen nicht angenommen? Und welche Kritik haben Sie an dem Programm?
Mangelnde Privatsphäre, fehlende Ruhe und Angst vor Gewalt und Diebstahl: Das sind knapp zusammengefasst die Hauptgründe, warum obdachlose Menschen vorhandene Unterkünfte nicht nutzen, das wissen wir aus vielen Befragungen obdachloser Menschen und wissenschaftlichen Studien. Die Lösungen liegen also auf der Hand: statt großer Unterkünfte kleine, dezentral gelegene Angebote mit Einzelzimmerunterbringung für eine geschützte Privatsphäre. Und natürlich möglichst schnell die Vermittlung in Wohnungen und das Angebot sozialer Unterstützung, wenn der Bedarf besteht. Und bezogen auf den Erfrierungsschutz fordern wir seit langem eine ganztägige Öffnung des Winternotprogramms.
Welche Angebote gibt es für obdachlose Menschen in der kalten Jahreszeit sonst noch, etwa von der Diakonie?
Die meisten Angebote der Freien Wohlfahrtspflege laufen das ganze Jahr, etwa Beratungsstellen, Tagesaufenthaltsstätten, in Hamburg der Mitternachtsbus und weiteres.
Wie können Passanten helfen?
Sie können die obdachlosen Menschen ansprechen und Hilfe anbieten. Im Notfall sollte ein Rettungswagen gerufen werden.
Wie müsste ein Konzept aussehen, das so einladend ist, dass es die Obdachlosen zumindest nachts von der Straße holt?
Es müssten ausreichend Unterkünfte mit Einzelzimmern geschaffen werden, die für alle voraussetzungslos zugänglich sind und nicht nur nachts, sondern den Tag über den obdachlosen Menschen zur Verfügung stehen. Es reicht nicht, obdachlose Menschen »zumindest nachts von der Straße« zu holen. Es geht darum, Obdach- und Wohnungslosigkeit zu überwinden. Dieses Ziel hat ja die Bundesregierung in ihren Koalitionsvertrag geschrieben: Überwindung der Obdach- und Wohnungslosigkeit bis zum Jahr 2030. Das ist ein ambitioniertes, aber erreichbares Ziel. Es hapert jedoch am politischen Willen, genügend Ressourcen für die nötigen Maßnahmen zur Verfügung zu stellen und die nötigen Reformen für eine Wende hin zu einer sozialen Wohnungspolitik in Angriff zu nehmen.
Noch in diesem Frühjahr will die Bundesregierung einen »Nationalen Aktionsplan« zur Überwindung der Obdach- und Wohnungslosigkeit bis 2030 veröffentlichen. Das, was bisher darüber bekanntgeworden ist, ist völlig unzureichend, um dieses Ziel zu erreichen. Es bleibt also weiterhin notwendig, politischen Druck für eine bessere Politik gegen Wohnungslosigkeit aufzubauen, und dabei sind die wohnungslosen Menschen auf die Solidarität anderer angewiesen.
Quelle: junge Welt v.22.01.2024/ Hanno Bode/IMAGOWohnungslosen wird ein würdevolles Leben verwehrt (Hamburg, 13.12.2022)

Völker ohne Recht
Donnerstag, 18. Januar 2024, 16:00 Uhr
~7 Minuten Lesezeit
Völker ohne Recht
Nach der Einhaltung der völkerrechtlichen Spielregeln schreien die am lautesten, die sie zugleich am ungeniertesten brechen.
Foto: Brian A Jackson/Shutterstock.com
Die Russen brechen das Völkerrecht, beschweren sich diejenigen, die es sonst auch nicht einhalten. Schöne Sachen stehen da im Völkerrecht zu lesen: Angriffskriege seien verboten, zum Beispiel. Verbotene Sachen werden aber erst recht gemacht, vor allem dann, wenn man dafür nicht bestraft wird. Und wer sollte schon einen mächtigen und hoch gerüsteten Staat und seine Regierung vor irgendein Gericht stellen? Welche Polizei will man etwa nach Washington schicken, und wer soll diesen Haftbefehl ausstellen? Und wer traut sich, Präsident Putin zu verhaften? Richtig: niemand. Eben deshalb, weil niemand es kann. In Wirklichkeit gilt nämlich nicht der Wortlaut irgendwelcher Paragrafen, sondern vielmehr entscheiden Macht, Militär und Waffen, wer was durchsetzen kann und wer was erleiden muss.
von Patrick Münch
Staat als Ursache für Krieg
Man fragt sich, warum man diese einfache Wahrheit, die man jeden Tag betrachten kann, nicht einfach anerkennt. Stattdessen wird mit größter Verdrängungsleistung darauf beharrt, dass sich alle an das Völkerrecht halten müssen. Dabei sehen alle, die es können und wollen, dass das Völkerrecht für mächtige Staaten grundsätzlich nicht gilt.
Wäre es nicht vernünftiger, wenn man denn für ein friedliches Zusammenleben der Menschen ist, die Ursachen für die Kriege ins Auge zu fassen? Nach der Analyse könnte man dann die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern, die zu Gewalt und Massenmord führen. Was sind also die Ursachen für die Gewalt, die wir täglich beobachten?
Zunächst braucht man für einen Krieg sehr viele Waffen und auch Soldaten. Es hat sich in der Geschichte eine Organisation als sehr zweckdienlich dafür herausgestellt: der Staat. Seit es Staaten gibt, führen diese Kriege gegen andere Staaten. Wer einen Krieg gewinnt, der setzt sich ins Recht gegenüber dem Verlierer. Die USA führen einen Krieg gegen den Irak und kümmern sich nicht weiter um rechtliche Details. Die Verlierer haben ein zerstörtes Land und können keine Rechtsmittel einlegen.
Kein Recht ohne Polizei
Das mit dem Recht ist nämlich so eine Sache: Man kann es nur durchsetzen, wenn man auch über die notwendigen Machtmittel verfügt. Im Inneren eines Staates sind das die Polizei und die Gerichte. Über den Staaten kann man vielleicht Gerichte einsetzen und die Verlierer dort aburteilen. Die Gewinner eines Krieges stehen aber nie vor Gericht, sei der gewonnene Krieg noch so völkerrechtswidrig.
Das liegt an der einfachen Tatsache, dass es keine Polizei gibt, die über den Staaten steht. Eine Polizei gibt es nur in einem Staat, aber nicht über dem Staat. Die Voraussetzung für Polizei ist ein Staat, aber einen Staat über den Staaten gibt es nicht und kann es auch nicht geben. Damit ist erklärt, dass ein Beharren auf Einhaltung des Völkerrechts sinnlos ist, weil es eben die Polizei zur Durchsetzung dieses Rechts einfach nicht gibt.
Was es aber tatsächlich gibt, sind Staaten mit Armeen, die ihre Interessen mit Gewalt durchsetzen. Das Interesse des Staates USA ist, die NATO auf die ganze Welt auszuweiten, weil der Staat USA die Welt beherrschen will. Das Interesse des Staates Russland besteht darin, nicht von den USA beherrscht zu werden. Das Interesse des Staates Ukraine spielt keine Rolle, und Hunderttausende tote Menschen interessieren keinen.
Also zurück zu den Ursachen. Der Staat als Machtapparat verfügt über Gewaltmittel, die er gegen andere Staaten anwendet. Das Völkerrecht interessiert den Staat nicht, der genug Waffen und Soldaten hat. Logisch gedacht ist eine friedliche Welt nur ohne Staaten möglich. Die Auflösung und Überwindung des Staates in einer besseren Form der Vergesellschaftung ist die Bedingung für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen.
Staat als Form der Vergesellschaftung …
Nun hat sich der moderne Staat in der Geschichte als Form der Vergesellschaftung entwickelt, und es spricht kein rationales Argument dagegen, dass diese Form nicht zu einer anderen weiterentwickelt werden könnte. Wie diese zukünftige Form beschaffen und zu gestalten wäre, ist die Aufgabe aller progressiv denkenden und handelnden Menschen, nicht das sinn- und wirkungslose Beharren auf verdinglichten Rechtsgrundsätzen, die keinen Bezug zur Wirklichkeit haben.
Grundlage jeder menschlichen Vergesellschaftung ist die Arbeit. Aus ihr heraus entstehen alle Dinge, die für das menschliche Leben notwendig sind. Durch Arbeit entsteht die Gesellschaft und wird durch sie in einem ständigen Prozess erneuert. Der arbeitende Mensch schafft also durch seine Tätigkeit seine Gesellschaft und wird so vom Individuum zum gesellschaftlichen Wesen.
Wenn also die Arbeit die Grundlage der menschlichen Vergesellschaftung darstellt, dann ist die Arbeit der Schlüssel zur Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Indem die Organisation der Arbeit verändert wird, verändert sich die Organisation der Gesellschaft.
Die heute dominierende gesellschaftliche Organisation ist der Staat als Machtapparat, ausgestattet mit Gewaltmitteln nach innen, gerichtet gegen die eigene Bevölkerung, und nach außen, gerichtet gegen die Bevölkerungen anderer Staaten.
Wir müssen mitansehen, welche Konsequenzen das für den Teil der Bevölkerung des Staates Israel hat, den dieser Staat loswerden will. Wir sehen auch, wie der Staat Ukraine seine Bevölkerung als Kanonenfutter im Krieg gegen den russischen Staat behandelt. Das Beharren auf der Einhaltung des humanitären Völkerrechts erscheint bei den oben genannten Beispielen als reiner Zynismus.
... und Alternativen
Die oben beschriebenen Zustände werden von denjenigen herbeigeführt, die ein Interesse an ihnen haben. Doch wer hat ein Interesse an der Zerstörung von Gesellschaften und der Vernichtung ihrer Bevölkerung? Und wer verfügt über die Mittel, Derartiges zu tun? Die Antwort ist oben bereits gegeben: der Staat und diejenigen, die die Macht in ihm ausüben. Auch ist gesagt worden, dass diese Zustände veränderbar sind. Sich auf ein Recht zu berufen, das nur von Staaten durchgesetzt werden kann, steht im Widerspruch dazu, dass es keinen Staat über den Staaten gibt und so also auch keine Polizei, die über den Staaten existiert.
Die Vergesellschaftung in der Form des Staates kann entwickelt und überwunden werden in einer besseren Form der gesellschaftlichen Organisation. Wenn Arbeit der Schlüssel für diese Aufgabenstellung ist, dann sollte sich die politische Stoßrichtung konzentrieren auf die Bereiche der Gesellschaft, in denen diese Arbeit jeden Tag getan wird.
In der heutigen kapitalistischen Gesellschaft hat sich die Mehrheit der arbeitenden Menschen in einem Vertrag dazu bereit erklärt, ein bestimmtes Pensum an Arbeitskraft an den Käufer zu verkaufen, gegen einen vertraglich vereinbarten Betrag in der gängigen Geldwährung. Vertraglich vereinbart ist auch, dass der Käufer der Arbeitsleistung bestimmt, was getan wird und für welchen Zweck. Der Verkäufer hat hier nichts zu melden!
Hier ist nun der Knackpunkt.
Wenn tatsächlich Menschen der Ansicht sind, Kriege und Massenmorde seien falsch — und es gibt viele, die das denken —, dann liegt die Handlungsfähigkeit dieser Menschen in ihrer Entscheidung, dort, wo sie arbeiten, jede Tätigkeit zu unterlassen, die Krieg und Massenmord ermöglichen.
Das sind viele Bereiche der Gesellschaft, nicht nur in der Rüstungsindustrie. Auch in der Verwaltung, den Behörden, den Ministerien gibt es die Möglichkeit, Handlungen nicht zu unterstützen, die zu den oben genannten Konsequenzen führen. Rüstungsgüter müssen transportiert werden mit Transportmitteln, die von Menschen betrieben werden. Wenn diese Menschen entscheiden, dass ein solcher Transport nicht stattfindet, steht jeder Krieg still.
Viele Möglichkeiten bieten sich den Menschen, die gegen Krieg und Zerstörung sind, an ihrem Arbeitsplatz. Dort sind sie es nämlich, die alle Tätigkeiten ausführen, die für den reibungslosen Betrieb der Gesellschaft notwendig sind. Und sie sind es auch, die diesen Betrieb unterbrechen können. Wir sehen, welche gesellschaftliche Bedeutung ein Streik der Lokführer hat. Welche Bedeutung hätte ein Streik aller, die sich weigern, für Krieg und Massenmord zu arbeiten?
Eine friedliche Welt ist möglich
Die Überwindung der jetzigen Form der Vergesellschaftung in der Gestalt des Staates als Machtapparat, mit der Ausübung von Gewalt gegen die eigene Bevölkerung durch die Polizei und gegen die Bevölkerung anderer Staaten durch das Militär, ist möglich. Weil der moderne Staat der jetzige Zustand einer geschichtlichen Entwicklung ist, ist er in seiner heutigen Form bereits Vergangenheit, das heißt, seine zukünftige Form ist schon in ihm angelegt und wartet darauf, in Erscheinung zu treten.
Es ist an den Menschen selbst, wie diese zukünftige Form gestaltet sein soll. Durch Arbeit wird die Gesellschaft geformt und gestaltet. Das heißt, dass diejenigen, die diese Arbeit jeden Tag an ihrem Arbeitsplatz leisten, die Gesellschaft durch ihre Tätigkeit aufrechterhalten. Heute arbeiten die meisten fremdbestimmt und müssen den Anweisungen des Vorgesetzten Folge leisten, wie es so schön heißt.
Und dennoch: Wenn der Zweck von Arbeit die Unterstützung von Krieg und Massenmord ist, dann kann jeder entscheiden, ob er sich an seinem Arbeitsplatz durch Mitmachen daran beteiligen will oder ob es Möglichkeiten gibt, dies nicht zu tun. Widerstand ist in vielen Bereichen möglich, und jeder Einzelne kann sich entscheiden, ob er durch sein Verhalten zu Zerstörung und Vernichtung beitragen oder ob er gemeinsam mit anderen für eine bessere und friedliche Zukunft arbeiten will. Diese Zukunft beginnt heute!
Quelle: Patrick Münch, Jahrgang 1969, arbeitet seit vielen Jahren als prekär beschäftigte Lehrkraft in Maßnahmen des Jobcenters und hat auf diese Weise das System der Menschenverwaltung von innen kennengelernt. Die herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse erkennt er als falsch. Ihre Veränderung hält er für möglich.

Verstoß gegen Menschenrechte in BRD
Aus: Ausgabe vom 22.01.2024, Seite 1 / Inland
ALTERSARMUT
42 Prozent der Rentner arm
Mehrheit aller Rentnerinnen hat weniger als 1.250 Euro im Monat. Jeder vierte Senior unter 1.000 Euro
Von Susanne Knütter
Mehr als sieben Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland müssen monatlich mit weniger als 1.250 Euro netto auskommen. Das sind mehr als 42 Prozent aller Rentenempfänger im Land, wie aus einer Berechnung des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, die auf eine Anfrage des Abgeordneten Dietmar Bartsch von Die Linke zurückgeht. Mehr als fünf Millionen der Betroffenen sind demnach Frauen und damit 53 Prozent aller Rentnerinnen in Deutschland.
Auf weniger als 1.000 Euro im Monat kommt der Berechnung zufolge etwa jeder vierte Rentenempfänger. Die durchschnittliche Bruttorente hierzulande lag laut Rentenatlas 2023 der Deutschen Rentenversicherung im Jahr 2022 bei 1.728 Euro bei den Männern und 1.316 Euro bei den Frauen.
Bartsch sprach angesichts der Zahlen von einem »Armutszeugnis für unser Land«. Die Rentnerinnen und Rentner seien die »Hauptverlierer der Inflation«, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das am Sonntag zuerst aus der Erhebung zitierte. »Wir brauchen in diesem Jahr eine einmalige und zusätzliche Rentenerhöhung um zehn Prozent, um zumindest die Inflation auszugleichen«, sagte er.
Die Bundesregierung hat das nicht vor. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte am Samstag lediglich erklärt, das seit Monaten angekündigte Paket, mit dem die Rente »stabilisiert« und das Rentenniveau »abgesichert« werden soll, bald auf den Weg bringen zu wollen. Geplant ist, das Rentenniveau von 48 Prozent im Verhältnis zu den Löhnen langfristig zu sichern. Derzeit gilt diese sogenannte Haltelinie für das Absicherungsniveau der gesetzlichen Rente bis 2025.
Die Landesarmutskonferenz (LAK) Niedersachsen wies darauf hin, dass 1.250 Euro exakt die Grenze für Einkommensarmut einer alleinlebenden Person im Jahr 2022 war. Auch wenn viele Rentner zusätzliche Einkünfte – etwa durch prekäre Minijobs – hätten, nehme die Altersarmut überdurchschnittlich zu. Ein mittlerweile alltäglicher Anblick seien Senioren, die in Abfallkörben nach Flaschen suchen oder bei den Tafeln Schlange stehen.
Quelle: junge Welt v.22.01.2024/ Wolfgang Maria Weber/IMAGO Die Kosten steigen, aber ihr Einkommen nicht. Selbst ein Inflationsausgleich ist für sie nicht vorgesehen: Rentner

USA - Verstoß gegen Völkerrecht
Donnerstag, 18. Januar 2024, 17:00 Uhr
~5 Minuten Lesezeit
Moralischer Schall und Rauch
Die Angriffe auf Huthi-Stellungen im Jemen, die die USA mit einigen Verbündeten geflogen sind, entlarven endgültig deren wohlklingende Rechtfertigungsnarrative.
Foto: Bartosz Nitkiewicz/Shutterstock.com
Wenn schon sterben, dann wenigstens „regelbasiert“. Ob es für die Menschen im Jemen, die Angehörige verloren haben, wohl ein Trost war, dass Präsident Biden die Militärschläge nur ungern und zögerlich angeordnet hat und dass sie aus einem „guten Grund“ erfolgten: den vorausgehenden Attacken von Huthi-Rebellen auf internationale Schiffe im Roten Meer? Es mag ja noch verständlich sein, dass Biden und seine Mitstreiter für ihr Handeln allerlei moralische Gründe anzuführen versuchen. Wirklich erschütternd ist aber, dass die Weltpresse sich dem überwiegend kritiklos anschloss. Unerwähnt bleibt meist, dass die Huthi-Milizen ihre Angriffe als Reaktion auf das Massaker der israelischen Armee in Gaza betrachten beziehungsweise als Versuch, dessen Beendigung zu erzwingen. Auf Israel in diesem Sinne einzuwirken haben die USA und ihre Verbündeten aber offenbar nicht im Kreuz. Damit ist die Ausweitung des Konflikts bis hin zu einem möglichen Flächenbrand einen großen Schritt weitergekommen.
von Norman Solomon
Haben Sie schon den (Witz) über die US-Regierung gehört, die eine „regelbasierte internationale Ordnung“ will?
Es ist erschütternd lachhaft, aber die Medienkanäle des Landes nehmen solche Behauptungen routinemäßig ernst. Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass Spitzenbeamte in Washington ihr Land nicht gerne und nur als letzten Ausweg in den Krieg schicken.
Es war das typische Framing, als die New York Times folgenden Satz ganz oben auf der Titelseite druckte:
„Die Vereinigten Staaten und eine Handvoll ihrer Verbündeten führten am Donnerstag Militärangriffe gegen mehr als ein Dutzend Ziele im Jemen aus, die von der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz kontrolliert werden. Dies sei, so US-Beamte, in einer Ausweitung des Kriegs im Nahen Osten erfolgt, den die Biden-Regierung drei Monate lang zu vermeiden versucht hatte.“
Von Anfang an also stellte die Berichterstattung den von den USA geführten Angriff als eine widerstrebend ausgeführte Aktion dar — nachdem alle friedlichen Optionen fehlgeschlagen waren, und nicht als einen aggressiven Akt gegen das Völkerrecht.
Am Donnerstag gab Präsident Biden eine rechtschaffen klingende Erklärung ab:
„Diese Angriffe sind eine direkte Antwort auf beispiellose Angriffe der Huthis auf internationale Schiffe im Roten Meer.“ Er erwähnte nicht, dass die Angriffe der Huthis in Reaktion auf Israels mörderische Belagerung Gaza’s erfolgten. Laut CNN „könnten sie beabsichtigen, Israels Verbündeten wirtschaftlichen Schaden zuzufügen — in der Hoffnung, dass diese dann Israel unter Druck setzen, die Bombardierung der Enklave zu beenden.“
Wie Common Dreams berichtet, haben Huthi-Kräfte in der Tat „begonnen, in Reaktion auf Israels Angriff auf Gaza Raketen und Drohnen auf Israel abzuwerfen und den Schiffsverkehr im Roten Meer anzugreifen.“ Und wie Trita Parsi vom Quincy Institute betonte, „haben die Huthis erklärt, dass sie damit aufhören werden“, Schiffe im Roten Meer anzugreifen, „wenn Israel“ das Massenmorden in Gaza „beendet“.
Dies würde jedoch echte Diplomatie erfordern — eine Lösung, die weder Präsident Biden noch Außenminister Blinken zusagt. Das Duo macht seit Jahrzehnten gemeinsame Sache und hinter ihrer hochtrabenden Rhetorik verbirgt sich das stillschweigende Prinzip, dass Macht das Recht schafft.
Von diesem Prinzip wurde Mitte 2002 stillschweigend ausgegangen, als der damalige Senator Biden den Anhörungen des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen vorsaß, der für die Unterstützung der USA bei der Invasion des Iraks warb — Blinken war damals Stabschef des Ausschusses.
Nun, da er dem Außenministerium vorsteht, propagiert Blinken gerne die Notwendigkeit einer „regelbasierten internationalen Ordnung“. Während einer Rede in Washington im Jahr 2022 verkündete er die Notwendigkeit, „die Beziehungen zwischen den Staaten zu regeln, Konflikte zu vermeiden und die Rechte aller Menschen zu wahren“. Vor zwei Monaten erklärte er, dass die G7-Staaten geeint für „eine regelbasierte internationale Ordnung“ einträten.
Seit mehr als drei Monaten jedoch unterstützt Blinken das anhaltende methodische Morden palästinensischer Zivilisten in Gaza mit einem kontinuierlichen Strom oberflächlicher Rhetorik. Vor ein paar Tagen verteidigte er — trotz ausgiebiger Beweise einer genozidalen Kriegsführung — auf einem Podium der US-Botschaft in Israel eben dieses Land und behauptete: „Der Vorwurf des Völkermordes ist unbegründet.“
Die Huthis sind erklärtermaßen mit dem palästinensischen Volk solidarisch, während die US-Regierung weiterhin das israelische Militär, das Zivilisten massakriert und Gaza systematisch zerstört, mit Waffen aufrüstet. Blinken ist so tief in die Orwell´schen Botschaften verstrickt, dass er mehrere Wochen nach Beginn des Abschlachtens twitterte, die Vereinigten Staaten und ihre G7-Partner stünden „vereint in unserer Verurteilung des russischen Kriegs in der Ukraine, in unserer Unterstützung von Israels Recht zur Selbstverteidigung gemäß dem Völkerrecht und in der Aufrechterhaltung einer regelbasierten internationalen Ordnung“.
Dass die Verantwortlichen der US-Außenpolitik der Öffentlichkeit ein extremes Doppeldenken aufnötigen, ist nichts Ungewöhnliches. Was sie betreiben, ist ein gutes Beispiel für das Doppeldenken in George Orwells Roman „1984“:
„Zu wissen und nicht zu wissen; sich der absoluten Wahrheit bewusst zu sein und gleichzeitig sorgfältig konstruierte Lügen zu erzählen; gleichzeitig zwei Meinungen zu haben, die sich aufheben und von denen man weiß, dass sie sich widersprechen, und an beide zu glauben; Logik gegen Logik auszuspielen; Moral abzulehnen und sie gleichzeitig für sich zu beanspruchen …“
Nach Bekanntwerden der Angriffe auf den Jemen äußerten sich einige Demokraten und Republikaner im Repräsentantenhaus gegen Bidens unverhohlenen Verstoß gegen die Verfassung, bei dem er den Kongress umging und auf eigene Faust in den Krieg zog. Manche der Kommentare waren lobenswert deutlich; am deutlichsten jedoch war wohl eine Erklärung des Kandidaten Joe Biden am 6. Januar 2020:
„Ein Präsident sollte diese Nation niemals ohne die informierte Zustimmung der US-Bevölkerung in den Krieg führen.“
Genau wie diese Wegwerfplattitüde ist auch der ganz Orwell’sche Unsinn, den die Spitze der US-Regierung über das Streben nach einer „regelbasierten internationalen Ordnung“ von sich gibt, nichts als ein dreister PR-Schwindel.
Die ganzen derzeitigen offiziellen Vernebelungsaktionen können nicht über die Realität hinwegtäuschen, dass die US-Regierung die mächtigste und gefährlichste Banditenregierung der Welt ist.
Quelle:
Redaktionelle Anmerkung: Dieser Text erschien zuerst unter dem Titel „With Attack on Yemen, the U.S. is Shameless: ‘We Make the Rules, We Break the Rules’“ bei CounterPunch. Er wurde von Gabriele Herb ehrenamtlich übersetzt und vom ehrenamtlichen Manova-Korrektoratteam lektoriert.
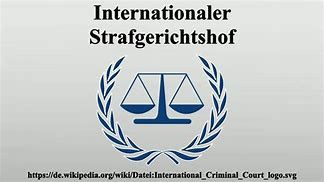
17.01.
2024
Anklage gegen Israel wegen Völkermord
Sehr geehrte Besucher,
wir möchten Ihnen die Gelegenheit geben, sich über den Verlauf an den Den Haager Verhandlungen der Klage Südafrikas gegen Israel wegen Völkermords zu informieren, hier ein Link zu den Videos aus dem Internationalen Gerichtshof vom 11. und 12. Dezember:

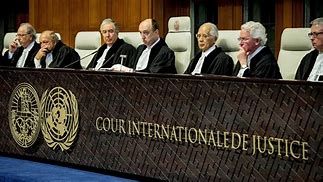
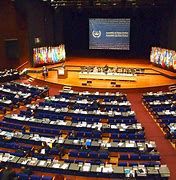

Internationaler Gerichtshof
Aus: Ausgabe vom 13.01.2024, Seite 8 / Ansichten
Israel in der Defensive
Völkermordprozess in Den Haag
Von Knut Mellenthin
Benjamin Netanjahu ist maßlos empört: »Eine Terrororganisation hat das schlimmste Verbrechen gegen das jüdische Volk seit dem Holocaust begangen, und nun kommt jemand, um sie im Namen des Holocaust zu verteidigen? Was für eine dreiste Unverschämtheit! Die Welt steht auf dem Kopf.« – Israels Regierungschef meint die Genozidklage Südafrikas, über die seit Donnerstag vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verhandelt wird. Dass es bei diesem Verfahren, das sich wohl über mehrere Jahre hinziehen wird, nicht im geringsten um eine Verteidigung der Hamas oder anderer palästinensischer Widerstandsorganisationen geht, interessiert Netanjahu von vornherein nicht.
Logik liegt nicht in dieser Argumentation: Selbst wenn es wahr wäre, wie Netanjahu behauptet, dass Israel sich im Gazastreifen gegen Genozidabsichten der Hamas verteidigt, schließt das nicht automatisch aus, dass die israelischen Streitkräfte dort Völkermordverbrechen begehen. Außerdem äußern sich zahlreiche israelische Politiker dazu in einer Weise, die als Rechtfertigung schon begangener und darüber hinaus noch geplanter Verbrechen gegen die palästinensische Bevölkerung nicht nur im Gazastreifen, sondern auch im besetzten Westjordanland interpretiert werden muss. Denn worauf sonst läuft es hinaus, wenn nicht nur rechte und extrem rechte Minister, sondern sogar der amtierende Staatspräsident Isaac Herzog öffentlich verkünden, es gebe »keine unschuldigen Palästinenser«?
Nicht nur Israels »politische Klasse«, sondern auch große Teile der israelischen Gesellschaft scheinen in der gegenwärtigen Situation die Ansicht des Kommentators der englischsprachigen Tageszeitung Jerusalem Post zu teilen, der in der Freitagausgabe kategorisch verkündete: »Um eine Nation von Holocaustüberlebendenden des Völkermords zu beschuldigen«, müsse man selbst »moralisch makellos« sein. Und das, so schrieb der Kommentator, sei Südafrika eben nicht, wo es Menschenhandel, Drogen- und Waffengeschäfte, Vergewaltigung, Autoraub, Taschendiebstahl und »jede andere Form von Verbrechen« gebe.
Für den Rechtsstreit, um den es in diesen Tagen in Den Haag geht, ist all das selbstverständlich irrelevant. Keine Ablenkungsversuche ändern etwas an der Tatsache, dass eine klare Mehrheit der Mitglieder der UNO und der internationalen Öffentlichkeit die israelische Kriegführung gegen die palästinensische Bevölkerung als systematisch grausam verurteilt und deren sofortige Beendigung fordert.
Quelle: junge Welt v.13.01.2024/ ANP/IMAGO
Auch Rechtsanwalt Tal Becker fallen keine schlüssigen Argumente gegen die südafrikanische Anklage in Den Haag ein (12.1.2024)

Internationale Gerichtshof behandelt Antrag von Südafrika gegen Israel wegen Völkermord
Aus: Ausgabe vom 12.01.2024, Seite 7 / Ausland
INTERNATIONALER GERICHTSHOF
»Genozid verhindern«
Anklage gegen Israel in Den Haag: Juristen Südafrikas gehen in detaillierte Beweisführung
Von Jakob Reimann
Am Donnerstag hat das südafrikanische Juristenteam seinen Vorwurf gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag vorgetragen: Die Klage lautet auf »Genozid« in Gaza. An diesem Freitag erhält die israelische Seite die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Bevor das vermutlich mehrjährige Hauptverfahren beginnt, befassen sich die Anhörungen zunächst mit dem südafrikanischen Eilantrag, der IGH solle ein Ende der Kampfhandlungen in Gaza anordnen, um so »die Rechte des palästinensischen Volkes gemäß der Völkermordkonvention vor weiterem, schwerem und irreparablem Schaden zu schützen«.
Der IGH setzt sich aus 15 Richtern zusammen, die von der UN-Generalversammlung und dem UN-Sicherheitsrat für neun Jahre gewählt werden. Zusätzlich stellen beide Konfliktparteien je einen eigenen Richter. Die IGH-Präsidentin, die US-Juristin Joan E. Donoghue, stellte zunächst fest, dass der südafrikanische Antrag aufgrund der hohen Dringlichkeit prioritär gegenüber allen anderen Fällen beim IGH behandelt werde. Daraufhin wurde das Gesuch Südafrikas vorgelesen. Darin fordert Pretoria unter anderem, Israel solle »unverzüglich« die militärischen Handlungen in Gaza einstellen, seiner Verpflichtung gemäß der Völkermordkonvention nachkommen und »geeignete Maßnahmen« unternehmen, um »Genozid zu verhindern« sowie den Zugang zu Nahrung, Treibstoff und medizinischer Versorgung zu gewährleisten. Auch wird Israel aufgefordert, internationalen Beobachtern und Ermittlern den Zugang zu der unter Dauerbombardement stehenden palästinensischen Enklave zu ermöglichen.
Südafrikas Justizminister Ronald Lamola stellte zunächst fest, dass »die Gewalt und die Zerstörung in Palästina und Israel« nicht erst am 7. Oktober 2023 begonnen hat. Vielmehr hätten die Palästinenser »systematische Unterdrückung und Gewalt« seit 76 Jahren erfahren. In aller Schärfe verurteilte er die »Greueltaten« der Hamas und anderer Gruppen vom 7. Oktober, doch würden diese in keinem Fall eine Rechtfertigung liefern, die Völkermordkonvention zu verletzen; Israels Reaktion auf den Angriff habe »diese Linie überschritten«.
Im Hauptteil legte die Juristin Adila Hassim Details der Anklage dar. Mit Stichtag 9. Januar waren demnach 23.210 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet worden, 70 Prozent davon Frauen und Kinder. 7.000 Personen werden vermisst und seien vermutlich ebenfalls tot. Darüber hinaus seien knapp 60.000 weitere verletzt oder verstümmelt worden. Hassim nannte Fälle systematischer Folter an Palästinensern und beschrieb den Einsatz von Hunger als Kriegswaffe: »Israels Kampagne hat die Menschen in Gaza an den Rand einer Hungersnot gebracht.« Mit Verweis auf Zahlen des Welternährungsprogramms mahnte Hassim: »Von allen Menschen in der Welt, die derzeit unter katastrophalem Hunger leiden, befinden sich mehr als 80 Prozent in Gaza.« Die Juristin nannte weiter die zahlreichen Angriffe auf die von Israel als »sicher« erklärten Fluchtkorridore; es gebe »keinen sicheren Ort in Gaza«.
Hassim zitierte die UN-Sonderberichterstatterin zu Gewalt gegen Frauen, Radhika Coomaraswamy, die Ende November 2023 gewarnt hatte, die »reproduktive Gewalt« gegen palästinensische Frauen, Neugeborene und Kinder könnte im Sinne des Artikels 2d der Völkermordkonvention darauf abzielten, Geburten zu verhindern. Die Anwältin Blinne Ní Ghrálaigh nannte die Zahl von durchschnittlich mehr als 117 Kindern, die jeden Tag getötet werden, und die Zahl von täglich über zehn Kindern, denen nach israelischen Angriffen ein oder beide Beine amputiert werden mussten. Bei zahlreichen Frauen würden Kaiserschnitte ohne Betäubung durchgeführt. Das UN-Kinderhilfswerk UNICEF spreche in Gaza von einem »Krieg gegen Kinder«, so Ní Ghrálaigh.
Der Jurist Tembeka Ngcukaitobi führte Indizien für Israels »genozidale Absichten« an, wie sie sich insbesondere in einer Vielzahl von Zitaten hochrangiger israelischer Politiker und Militärs äußerten. So nannte Ngcukaitobi den mehrfach von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geäußerten Verweis auf die genozidale biblische Geschichte der Amalekiter. Im Den Haager Gerichtssaal wurde ein Video abgespielt, in dem eine größere Gruppe israelischer Soldaten diese aufgreift und singend und tanzend die Zerstörung Gazas bejubelt; es gebe »keine unbeteiligten Zivilisten« in Gaza, wird dort gegrölt.
Quelle: junge Welt v.12.01.2024/ ANP/IMAGO
Gemeinsam Israels Krieg gegen Gaza stoppen: Die Delegationen aus Südafrika und Palästina am Donnerstag in Den Haag

Internationale Gerichtshof behandelt Antrag von Südafrika gegen Israel wegen Völkermord
Südafrika: "Langsamer Hungertod oder schneller Tod durch Bombenangriffe für die Palästinenser"
12 Jan. 2024 14:54 Uhr
Südafrikas Rechtsvertreter Tembeka Ngcukaitobi brachte im Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof vor, Israels Vorgehen im Gazastreifen bedeute für die Palästinenser entweder einen "langsamen Tod" durch Verhungern oder einen "schnellen Tod" durch Bomben und Scharfschützen.
Südafrika hat im vergangenen Monat beim Internationalem Gerichtshof, dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen, Klage eingereicht und angeführt, Israel habe gegen seine Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention, die beide Länder unterzeichnet haben, verstoßen.
Pretoria will erreichen, dass "vorläufige Maßnahmen" eingeführt werden, einschließlich einer Beendigung der Militärkampagne der IDF, die nach Angaben palästinensischer Beamter bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung mindestens 23.000 Menschen getötet hat.
Quelle: RT v.12.01.2024

Südafrika klagt Israel wegen Verletzung des Völkerrechts an!!!
Aus: Ausgabe vom 11.01.2024, Seite 12 / Thema
VÖLKERRECHT
Der schwerste Vorwurf
Dokumentiert. Auszüge aus Südafrikas Völkermordanklage gegen Israel
Link zur vollständigen Klageschrift in englischer Sprache: https://kurzelinks.de/hkls
Auswahl und Übersetzung aus dem Englischen: Dominik Wetzel
Am 29.12.2023 hat die Republik Südafrika gegen Israel Klage wegen Völkermords beim Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag eingereicht. Darin wird auch verlangt, dass Israel zur Einstellung seiner Angriffe in Gaza aufgefordert werden solle. Südafrika macht in der Klageschrift geltend, die Handlungen der israelischen Streitkräfte in Gaza hätten
»einen völkermörderischen Charakter«, da sie auf die Vernichtung der Palästinenser in diesem Gebiet abzielten. Die Regierung in Pretoria beruft sich bei der Klage auf die 1948 maßgeblich in Reaktion auf den Holocaust von der UN-Generalversammlung beschlossene Völkermordkonvention, die sowohl von Südafrika wie auch von Israel unterzeichnet worden ist. Die Anhörungen zur Klage in Den Haag sind für den heutigen Donnerstag und den morgigen Freitag angesetzt. Wir dokumentieren an dieser Stelle einen Auszug aus der Klageschrift. (jW)
I. Einleitung
1. Dieser Antrag betrifft angedrohte und billigend in Kauf genommene Handlungen, die Regierung und Militär des Staates Israel nach den Anschlägen vom 7. Oktober 2023 gegen das palästinensische Volk, eine eigene nationale und ethnische Gruppe, unternommen haben. Südafrika verurteilt unmissverständlich alle Verletzungen des Völkerrechts durch alle Parteien, einschließlich der direkten Angriffe auf israelische Zivilisten und andere Staatsangehörige sowie Geiselnahmen durch die Hamas und andere bewaffnete palästinensische Gruppen. Kein bewaffneter Angriff auf das Hoheitsgebiet eines Staates, wie schwerwiegend er auch sein mag – selbst ein Angriff, bei dem Greueltaten begangen werden – kann jedoch eine mögliche Rechtfertigung oder Verteidigung von Verstößen gegen das Übereinkommen von 1948 über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes (»Völkermordkonvention«) sein; sei es aus rechtlichen oder moralischen Gründen. Die von Südafrika beklagten Handlungen und Unterlassungen Israels haben völkermörderischen Charakter, weil sie auf die Vernichtung eines wesentlichen Teils der palästinensischen nationalen und ethnischen Gruppe, d. h. des Teils der palästinensischen Gruppe im Gazastreifen (»Palästinenser in Gaza«), abzielen. (…)
Südafrika ist sich des besonderen Gewichts der Verantwortung bei der Einleitung eines Verfahrens gegen Israel wegen Verstößen gegen die Völkermordkonvention bewusst. Südafrika ist sich aber als Vertragsstaat der Völkermordkonvention auch seiner eigenen Verpflichtung zur Verhinderung von Völkermord bewusst. Handlungen und Unterlassungen Israels in bezug auf die Palästinenser verstoßen gegen die Völkermordkonvention. Dies ist auch die Ansicht zahlreicher anderer Vertragsstaaten der Konvention, einschließlich des Staates Palästina selbst, der die »führenden Politiker der Welt« aufforderte, »Verantwortung zu übernehmen (…), um den Völkermord an unserem Volk zu beenden«. Experten der Vereinten Nationen haben seit mehr als zehn Wochen wiederholt »Alarm geschlagen«, dass »in Anbetracht von Erklärungen israelischer Politiker und ihrer Verbündeten, begleitet von Militäraktionen in Gaza und einer Eskalation der Verhaftungen und Tötungen im Westjordanland«, die »Gefahr eines Völkermords am palästinensischen Volk« besteht. (…)
Wiederholte Erklärungen von Vertretern des israelischen Staates, auch auf höchster Ebene, wie durch den israelischen Präsidenten, den Premierminister und den Verteidigungsminister, haben die völkermörderische Absicht zum Ausdruck gebracht. Diese Absicht erschließt sich vollumfänglich aus der Art und der Durchführung von Israels Militäroperation in Gaza. Unter anderem im Hinblick darauf, dass Israel es unterlässt, notwendige Nahrungsmittel, Wasser, Medizin, Treibstoff, Unterkunft und andere humanitäre Unterstützung für das belagerte und eingeschlossene palästinensische Volk bereitzustellen oder sicherzustellen, was sie an den Rand einer Hungersnot getrieben hat. (…)
Israel hat mittlerweile über 21.110 namentlich bekannte Palästinenser getötet, darunter 7.729 Kinder – mehr als 7.780 weitere werden vermisst, vermutlich tot unter den Ruinen –, und hat mehr als 55.243 weitere verwundet und ihnen enorme körperliche und seelische Schäden zugefügt. Israel hat außerdem weite Teile Gazas, darunter ganze Nachbarschaften, verwüstet, und mehr als 355.000 palästinensische Gebäude zerstört, Bäckereien, Schulen, Universitäten, Geschäfte, Gotteshäuser, Friedhöfe, kulturelle und archäologische Stätten, Gemeinde- und Gerichtsgebäude, kritische Infrastruktur, darunter Wasser- und Abwasseranlagen und Elektrizitätsnetzwerke, außerdem große landwirtschaftliche Flächen und führt einen unnachgiebigen Angriff gegen das palästinensische Gesundheitssystem. Israel hat Gaza bereits in Schutt und Asche gelegt und tut dies weiterhin, es tötet die Bevölkerung, fügt ihr Leid zu, zerstört sie und will ihr Lebensbedingungen auferlegen, die eine physische Vernichtung als Gruppe bedeuten. (…)
In Anbetracht der außerordentlichen Dringlichkeit der Situation ersucht Südafrika um eine beschleunigte Anhörung für seinen Antrag und einen Erlass vorläufiger Maßnahmen. Darüber hinaus ersucht Südafrika gemäß Artikel 74 (4) des Gerichtshofs den Präsidenten des Gerichtshofs, die palästinensische Bevölkerung in Gaza zu schützen, indem er Israel auffordert, unverzüglich alle militärischen Angriffe einzustellen, die einen Verstoß gegen die Völkermordkonvention darstellen oder einen solchen zur Folge haben. (…)
III. Die Fakten
A. Einführung
Seit dem 7. Oktober 2023 führt Israel einen großangelegten militärischen Angriff über den Land-, Luft- und Seeweg auf den Gazastreifen (»Gaza«), einen schmalen Landstreifen von etwa 365 Quadratkilometern – eines der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt. Der Gazastreifen, in dem etwa 2,3 Millionen Menschen leben – fast die Hälfte davon Kinder – ist durch Israel dem ausgesetzt, was als »schwerste konventionelle Bombenkampagne« in der Geschichte der modernen Kriegführung beschrieben wurde. Allein bis zum 29. Oktober 2023 wurden etwa 6.000 Bomben pro Woche auf die winzige Enklave abgeworfen. In etwas mehr als zwei Monaten hatten Israels militärische Angriffe »mehr Zerstörung angerichtet als die Zerstörung von Aleppo in Syrien zwischen 2012 und 2016, als im ukrainischen Mariupol oder im Verhältnis dazu die alliierten Bombenangriffe auf Deutschland im Zweiten Weltkrieg«. Die von Israel angerichtete Zerstörung ist so extrem, dass »Gaza jetzt vom Weltraum aus gesehen eine andere Farbe hat«. (…)
B. Hintergrund
(…)
3. Die Anschläge in Israel vom 7. Oktober 2023
Israels Militärangriff im Gazastreifen und seine verstärkte Militärkampagne im Westjordanland wurden als Reaktion auf einen Angriff in Israel am 7. Oktober 2023 (genannt »Operation Al-Aqsa-Flut«) durch zwei bewaffnete palästinensische Gruppen gestartet – dem militärischen Flügel der Hamas (den »Essedin-al-Kassam-Brigaden«) und dem Palästinensischen Islamischen Dschihad. Die beiden Gruppen feuerten große Raketensalven auf Israel ab, durchbrachen den israelischen Zaun, der den Gazastreifen abtrennt, und griffen israelische Militärstützpunkte, zivile Städte sowie ein Musikfestival an, das von Tausenden Jugendlichen besucht wurde, unter Umständen, die vom Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs untersucht werden. Südafrika verurteilt unmissverständlich die Angriffe auf israelische und ausländische Zivilisten durch die Hamas und andere bewaffnete palästinensische Gruppen sowie die Geiselnahme am 7. Oktober 2023, wie ausdrücklich in seiner Verbalnote an Israel vom 21. Dezember 2023 festgehalten. (…)
Als Reaktion auf die Anschläge vom 7. Oktober 2023 schwor Israel, die Hamas zu »zerschlagen und zu eliminieren« und »die feindlichen Kräfte, die in unser Gebiet eingedrungen sind, zu beseitigen und die Sicherheit wiederherzustellen«. Am 7. Oktober 2023 erklärte der israelische Premierminister, dass »die IDF (Israel Defence Forces; jW) sofort alle ihre Kräfte einsetzen werden, um die Fähigkeiten der Hamas zu zerstören. Wir werden sie vernichten und diesen dunklen Tag, den sie dem Staat Israel und seinem Volk aufgezwungen haben, mit aller Kraft rächen.« (…)
C. Völkermörderische Handlungen gegen das palästinensische Volk
(…)
Die Zahl der getöteten palästinensischen Journalisten ist deutlich höher als in jedem anderen Konflikt der letzten 100 Jahre. In den zwei Monaten seit dem 7. Oktober 2023 überstieg die Zahl der getöteten Journalisten bereits die Zahl des gesamten Zweiten Weltkriegs. (…)
Die Chefs der Vereinten Nationen und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) – denen Konfliktsituationen nicht fremd sind – haben das, was sich in Gaza abspielt, eine »Krise der Menschheit« genannt. »Veteranen der humanitären Hilfe, die in Kriegsgebieten und Katastrophen auf der ganzen Welt gedient haben – Menschen, die alles gesehen haben – (sagen), dass sie nichts Vergleichbares gesehen haben zu dem, was sie heute in Gaza sehen.« (…)
1. Das Töten der Palästinenser in Gaza
(…)
»Nirgendwo ist es sicher in Gaza«, machten der UN-Generalsekretär und mit ihm viele andere Experten der Vereinten Nationen der internationalen Gemeinschaft gegenüber deutlich. Palästinenser in Gaza wurden in ihren Häusern, an Orten, an denen sie Schutz suchten, in Krankenhäusern, in UNWRA-Schulen, in Kirchen, in Moscheen und bei dem Versuch, Nahrung und Wasser für ihre Familien zu finden, getötet. Sie wurden getötet, bei dem Versuch zu entkommen, an den Orten, zu denen sie geflohen waren, und sogar während sie versuchten, entlang der von Israel als »sicher« deklarierten Routen zu fliehen. Berichte über Massenhinrichtungen durch israelische Soldaten häufen sich, auch an mehreren Mitgliedern derselben Familie – Männern, Frauen und ältere Menschen. (…)
Es gibt auch Berichte über unbewaffnete Menschen – einschließlich israelischer Geiseln – die auf der Stelle erschossen werden, obwohl sie keine Gefahr darstellen, und auch, wenn sie weiße Fahnen schwenkten. Angriffe auf palästinensische Häuser und Wohnblocks machen einen Großteil der Toten aus, wobei Israel Berichten zufolge künstliche Intelligenz (»KI«) einsetzt, um bis zu 100 Bombenziele pro Tag zu finden. (…)
Schätzungen zufolge ist die Zahl der allein in den ersten drei Wochen in Gaza getöteten palästinensischen Kinder höher (insgesamt 3.195) als die Gesamtzahl der Kinder, die seit 2019 jedes Jahr in den Konfliktgebieten der Welt getötet wurden. Das Ausmaß der Tötung palästinensischer Kinder in Gaza ist so groß, dass die Vereinten Nationen es als »Kinderfriedhof« bezeichnet haben. In der Tat hat die beispiellose Zahl der Opfer palästinensischer Kinder den UNICEF-Sprecher dazu veranlasst, Israels Angriffe auf Gaza als »Krieg gegen Kinder« zu bezeichnen. (…)
Auch Ärzte, Journalisten, Lehrer, Akademiker und andere Berufsgruppen werden in noch nie dagewesenem Ausmaß getötet. Bis heute hat Israel mehr als 311 Ärzte, Krankenschwestern und anderes Gesundheitspersonal getötet, einschließlich Ärzten und Krankenwagenfahrern, die im Dienst starben; 103 Journalisten wurden getötet, d. h. mehr als ein Journalist pro Tag und mehr als 73 Prozent der Gesamtzahl der weltweit getöteten Journalisten und Medienmitarbeiter im Jahr 2023. 40 Mitarbeiter des Zivilschutzes, die bei der Bergung von Opfern aus den Trümmern helfen, wurden im Dienst getötet, und über 209 Lehrer und Erzieher. 144 Mitarbeiter der Vereinten Nationen wurden ebenfalls getötet. Die »höchste Zahl an getöteten Helfern in der Geschichte der UN in so kurzer Zeit«. (…)
Die Palästinenser in Gaza werden nicht nur durch israelische Waffen getötet. Sie sind auch vom Hungertod, von Dehydrierung und Krankheiten bedroht, da die israelische Belagerung anhält, die Hilfslieferungen für die palästinensische Bevölkerung unzureichend sind und die Verteilung dieser begrenzten Hilfsgüter, die in das Gebiet gelangen dürfen, aufgrund der Dezimierung der Infrastruktur des Gazastreifens durch die israelischen Militärangriffe äußerst schwierig ist.
2. Verursachung schwerer körperlicher und seelischer Schäden für Palästinenser in Gaza
Mehr als 55.243 Palästinenser wurden seit dem 7. Oktober 2023 infolge der israelischen Militärangriffe auf den Gazastreifen verwundet, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Verbrennungen und Amputationen sind typische Verletzungen, wobei schätzungsweise 1.000 Kinder ein oder beide Beine verloren haben. (…)
Insbesondere im Norden des Gazastreifens gibt es keine funktionierenden Krankenhäuser mehr, so dass Verletzte darauf beschränkt sind »auf den Tod zu warten«. Da sie keine Operation oder eine über die erste Hilfe hinausgehende medizinische Behandlung in Anspruch nehmen können, sterben sie einen langsamen und qualvollen Tod, aufgrund ihrer Verletzungen oder an den daraus resultierenden Infektionen. (…)
3. Massenhafte Vertreibung von Palästinensern aus ihren Häusern
Schätzungen zufolge wurden von 2,3 Millionen Einwohnern des Gazastreifens mehr als 1,9 Millionen – etwa 85 Prozent der Bevölkerung – aus ihren Häusern vertrieben. Es gibt keine sichere Zuflucht. Diejenigen, die nicht gehen können oder sich weigern, vertrieben zu werden, wurden getötet oder sind extrem gefährdet, in ihren Häusern getötet zu werden. (…)
4. Verweigerung des Zugangs zu angemessener Nahrung und Wasser
Am 9. Oktober 2023 verhängte Israel eine »vollständige Belagerung« des Gazastreifens, so dass kein Strom, keine Nahrungsmittel, kein Wasser und kein Treibstoff in den Gazastreifen gelangen. Zwar wurde die Belagerung seither teilweise gelockert, da seit dem 21. Oktober 2023 einige Hilfsgütertransporter in den Gazastreifen fahren durften, doch dies bleibt völlig unzureichend und weit unter dem Durchschnitt vor dem Oktober 2023, der bei etwa 500 Lastwagen pro Tag lag. Außerdem liegen die seit dem 21. November 2023 zugelassenen Treibstoffimporte »weit unter den Mindestanforderungen für wesentliche humanitäre Operationen«, was bedeutet, dass die begrenzte humanitäre Hilfe, die zugelassen wird, nicht ohne weiteres von den Grenzübergängen in den Gazastreifen transportiert werden kann. (…)
Israel hat die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen an den Rand einer Hungersnot getrieben. Internationale Organisationen warnen, »die Gefahr einer Hungersnot ist real« (Welternährungsprogramm, WFP) und dass sie »jeden Tag weiter steigt« (IPC). Die meisten Palästinenser in Gaza hungern jetzt, wobei die Hungersnot täglich steigt. Die Weltgesundheitsorganisation warnt, »der Hunger verwüstet Gaza«. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat erklärt, »vier der fünf hungrigsten Menschen der Welt befinden sich in Gaza«. (…)
»Oxfam und Human Rights Watch sind sogar so weit gegangen, Israel ausdrücklich vorzuwerfen, den Hunger ›als Kriegswaffe‹ gegen die palästinensische Bevölkerung in Gaza einzusetzen.«
(…)
7. Zerstörung des palästinensischen Lebens in Gaza
Am 16. November 2023 haben 15 Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen und 21 Mitglieder von UN-Arbeitsgruppen vor einem »sich abzeichnenden Völkermord« in Gaza gewarnt. Sie haben beobachtet, dass das Ausmaß der Zerstörung von »Wohneinheiten, Krankenhäusern, Schulen, Moscheen, Bäckereien, Wasserleitungen, Abwasserkanälen und Elektrizitätsnetzen … droht, eine Fortsetzung des palästinensischen Lebens in Gaza unmöglich zu machen«. (…)
Israel hat den Justizpalast angegriffen – das wichtigste palästinensische Gerichtsgebäude in Gaza, in dem der Oberste Palästinensische Gerichtshof, das Verfassungsgericht, das Appellationsgericht, das Berufungsgericht, das Gericht der ersten Instanz, das Verwaltungsgericht und das Amtsgericht sowie ein Archiv mit Gerichtsakten und anderen historischen Akten beheimatet war. (…)
Israel hat alle vier Universitäten des Gazastreifens ins Visier genommen – darunter auch die Islamische Universität von Gaza, die älteste Hochschuleinrichtung in diesem Gebiet, die Generationen von Ärzten und Ingenieuren ausgebildet hat – und hat damit die Campus für die Ausbildung künftiger Generationen von Palästinensern zerstört. (…)
Genauso wie Israel die offiziellen Erinnerungen und Aufzeichnungen der Palästinenser in Gaza durch die Zerstörung der Archive und Wahrzeichen des Gazastreifens vernichtet, so löscht es auch das persönliche Leben und das private Gedächtnis, die Geschichte und die Zukunft der Palästinenser aus, indem es Friedhöfe bombardiert und planiert, Familienaufzeichnungen und Fotos vernichtet, ganze Familien über mehrere Generationen auslöscht und eine ganze Generation von Kindern tötet, verstümmelt und traumatisiert. (…)
8. Verhängung von Maßnahmen zur Verhinderung palästinensischer Geburten
Das Vorgehen Israels trifft palästinensische Frauen und Kinder im Gazastreifen besonders hart: Schätzungsweise 70 Prozent der Getöteten sind Frauen und Kinder. Jede Stunde werden in Gaza schätzungsweise zwei Mütter getötet. Allein bis zum 11. Dezember 2023 wurden schätzungsweise 7.729 Kinder getötet, und mindestens 4.700 weitere Frauen und Kinder gelten als vermisst, die unter den Trümmern vermutet werden. Es gibt mehrere Augenzeugenberichte von schwangeren Frauen, die von israelischen Soldaten ermordet wurden, auch dann, als sie versuchten, medizinische Versorgung zu erhalten. (…)
Berichten zufolge sterben immer mehr palästinensische Babys im Gazastreifen an völlig vermeidbaren Ursachen, die durch Israels Aktionen verursacht werden: Neugeborene bis zu drei Monaten sterben an Durchfall, Unterkühlung und anderen vermeidbaren Ursachen. Ohne wichtige Ausrüstung und medizinische Unterstützung haben Frühgeborene und untergewichtige Babys wenig bis gar keine Überlebenschance. (…)
D. Äußerungen von Völkermordabsichten gegen das palästinensische Volk durch israelische Staatsbeamte und Andere
Die Beweise für die besondere Absicht (»dolus specialis«) der israelischen Staatsbeamten, Völkermord zu begehen und daran festzuhalten, völkermörderische Handlungen zu begehen bzw. sie nicht zu verhindern, sind seit Oktober 2023 deutlich und offenkundig. Diese Absichtserklärungen – in Verbindung mit dem Ausmaß des Tötens, Verstümmelns, Vertreibens und der Zerstörung vor Ort sowie auch mit der Belagerung – belegen einen sich entfaltenden und anhaltenden Völkermord. Dazu gehören Erklärungen der folgenden Personen, die die höchste Verantwortung tragen:
Premierminister von Israel: Am 16. Oktober 2023 beschrieb (Benjamin Netanjahu) in einer Ansprache vor der israelischen Knesset, die Situation als »einen Kampf zwischen den Kindern des Lichts und den Kindern der Finsternis, zwischen Menschlichkeit und dem Gesetz des Dschungels« (…)
Am 28. Oktober 2023, als die israelischen Streitkräfte ihre Landinvasion des Gazastreifens vorbereiteten, berief sich der Premierminister auf die biblische Geschichte der totalen Vernichtung von Amalek durch die Israeliten, indem er erklärte: »Ihr müsst daran denken, was Amalek euch angetan hat, sagt unsere Heilige Bibel. Und wir erinnern uns«. (…) Die entsprechende Bibelstelle lautet wie folgt: »Nun geht hin, greift Amalek an und verbannt alles, was ihm gehört. Verschont niemanden, sondern tötet Männer und Frauen, Säuglinge und Kleinkinder, Rinder und Schafe, Kamele und Esel«.
Präsident von Israel: Am 12. Oktober 2023 stellte Präsident Isaac Herzog klar, dass Israel nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten unterscheide (…): »Eine ganze Nation da draußen ist dafür verantwortlich. Es ist nicht wahr, dass die Zivilisten nichts davon wissen, nicht involviert sind. Es ist absolut nicht wahr. … und wir werden kämpfen, bis wir ihnen das Rückgrat brechen.« (…) Der israelische Präsident ist einer von vielen Israelis, die handschriftliche »Botschaften« auf Bomben geschrieben haben, die über Gaza abgeworfen werden.
Israelischer Verteidigungsminister: Am 9. Oktober 2023 teilte der Verteidigungsminister Joaw Gallant in einem »Lagebericht« der israelischen Armee mit, dass Israel »eine vollständige Belagerung des Gazastreifens verhängt hat. Kein Strom, keine Lebensmittel, kein Wasser, kein Treibstoff. Alles wird geschlossen. Wir kämpfen gegen menschliche Tiere und handeln dementsprechend.« Er informierte auch die Truppen an der Grenze zum Gazastreifen, dass er »alle Fesseln gelöst« habe, mit den Worten, dass »Gaza nicht mehr so sein wird wie vorher. Wir werden alles eliminieren. Wenn es nicht einen Tag dauert, wird es eine Woche dauern. Es wird Wochen oder sogar Monate dauern, wir werden alle Orte erreichen.« (…)
Israelischer Minister für Energie und Infrastruktur: »Tweet« vom 13. Oktober 2023, Israel
Katz erklärte: »Der gesamten Zivilbevölkerung in Gaza wird befohlen, den Gazastreifen sofort zu verlassen. Wir werden gewinnen. Sie werden keinen einzigen Tropfen Wasser oder eine einzige Batterie erhalten, bis sie die Welt verlassen.« (…)
Israelischer Minister für kulturelles Erbe: Am 1. November 2023 postete Amichai Elijahu auf Facebook: »Der Norden des Gazastreifens, schöner als je zuvor. Alles ist in die Luft gesprengt und platt gemacht, einfach eine Freude für die Augen (…)«. Er stellte auch einen nuklearen Angriff auf den Gazastreifen in Aussicht. (…)
Soldaten der israelischen Armee: Israelische Soldaten in Uniform wurden am 5. Dezember 2023 gefilmt, wie sie tanzten und sangen »Möge ihr Dorf brennen, möge Gaza ausgelöscht werden«; und zwei Tage später, am 7. Dezember 2023, tanzten, sangen und skandierten sie in Gaza, »Wir kennen unser Motto: Es gibt keine unbeteiligten Zivilisten« und »die Saat von Amalek auslöschen«. (…)
Eine ähnliche völkermörderische Rhetorik ist auch in der israelischen Zivilgesellschaft an der Tagesordnung, wobei völkermörderische Botschaften in den israelischen Medien routinemäßig – ohne Zensur oder Sanktionen – verbreitet werden. In Medienberichten wird dazu aufgerufen, Gaza solle »ausgelöscht« und in ein »Schlachthaus« verwandelt werden, die »Hamas solle nicht eliminiert« werden, lieber solle »Gaza zerstört werden«, mit der wiederholten Behauptung, dass es »keine Unschuldigen gibt … Es gibt keine Bevölkerung. Es gibt 2,5 Millionen Terroristen«. (…)
IV. Südafrikas Forderungen
Auf der Grundlage der obigen Ausführungen sowie der im Laufe dieses Verfahrens vorzulegenden weiteren Beweise ist Südafrika der Ansicht, dass das Verhalten Israels – durch seine Staatsorgane, Staatsagenten, und andere Personen und Einrichtungen, die auf seine Anweisungen oder unter seiner Leitung, Kontrolle oder Einflussnahme handeln – in Bezug auf die Palästinenser in Gaza gegen seine Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention verstößt,
einschließlich der Artikel I, III, IV, V und VI, in Verbindung mit Artikel II. Diese Verstöße gegen die
Völkermordkonvention umfassen, sind aber nicht beschränkt auf:
- Unterlassung der Verhütung von Völkermord unter Verstoß gegen Artikel I;
(b) die Begehung von Völkermord unter Verstoß gegen Artikel III Buchstabe a);
(c) Verschwörung zum Völkermord unter Verstoß gegen Artikel III (b);
(d) die unmittelbare und öffentliche Aufforderung zum Völkermord unter Verstoß gegen Artikel III Buchstabe c);
(e) Versuch der Begehung von Völkermord unter Verstoß gegen Artikel III (d);
(f) Beihilfe zum Völkermord unter Verstoß gegen Artikel III Buchstabe e);
(g) Unterlassung der Bestrafung von Völkermord, Verschwörung zum Völkermord, direkter und öffentlicher Aufstachelung zum Völkermord, des versuchten Völkermordes und der Mittäterschaft am Völkermord unter Verletzung der Artikel I, III, IV und VI;
(h) Unterlassung des Erlasses der erforderlichen Rechtsvorschriften, Bestimmungen der Völkermordkonvention umzusetzen und wirksame Strafen für Personen vorzusehen, die sich des Völkermordes, der Verschwörung Völkermordes, der Anstiftung zum Völkermord, des versuchten Völkermordes und der Mittäterschaft an Völkermordes schuldig gemacht haben, unter Verstoß gegen Artikel V; und
(i) als notwendige und begleitende Verpflichtung gemäß Artikel I, III, IV, V und VI die Untersuchung der gegen die Palästinenser in Gaza begangenen völkermörderischen Akte durch zuständige internationale Gremien oder Untersuchungsmissionen nicht zuzulassen und/oder direkt oder indirekt zu behindern (…)
Quelle: junge Welt v.11.01.2024/ Mohammed Hajjar/AP Photo/dpa
Die israelische Armee hat im Gazastreifen seit dem 7. Oktober 2023 mindestens 21.110 Palästinenser getötet (Friedhof in Gaza, 31.12.2023)

Kampf für die Menschenrechte und des Völkerrechts
Aus: Ausgabe vom 08.01.2024, Seite 6 / Ausland
KRIEGSVERBRECHEN
Klage aus Chile
Gazakrieg: Israels Premier Netanjahu muss sich in Den Haag auch vor Strafgerichtshof verantworten
Von Volker Hermsdorf
)
Bei den Nahostreisen von US-Außenminister Antony Blinken und seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock dürfte es in dieser Woche auch um Forderungen aus der israelischen Regierungskoalition nach einer Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen gehen. Während westliche Politiker entsprechende Erklärungen von Israels ultrarechtem Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, und Finanzminister Bezalel Smotrich eher zurückhaltend kritisieren, werden in Lateinamerika Konsequenzen gefordert. So wirft die Regierung Brasiliens Israel vor, gegen das Völkerrecht zu verstoßen und die Chancen auf Frieden in der Region zu sabotieren.
Die Regierung habe »mit Besorgnis« die jüngsten Äußerungen israelischer Regierungsvertreter zur Kenntnis genommen, die zur Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung und Wiedererrichtung israelischer Siedlungen in diesem Gebiet auffordern, heißt es in einer am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Erklärung des brasilianischen Außenministeriums. »Indem sie Maßnahmen vorschlagen, die gegen das Völkerrecht verstoßen, verschärfen sie die Spannungen und schaden den Aussichten auf Frieden in der Region«, verurteilt Brasília den von Anhängern extrem rechter Gruppen und Siedlern unterstützten Vorstoß. Brasilien trete für eine Lösung zwischen den Parteien ein, bei der ein »wirtschaftlich lebensfähiger palästinensischer Staat Seite an Seite mit Israel in Frieden und Sicherheit innerhalb der vereinbarten und international anerkannten Grenzen lebt«, heißt es in der Note.
Unterdessen haben chilenische Juristen – unterstützt von mehreren Senatoren und Parlamentsabgeordneten – beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) eine Klage gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu sowie gegen andere Politiker und Militärs wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit eingereicht. Die Beschwerdeführer fordern zudem die Ausstellung eines internationalen Haftbefehls gegen Netanjahu, den Stabschef der israelischen Armee, Herzi Halewi, den Minister für militärische Angelegenheiten, Joaw Gallant, sowie andere Politiker und Militärs wegen Völkermords, meldete Telesur am Sonnabend. »Es ist die Pflicht aller Länder, Kriegsverbrecher anzuprangern, damit sie zur Rechenschaft gezogen werden können, ihre Verantwortung übernehmen, gemäß den Regelungen des Römischen Statuts bestraft und die Opfer entschädigt werden können«, erklärte der ehemalige chilenische Botschafter Nelson Hadad für die Kläger. Er wies darauf hin, dass »diese Verbrechen seit fast 90 Tagen bei Tag und Nacht andauern, mit wahllosem Beschuss der Bevölkerung im Gazastreifen, mit der Zerstörung ganzer Wohnviertel, ohne Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kämpfern«. Die Klage sei vor der Weihnachtspause beim IStGH eingereicht worden, damit sie bei Wiederaufnahme der Arbeit an diesem Montag bearbeitet werden kann. Der Gerichtshof mit Sitz in Den Haag ist seit 2003 für die Verfolgung besonders schwerer Straftaten wie Völkermord, Verbrechen gegen die Menschheit, Kriegsverbrechen und Verbrechen der Aggression zuständig.
In dieser Woche beginnen vor dem ebenfalls in Den Haag ansässigen Internationalen Gerichtshof (IGH) auch die Anhörungen zu einem von Südafrika am 29. Dezember wegen Völkermords an der palästinensischen Bevölkerung beantragten Prozess gegen Israel. Die UN-Richter sollten aus Sicht Südafrikas zunächst in einem Eilverfahren die sofortige Einstellung der Angriffe und ein Ende der Gewalt gegen Palästinenser anordnen. Wie das US-Nachrichtenportal Axios berichtete, hat das israelische Außenministerium seine Botschaften angewiesen, »Diplomaten und Politiker in ihren Gastländern zu drängen, vor Beginn der Anhörungen am kommenden Donnerstag, Erklärungen gegen die Klage Südafrikas abzugeben«. In der Anweisung heißt es laut Axios, »strategisches Ziel« Israels sei es, dass das Gericht den Antrag auf eine einstweilige Verfügung ablehne, feststelle, dass Israel in Gaza keinen Völkermord begehe, und anerkenne, dass das israelische Militär im Gazastreifen im Einklang mit dem Völkerrecht operiere.
Quelle: junge Welt v.08.01.2024/ Joshua ArguelloIMAGO
»Kein Konflikt, sondern Apartheid, Kolonialismus und Genozid«: Protest gegen Israels Krieg in Santiago de Chile (19.10.2023

Kampf um Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 03.01.2024, Seite 8 / Abgeschrieben
Kinderrechte in Verfassung verankern!
Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes, forderte am Montag anlässlich des Jubiläums des Grundgesetzes, Kinderrechte verfassungsrechtlich abzusichern:
Wir feiern in diesem Jahr das 75jährige Jubiläum unseres Grundgesetzes. Auch deshalb ist es höchste Zeit, dass Kinderrechte entlang der Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention ausdrücklich verfassungsrechtlich verankert werden. Es braucht endlich eine rechtliche Normierung im Grundgesetz, dass das Kindeswohl vorrangig zu beachten ist, dass Kinder das Recht auf Entwicklung, auf Schutz, auf Förderung und das Recht auf Beteiligung haben. Dafür braucht es im Grundgesetz einen eigenen Passus für die Kinderrechte, die unabhängig von den Elternrechten und ohne mit ihnen in Konflikt zu geraten gegenüber dem Staat gelten. Die Bundesregierung steht hier zusammen mit Bundestag und Bundesrat in der Pflicht. (…)
Das Thema Kinderrechte darf nicht weiter ein Nischenthema bleiben, sondern es braucht die breite Etablierung einer Kinderrechtsperspektive im deutschen Rechtssystem. Bereits seit vielen Jahren gibt es eine breite Unterstützung für die Aufnahme von Kinderrechten im Grundgesetz auf Bundesebene, denn dadurch würde der Staat insgesamt stärker in die Pflicht genommen werden, wenn es beispielsweise um die Wahrnehmung seiner Verantwortung für kindgerechte Lebensverhältnisse und um bessere Entwicklungschancen für alle Kinder und Jugendlichen geht. Gerade vor dem Hintergrund multipler Krisen zeigt sich, dass es der Kinderrechte mehr denn je bedarf. Und auch angesichts der aktuellen Debatten über eine viel zu hohe Kinderarmutsquote, unterschiedliche Bildungschancen, ein Auseinanderdriften der Gesellschaft in Arm und Reich und häufige Fälle von Kindesvernachlässigung wäre dies ein wichtiges Signal. (…)
Quelle: junge Welt v.03.01.2024/ REUTERS/El Tayeb Siddig Kinder im Sudan

28.12.
2023
Verstoß gegen Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 28.12.2023, Seite 1 / Ausland
GAZAKRIEG
Israelisches »Guantanamo«
Gazakrieg: NGOs berichten von schweren Menschenrechtsverstößen gegenüber Häftlingen
Von Jakob Reimann
Das Video des israelischen Fotojournalisten machte auch am Mittwoch weiter die Runde: Israelische Streitkräfte hatten am Montag Dutzende Palästinenser auf dem Spielfeld des Jarmuk-Stadions in Gaza-Stadt zusammengetrieben, darunter Frauen, Kinder und Alte. Die Aufnahme zeigt bis auf die Unterwäsche entkleidete Männer und Jungs mit hinterm Rücken gefesselten oder erhobenen Händen, die sich aufreihen oder hinknien mussten.
https://www.jungewelt.de/artikel/466016.gazakrieg-israelisches-guantanamo.html
Berichten zufolge seien die Palästinenser zuvor von israelischen Streitkräften misshandelt worden. Panzer umkreisten die Szenerie und zerpflügten das Fußballfeld, Scharfschützen behielten die Gefangenen im Visier. Das Video endet mit einer Aufnahme eines israelischen Soldaten, der anscheinend ein in eine Decke gewickeltes Baby trägt. Auf Bitte von Sky News, das Video zu kommentieren, antwortete das israelische Militär, es operiere »im Rahmen der Bemühungen, die militärischen Fähigkeiten der Hamas zu zerschlagen«.
Bereits zuvor gab es Berichte über Menschenrechtsverstöße an Häftlingen, die aus dem Gazastreifen in Militärbasen in Israel verschleppt wurden. So seien laut der Menschenrechtsorganisation Euro-Med Monitor im israelischen Militärlager Camp Sede Teman mehrere Gefangene infolge von Folter und Misshandlungen gestorben. Auch habe es Hinrichtungen durch Erschießen gegeben. Die Inhaftierten wurden demnach unter freiem Himmel in Hühnerställen eingesperrt, und ihnen wurden »über lange Zeiträume Essen und Trinken vorenthalten«. Das Camp sei zum »neuen Guantanamo« umgewandelt worden, urteilt Euro-Med Monitor.
Der Krieg in Gaza sei »mehr als ein Vernichtungskrieg«, erklärte unterdessen am Dienstag abend der illegitime palästinensische »Präsident« Mahmud Abbas im Interview mit dem ägyptischen Fernsehsender ON. »Unser Volk hat noch nie einen solchen Krieg erlebt«, so Abbas weiter, der vor einer Ausweitung des Krieges auf das Westjordanland warnte. Außerdem weigerten sich die USA, »den Krieg zu beenden«. Alles, was in Gaza passiere, geschehe entsprechend mit Unterstützung der USA.
Quelle: junge Welt v.28.12.2023/ Bild twitter.com/QudsNen
Das auf X kursierende Video zeigt auch zwei Minderjährige (Screenshot); twitter.com/QudsNen Anscheinend auch ein in eine Decke gewickeltes Baby ; twitter.com/QudsNen Mit erhobenen Armen oder kniend und gefesselt: Szene aus dem auf X verbreiteten Video (Screenshot); Bilder GeFiS-Archiv




Verstoß gegen die Menschenrechte
Neues Massaker in Cauca
Herausgegeben von Editora Bogotá | 22. Dezember 2023 | Menschenrechte
CI.- Laut Indepaz wäre dies das 93. Massaker im Jahr 2023, sechs davon entfallen auf das Departamento Cauca. Indigene Gemeinschaften sind am stärksten betroffen.
In den frühen Morgenstunden des 22. Dezembers ereignete sich ein neues Massaker, bei dem fünf Menschen im Reservat Canoas, einer ländlichen Gegend der Gemeinde Santander de Quilichao (Cauca), getötet wurden. Ein Lehrer wurde zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter getötet, während zwei junge Gemeindemitglieder die beiden anderen Opfer waren.
In der von der Vereinigung der indigenen Räte des Nordkaukasus (ACIN) veröffentlichten Erklärung heißt es: "Am Freitag, den 22. Dezember, gegen 4:00 Uhr morgens kamen bewaffnete Männer in die Residenz des Lehrers der Bildungseinrichtung Las Aves, Jhon Freiman Ramos Ocaña (...). Der Lehrer, seine Frau Yisel Menza und seine 15-jährige Tochter Jelen Charlit Ramos Menza wurden noch am Tatort ermordet."
In der Erklärung wird auch die Ermordung von Davison Fernández Ramos und Jesús David Labio Ramos, jungen Gemeindemitgliedern in diesem Reservat, angeprangert.
Yesid Conda, leitendes Ratsmitglied des Regionalen Indigenen Rates von Cauca (CRIC), sagte: "Leider haben wir heute ein Massaker im Departamento Cauca, (...) Diese Tatsache stört alle Arten von Harmonie und ist am Ende des Jahres bedauerlich. Wir lehnen diese Ereignisse ab, die um eine Familie trauern."
Auf der anderen Seite sagte der Vertreter der Abgeordnetenkammer für Cauca und ehemalige leitende Berater des CRIC, Ermes Pete Vivas, über sein X-Konto: "Diese grausamen Taten sind ein Beweis für eine wachsende humanitäre Krise, die die indigenen Gebiete von Cauca betrifft. Wir fordern die Behörden auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um diese eskalierende Gewalt zu beenden und die Sicherheit unserer Gemeinden zu gewährleisten."
Darüber hinaus kommen diese Ereignisse zu den jüngsten Morden an Marino Paví Julicue, Koordinator der Indigenen Garde des San Francisco Reservats in der Gemeinde Toribio, und Robert Fernández, einem Bauernführer in einer ländlichen Gegend der Gemeinde Cajibío, hinzu.
Mit diesem neuen Massaker erreicht das Land im Jahr 2023 bisher 93 Fälle, von denen sich sechs im Departement Cauca ereigneten. Ebenso verzeichnet diese Abteilung mit 38 die bisher höchste Zahl an ermordeten gesellschaftlichen Führern im Jahr 2023.
Quelle: https://www.colombiainforma.info/
CI MV/FC/22.12.2023/17:00

Überwachungsstaat - Verstoß gegen die Menschenrechte ?
Bruch des Koalitionsvertrags? Nancy Faeser will private Chats überwachen
21 Dez. 2023 14:38 Uhr
Im Koalitionsvertrag hatte die Ampel die Überwachung privater Chats noch ausgeschlossen. Diese Aussage scheint so nicht mehr zu gelten. Das Innenministerium unter Nancy Faeser hat gegenüber der EU gegen die Durchsuchung unverschlüsselter Kommunikation nichts einzuwenden.
Die EU plant die Überwachung privater Chats. Offizieller Anlass ist die Bekämpfung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder durch die Mitgliedsstaaten. Internet-Dienste wie Google, Meta (Facebook Instagram, WhatsApp), Apple und Telegram sollen nach dem Willen der EU-Kommission unter Ursula von der Leyen zum anlasslosen Scannen und Überwachen ihrer Nutzer verpflichtet werden.
Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat der EU laut einem Bericht des Springerblattes Bild eine vorläufige gemeinsame Position aus Deutschland vorgelegt. Das Innenministerium fordert demnach die Durchsuchung unverschlüsselter Kommunikation (etwa in Chats, E-Mails oder bei digitalen Speicheranbietern) und die aktive Suche nach bislang unbekannten Missbrauchsdarstellungen und "Grooming".
In der Ampelkoalition sorgt diese Gestaltung für Ärger. Im Koalitionsvertrag waren derartige Maßnahmen noch ausgeschlossen worden. In dem Dokument aus dem Jahr 2021 hieß es:
"Allgemeine Überwachungspflichten, Maßnahmen zum Scannen privater Kommunikation und eine Identifizierungspflicht lehnen wir ab. Anonyme und pseudonyme Online-Nutzung werden wir wahren."
Der digitalpolitische Sprecher der FDP, Maximilian Funke-Kaiser, kritisierte gegenüber Bild die Innenministerin deutlich:
"Das Briefgeheimnis gilt ausnahmslos auch im digitalen Raum. Leider sperrt sich Nancy Faeser gegen unsere Bedenken und verstößt damit gegen den Koalitionsvertrag, der die Chatkontrolle klar ablehnt. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass Nancy Faeser in einer nächsten Stellungnahme endlich einlenkt."
Laut Bild enthält das vorläufige Positionspapier an den EU-Rat eine Einigung auf eine verpflichtende Altersverifizierung mittels eines Ausweises. "Anonyme oder jedenfalls pseudonyme Nutzung" müsse aber weiterhin möglich sein. Client-Side-Scanning und die Umgehung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung würden abgelehnt. Audiokommunikation solle nicht durchsucht werden.
Quelle: RT.21.12.2023/ Zum Schutz der Wahrheit zensieren, zum Schutz der Kinder mitlesen: Nancy Faeser im Dezember 2023
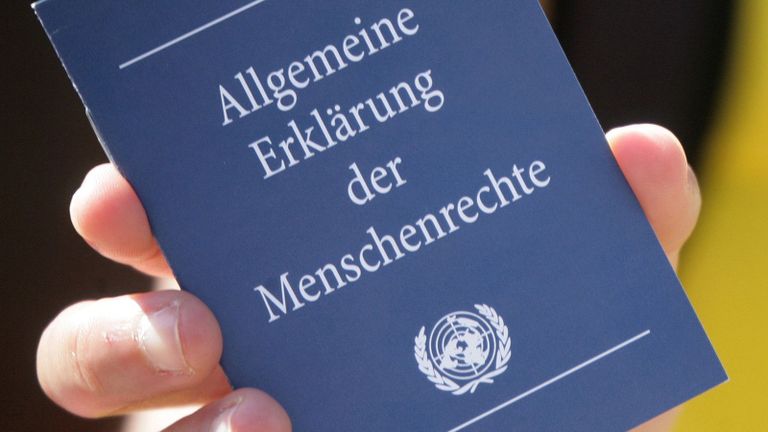
Medizinische Hilfeleistung bei lebensgefährlicher Erkrankung verwehrt - ist ein Verstoß gegen Menschenrechte, oder ???
Aus: Ausgabe vom 15.12.2023, Seite 8 / Abgeschrieben
OLG Düsseldorf lehnt Haftentlassung zur Behandlung der Krebserkrankung von İhsan Cibelik in Freiheit ab
Die Verteidigung in einem vor dem Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf laufenden Strafverfahrens nach dem Terrorparagraphen 129 b Strafgesetzbuch gegen angebliche Mitglieder der antiimperialistischen DHKP-C aus der Türkei berichtete in einer am Mittwoch nachmittag verschickten Presseerklärung über die Situation des angeklagten İhsan Cibelik:
Die Verteidigung des im o.g. Verfahrens angeklagten revolutionären Künstlers und Mitglied der international bekannten Musikgruppe Grup Yorum hatte dessen – zumindest zeitweise – Haftentlassung beantragt, damit eine von Herrn Cibelik verlangte operative Entfernung des bei ihm in der Haft festgestellten Prostatakarzinoms in einer Spezialklinik seines Vertrauens und in eigener Verantwortung durchgeführt werden könnte.
Mit heute zugestelltem Beschluss vom 12. Dezember 2023 hat der siebte Strafsenat des OLG Düsseldorf den Antrag auf Haftentlassung abgelehnt und Haftfortdauer angeordnet (…). Mit dieser Entscheidung verwehrt der Senat Herrn Cibelik die sofortige Durchführung der Operation, also der Behandlung, die nach wohl unstreitiger medizinischer Meinung einzig eine Chance auf sofortige völlige Heilung bietet. Eine Beobachtung mit dreimonatigen Kontrollen gefährdet das Leben eines an Prostatakrebs Erkrankten, weil eine jederzeit mögliche Streuung der Krebszellen eine Heilung ausschließt. Zudem wird, soweit Herrn Cibelik die gewünschte Operation zugestanden wird, durch eine fortdauernde Inhaftierung die weitere Behandlung in den Verantwortungsbereich des Gefängnisses gelegt, was die Behandlung erheblich hinauszögern wird. Der Senat nimmt dadurch eine Verschlimmerung der Erkrankung billigend in Kauf. Die Justizvollzugsanstalt (JVA) könne »mittelfristig« einen Operationstermin in einer von der JVA bestimmten Klinik organisieren – jener JVA, die allein zur Durchführung der bereits bei Inhaftierung von Herrn Cibelik angesetzten Biopsie ca. 15 Monate gebraucht hat. (…)
Quelle: junge Welt v.15.12.2023/ Bild GeFiS-Archiv

Umsetzung des Völkerrechts in Deutschland ???
Deutsche Familie in Gaza ausgelöscht – Auswärtiges Amt verweigert völkerrechtliche Einschätzung
14 Dez. 2023 21:17 Uhr
Beim Beschuss eines Wohnhauses in Gaza wurden alle Mitglieder einer deutschen Familie palästinensischer Herkunft getötet. Auf der Bundespressekonferenz drängten die "NachDenkSeiten" auf eine völkerrechtliche Einschätzung. Das Auswärtige Amt verweigerte unter Hinweis auf Persönlichkeitsrechte die Auskunft.
Bereits im Oktober wurde eine sechsköpfige deutsche Familie mit palästinensischen Wurzeln bei einem israelischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus im Gazastreifen ausgelöscht.
Auf der Bundespressekonferenz bat der NachDenkSeiten-Redakteur Florian Warweg das Auswärtige Amt um eine Stellungnahme und eine völkerrechtliche Einordnung. Das Auswärtige Amt verurteilte das von Israel durchgeführte Bombardement nicht und flüchtete sich in die Behauptung, dass man aus Gründen des Persönlichkeitsrechts keine detaillierte Auskunft geben könne.
Warweg hakte nach und konkretisierte. Ob das Auswärtige Amt grundsätzlich den durch ausländische Mächte verursachten Tod von deutschen Staatsbürgern nicht kommentiere, wollte er wissen. Die Antwort war erneut ausweichend.
Der Tod der deutsch-palästinensischen Familie Abujadallah ist der erste bestätigte Fall, bei dem deutsche Staatsangehörige durch den Beschuss ziviler Ziele durch das israelische Militär getötet wurden. Der Familienvater habe nach Abschluss seiner Facharztausbildung in Deutschland zum 1. November eine Stelle als Anästhesist antreten sollen, berichten die NachDenkseiten. Getötet wurden zudem seine Frau und seine drei Kinder im Alter von elf, neun und drei Jahren sowie der neugeborene Sohn Omar.
Keine Stellung wollte das Auswärtige Amt auch zum mutmaßlichen Einsatz von weißem Phosphor durch das israelische Militär im Libanon nehmen. Man habe die Presseberichte zur Kenntnis genommen, könne aber keine eigene Einschätzung abgeben.
Der Einsatz von weißem Phosphor gegen Zivilisten ist nach einem Zusatzprotokoll des Genfer Abkommens verboten. Israel hat dieses Abkommen bisher jedoch nicht unterzeichnet. Weißer Phosphor verursacht schwerste Verbrennungen und ist hoch toxisch.
Quelle: Rt und NDS v.14.12.2023/Bild Screenshot
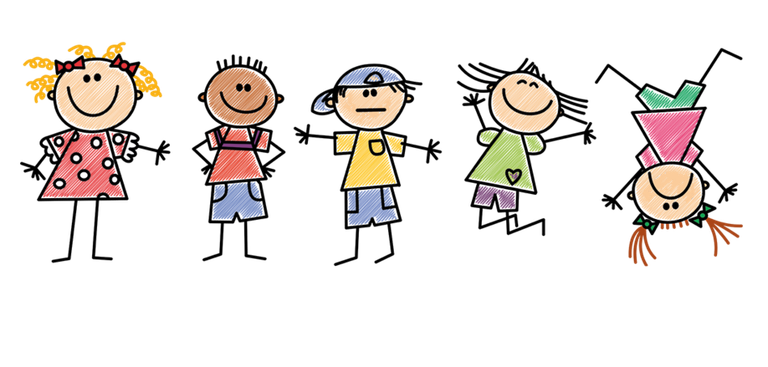
Kampf um Menschenrechte in Deutschland - gegen Kinderarmut!
Aus: Ausgabe vom 07.12.2023, Seite 1 / Titel
KINDERARMUT INMITTEN VON WOHLSTAND
… und raus bist du!
In Deutschland lebt mehr als eine Million Kinder in dauerhafter Armut. Politik könnte Elend abmildern. Bundesregierung hat andere Prioritäten
Von Susanne Knütter
Es gibt Länder, die Bemühungen unternehmen, Kinderarmut zu reduzieren. Deutschland gehört nicht dazu. Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Kinderhilfswerks UNICEF hervorgeht, haben 17 von 39 OECD- und EU-Länder das Armutsrisiko seit 2012 um zehn Prozent senken können. Polen, Slowenien, Lettland und Litauen reduzierten es sogar um 30 Prozent. Polen etwa, indem es in Familienleistungen investierte, und Slowenien, weil es den Mindestlohn erhöhte.
Die BRD gehört zu den Ländern, in denen die Kinderarmut seit Jahren nicht zurückgeht, sondern sogar steigt. 15,5 Prozent der unter 18jährigen hierzulande sind laut der Untersuchung mit dem bezeichnenden Namen »Kinderarmut inmitten von Wohlstand« derzeit arm. 7,9 Prozent bzw. mehr als eine Million Kinder sind es dauerhaft. Und das ist konservativ gemessen, wie eine UNICEF-Sprecherin gegenüber jW erklärte. Der Paritätische Gesamtverband kommt beispielsweise auf eine Armutsquote von mehr als 21 Prozent bei den unter 18jährigen. In der Gesamtbewertung der UNICEF-Studie landet Deutschland dennoch auf Platz 25 der 39 untersuchten Staaten. Und damit im unteren Mittelfeld. Schlechter sind Staaten wie die USA, Großbritannien, Frankreich oder die Schweiz.
Damit wird ein weiteres wichtiges Ergebnis erkennbar: Ein niedriges Armutsrisiko hängt insgesamt nicht von der Wirtschaftskraft des Landes ab. Beispielsweise hätten Spanien und Slowenien ein ähnlich hohes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, aber Slowenien habe ein wesentlich niedrigeres Armutsrisiko bei Kindern als Spanien. Auch in Deutschland ist die Armut gemessen an der Wirtschaftsleistung hoch.
Um Kinderarmut zu bekämpfen, empfiehlt UNICEF, soziale Sicherungssysteme auszubauen und den Zugang zur Bildungsinfrastruktur zu verbessern. Denn was die BRD da anbietet, ist auch der UN-Organisation zufolge ungenügend. Bei der Berechnung des Existenzminimums würden nicht alle Grundbedarfe von Kindern berücksichtigt. EU-weit investierten Deutschland und Rumänien am wenigsten in den Primarbereich. Bei der Jugendhilfe werde gekürzt.
Als weiteren Hebel sieht UNICEF eine familienfreundlichere Arbeitswelt. Denn 69 Prozent der Kinder aus Familien ohne erwerbstätige Eltern sind hierzulande arm. Bei Kindern aus Paarfamilien, in denen beide Elternteile in Vollzeit arbeiten, ist es nur ein Prozent.
Fazit des Berichts: »Die Politik hat es weitgehend in der Hand, Kinderarmut effektiv zu bekämpfen.« Das Bundesfinanzministerium fühlte sich am Mittwoch nicht zuständig und verwies auf das Familienministerium. Dieses zeigte sich gegenüber jW alarmiert und verwies auf die geplante Kindergrundsicherung.
Dazu wurden am Mittwoch neue Pläne bekannt. So überprüft Bundesfamilienministerin Elisabeth Paus (Bündnis 90/Die Grünen) ihren Zeitplan für die Kindergrundsicherung. Das entsprechende Gesetz solle zwar »zum 1. Januar 2025 in Kraft treten«, berichtete die Süddeutsche Zeitung am Mittwoch aus einem regierungsinternen Papier. Die Regierung prüfe aber nun, »ob und gegebenenfalls wie (…) Anpassungen an diesem Datum nötig sind«. Mit einer späteren beziehungsweise stufenweisen Einführung könnten die Kosten im Einführungsjahr 2025 sinken. Das könnte die »Probleme« beim Haushalt 2025 entschärfen. Denn die Priorität der Bundesregierung liegt bei ausgeglichenen Finanzen und nicht bei Kindern oder Armen.
Quelle: junge Welt vom 07.12.2023/ Gustavo Rezende/Pixabay [M] Mehr als jedes fünfte Kind hierzulande ist arm

Kampf um die Wahrung der Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 28.11.2023, Seite 9 / Kapital & Arbeit
UN-STUDIE
Ein Drittel arm
Armut in Lateinamerika und der Karibik auf dramatisch hohem Niveau. Länder der Region wenden sich vom Westen und seinen Krisen ab
Von Volker Hermsdorf
Ein Drittel der rund 630 Millionen Menschen in Lateinamerika und der Karibik lebt in Armut. Wie die UN-Wirtschaftskommission für die Region (CEPAL) in ihrem jüngsten Sozialbericht mitteilte, reicht das Einkommen von mehr als 181 Millionen Menschen nicht aus, um ihre Grundbedürfnisse zu decken. Rund 70 Millionen – das sind 11,2 Prozent der Bevölkerung – leben sogar in extremer Armut. Zwar seien die Zahlen 2022 im Vergleich zum Vorjahr etwas gesunken und lägen wieder auf dem Niveau von vor der Coronapandemie, doch »es gibt keinen Grund zum Feiern«, warnte CEPAL-Exekutivsekretär José Manuel Salazar-Xirinachs am Wochenende.
Die Autoren der Studie gehen davon aus, dass die Armut trotz »kleiner Fortschritte« im kommenden Jahr nicht weiter zurückgehen wird, da das regionale BIP-Wachstum 2023 voraussichtlich nur 1,7 Prozent betragen wird. Mit geschätzten 1,5 Prozent dürfte es im kommenden Jahr sogar noch unter den 3,8 Prozent von 2022 liegen. Es sei nicht hinnehmbar, dass sich 70 Millionen Menschen nicht die notwendigen Grundnahrungsmittel leisten könnten, sagte Salazar-Xirinachs. Er wies darauf hin, dass der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die in Armut leben, von 29 Prozent auf 42,5 Prozent gestiegen sei. Auch bei Frauen, der indigenen Bevölkerung und den Bewohnern ländlicher Gebiete sei die Armut explodiert. »Eine Realität, die wir nicht tolerieren können«, so der aus Costa Rica stammende CEPAL-Chef.
Auch andere Ergebnisse der Studie sind alarmierend. So geht der Untersuchung zufolge die Hälfte der 292 Millionen Erwerbstätigen in Lateinamerika und der Karibik nur informellen Beschäftigungen nach. In der Folge leben 20 Prozent der Erwerbstätigen trotz Arbeit in Armut, während 40 Prozent ein Einkommen unterhalb des Mindestlohns beziehen und die Hälfte keine Beiträge in die Rentensysteme einzahlt. »Der Zugang zu produktiven, gut bezahlten und sozial abgesicherten Arbeitsplätzen ist insbesondere für Frauen und junge Menschen notwendig«, heißt es in dem Bericht. Als Haupthindernis für die Integration von Frauen in den regulären Arbeitsmarkt wird ihre Belastung durch die Kinderbetreuung gesehen. Zudem sei eine der wichtigsten Beschäftigungsquellen für Frauen in Lateinamerika immer noch die Arbeit als Hausangestellte. Das durchschnittliche Einkommen in diesem Bereich ist jedoch nur halb so hoch wie das von Frauen in anderen Berufen.
Ein weiteres Problem ist die ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen. Die CEPAL-Studie stellt fest, dass im Jahr 2021 105 Personen über ein Vermögen verfügten, das fast neun Prozent des Vermögens der gesamten Region ausmachte. Auch wenn die Einkommensungleichheit 2022 wieder unter das Niveau von 2019 gesunken ist, sei soziale Gerechtigkeit noch lange nicht in Sicht.
»Die Region befindet sich nach wie vor in einer strukturellen Doppelfalle aus niedrigem Wachstum und einem hohen Maß an Armut und Ungleichheit«, sagte Salazar-Xirinachs. Die Länder müssten mehr Menschen in den regulären Arbeitsmarkt integrieren und gleichzeitig sicherstellen, dass reguläre Arbeitsplätze für alle – unabhängig von Alter, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit oder anderen Merkmalen – zu gleichen Chancen und Bedingungen zugänglich sind. Voraussetzung dafür sei allerdings ein hohes und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, fügte der CEPAL-Chef hinzu. Dafür brauche Lateinamerika faire und leistungsfähige Partner.
Immer mehr Regierungen der Region ziehen dabei die Zusammenarbeit mit den Mitgliedsländern des BRICS-Bündnisses derjenigen mit den USA oder der EU vor. Denn während Armut und Ungleichheit in Lateinamerika zumindest minimal zurückgehen, nehmen sie in der EU zu. Auch die Wachstumserwartungen werden dort aktuell nach unten korrigiert. Schon vor dem Karlsruher Haushaltsurteil hatte die EU-Kommission geschätzt, dass die deutsche Wirtschaft 2023 um 0,4 Prozent schrumpfen und die gesamte EU mit nach unten ziehen wird. »Deutschland wird zum Schlusslicht in Europa«, kommentierte jüngst das Wirtschaftsnachrichtenportal Business Insider. Schon heute ist jeder sechste Erwachsene und rund ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen in der BRD arm. Für Lateinamerikaner keine attraktive Alternative zur eigenen Krise.
Quelle: junge Welt v.28.11.2023/ REUTERS/Amanda Perobelli
Mehr als elf Prozent der Bevölkerung in der Region leben in extremer Armut (Elendsviertel von São Paulo, Brasilien)

Kampf um dir Menschenrechte
300 Anwälte verklagen den "zionistischen Staat" beim Internationalen Strafgerichtshof
15 Nov. 2023 17:07 Uhr
Anwälte aus aller Welt haben gegen den Staat Israel wegen Völkermords und Kriegsverbrechen gegen das palästinensische Volk eine gemeinsame Klage beim IStGH eingereicht. Vertreter aus der Zivilgesellschaft haben sich ihnen angeschlossen.
Ein internationaler Zusammenschluss von ungefähr 300 Rechtsanwälten und rund 100 Vertretern der Zivilgesellschaft reichte am 9. November beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag (IStGH) Klage gegen den "zionistischen Staat" ein. Wie das algerische Nachrichtenportal cip am Dienstag berichtete, verklagte das Anwaltskollektiv aus aller Welt den Staat Israel wegen Völkermords und Kriegsverbrechen gegen das palästinensische Volk.
Die kollektive Klage wurde vom französischen Rechtsanwalt und Rechtswissenschaftler Gilles Devers aus Lyon initiiert. Der Anwalt gab dazu eine Erklärung ab, die am Montag vom Radio Algérie Internationale des Algerischen Rundfunks veröffentlicht wurde.
Demnach wollten die Kläger nach dem Einreichen der Klage beim IStGH nun als nächsten Schritt ein Treffen der Opfer organisieren. Devers erklärte, dass "der zweite Schritt im nächsten Monat stattfinden wird, indem ein Treffen mit den Opfern organisiert wird". Der Rechtsanwalt sagte darüber hinaus:
"Was wir zur Unterstützung des palästinensischen Volkes als Opfer tun konnten, ist die Klage, die beim IStGH gegen die zionistische Regierung eingereicht wurde. Wir rufen alle Länder der Welt dazu auf, sich dieser Initiative anzuschließen. Wir werden unseren Kampf fortsetzen."
Die größten Sorgen bereiteten dem Anwalt die unaufhörlichen "zionistischen Bombenangriffe" auf Krankenhäuser, insbesondere auf das Al-Shifa-Krankenhaus.
"Viele Verletzte und Patienten sind umgekommen. Das ist etwas, was wir in unserer Geschichte noch nie gesehen haben. Es ist nicht einmal mehr möglich, eine Beerdigung für die Opfer abzuhalten, da die Sicherheitslage wirklich beeinträchtigt ist", beklagte er im algerischen Rundfunk.
Am Donnerstag fand eine Pressekonferenz zur Menschenrechtsklage des internationalen Anwaltteams statt, die von Rechtsanwalt Devers, Pierre Galand, ehemaliger Senator und Mitglied der belgischen Sozialistischen Partei, und Rechtsanwalt Khaled Al-Shouli aus Jordanien geleitet wurde. Die Moderatoren erklärten, angesichts all derer, die sich durch ihr Schweigen zu Komplizen dieses Völkermords machen, müsse man das palästinensische Volk unterstützen.
In der Meldung "Israel-Palästina: Was die internationale Justiz unternimmt" wird die Kollektivklage gegen Israel am Dienstag auch auf der französischsprachigen Nachrichtenseite der UNO kurz erwähnt. Darin heißt es, diese Klage sei bereits am 8. November eingereicht worden, und zwar von nur circa 100 Juristen:
"Eine dritte Klage wegen "Völkermords" in Gaza wurde am 8. November von einem Kollektiv eingereicht, das aus rund 100 Juristen aus mehreren Ländern besteht, darunter Mitglieder der Anwaltskammer in Algerien, einfache Privatpersonen und Vertreter von Vereinigungen, die von dem französischen Anwalt Gilles Devers vertreten wurden."
Quelle: RTD. V.15.11.2023
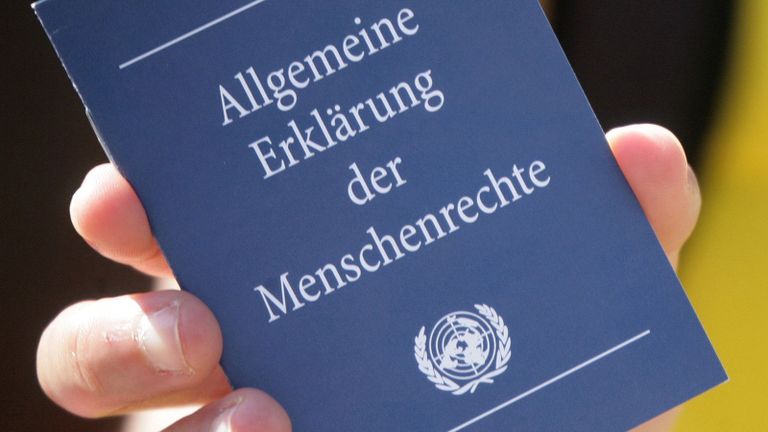
Israel verstößt gegen Menschenrechte und gegen das Völkerrecht
Standing Ovations in Irland: "Israel muss vor internationalen Strafgerichtshof"
13 Nov. 2023 17:11 Uhr
Auf dem Parteitag der irischen Sinn Féin forderte die Parteivorsitzende, Mary Lou McDonald, am Samstag die irische Regierung dazu auf, Israel vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen.
In ihrer Rede forderte sie auch, den israelischen Botschafter auszuweisen. Sie fragte: "Wo ist der Schutz durch das Völkerrecht für jedes in Gaza getötete Kind, für jede Gaza-Mutter, die den kalten Körper ihres toten Kindes hält? Es kann nicht sein, dass Israel ungestraft Gräueltaten begehen darf. (…) Deshalb muss die irische Regierung die Führung übernehmen und Israel vor den internationalen Strafgerichtshof bringen und den israelischen Botschafter nach Hause schicken", fügte sie hinzu.
https://freeassange.rtde.live/kurzclips/video/186903-standing-ovations-in-irland-israel/
McDonald merkte auch an, dass die jüdische Gemeinschaft unter denjenigen ist, die am stärksten einen Waffenstillstand fordern. "Ihr Ruf entspringt dem unvorstellbaren Horror und dem kollektiven Trauma, das ihrem Volk zugefügt wurde. Und im Namen der Menschlichkeit sagen sie: Nie wieder! Nicht noch an einem weiteren Volk! Wir stehen an ihrer Seite."
Quelle:_ RT v.13.11.2023

Info über Kuba
Aus: Ausgabe vom 13.11.2023, Seite 6 / Ausland
INTERNATIONALES RECHT
Blockade vor Gericht
Internationales Tribunal in Brüssel über US-Politik gegen Kuba und ihre Folgen
Von Volker Hermsdorf
Ein seit mehr als 60 Jahren ungesühntes Verbrechen gegen Menschen- und Völkerrecht kommt ab Donnerstag in Brüssel endlich vor ein internationales Gericht. Bei dem zweitägigen Tribunal in der belgischen Hauptstadt geht es um die längste und umfangreichste Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade, die je gegen ein Volk verhängt wurde. Die Täter werden sich allerdings auch nach dem Urteilsspruch weiter der Verantwortung für den Tod Tausender und die Gefährdung der Leben von Millionen Menschen entziehen und ihre kriminellen Handlungen fortsetzen können. Denn auf der Anklagebank sitzt die Regierung der USA. Washington hat alle 31 seit 1992 nahezu einstimmig gefällten Abstimmungen der UN-Vollversammlung ignoriert, die das Ende der US-Sanktionen gegen Kuba fordern. Obwohl das Tribunal eher symbolischen Charakters hat, hoffen die Veranstalter, dass Verhandlung und Urteile am Hauptsitz der EU mehr als ein moralischer Appell sein und dazu beitragen könnten, dass der weltweite Widerstand gegen die US-Blockade deutlicher wahrgenommen wird.
Die Ergebnisse seien zwar rechtlich nicht bindend, könnten jedoch zum »Aufruf und Auftakt für eine breite politische und juristische Kampagne« werden, begrüßte der Vorsitzende des kubanischen Instituts für Völkerfreundschaft (ICAP), Fernando González, am Freitag in Havanna die Initiative europäischer und US-amerikanischer Gewerkschaften, Juristenvereinigungen und Aktivisten. Die Protokolle der Beweisaufnahme, der Zeugenaussagen und des Richterspruchs seien wichtige Arbeitsmaterialien für die Argumentation »im Kampf gegen die völkermörderische Politik der USA«, sagte er. Brüssel sei als Tagungsort wichtig, weil alle EU-Mitgliedsländer von den Folgen der extraterritorialen Ausweitung der US-Blockade auf Drittstaaten betroffen seien.
Unter dem Vorsitz des Völkerrechtlers Norman Paech will ein aus fünf Richtern bestehendes Gremium zahlreiche Zeugen vernehmen und Beweise über die Auswirkungen der Blockade auf die Bevölkerung Kubas sowie Personen und Unternehmen in anderen Teilen der Welt prüfen. Paech wird dabei von dem italienischen Handelsrechtsexperten Simone Dioguardi, dem portugiesischen Verwaltungsrechtler João Ricardo Duarte, dem griechischen Staatsrechtsprofessor Dimitris Kaltsonis sowie der US-amerikanischen Menschenrechtsanwältin und Verfassungsrechtlerin Mara Verheyden-Hilliard unterstützt. Als Chefankläger fungiert der belgische Anwalt und Vorsitzende der Internationalen Vereinigung demokratischer Juristen, Jan Fermon. Zeugen sind neben Opfern der Blockade aus Kuba unter anderem der ehemalige dänische Außenminister und Vorsitzende der UN-Generalversammlung Mogens Lykketoft, der spanische EU-Abgeordnete und ehemalige Präsident des EU-Parlaments Miguel Ángel Martínez, die Journalisten Pascual Serrano (Rebelión) und José Manzaneda (Cuba Información), der Schweizer Arzt und Präsident von Medicuba Europa, Franco Caravalli, sowie Vertreter europäischer und US-amerikanischer Solidaritätsorganisationen. Neben der Blockade sind die Folgen der Aufnahme Kubas in eine US-Liste von Ländern, die angeblich den Terrorismus fördern, ein Schwerpunktthema.
Bereits vor Beginn haben namhafte Persönlichkeiten das Tribunal begrüßt. »Die Verbrechen der USA gegen Kuba müssen vor Gericht gestellt werden«, forderte Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel. Die Blockade sei »eine Form von Völkermord«, die darauf abziele, einen Aufstand und Staatsstreich zu provozieren, indem sie in der Bevölkerung »eine Situation des Hungers, der Angst und der Not« erzeuge, erklärte der ehemalige Experte des UN-Menschenrechtsrates, Alfred-Maurice de Zayas. Die US-Politik gegenüber Kuba bezeichnete er als einen »Akt der hybriden Kriegführung«. Wer die Blockade gegen Kuba betreibe, ob als Mitglied der US-Regierung oder von Einrichtungen, die sie unterstützen, könne als »Kriegsverbrecher« bezeichnet werden. »Sie sind es, aber es gibt keinen wirklichen internationalen Strafgerichtshof«, der über diese Verbrechen urteilt, begründete de Zayas seine Unterstützung für das Tribunal in Brüssel.
Quelle: junge welt v.13.11.2023/ Jose Cabezas/REUTERS

Israel verstößt gegen Menschenrechte
WHO-Generaldirektor: "Alle 10 Minuten wird ein Kind in Gaza getötet"
11 Nov. 2023 19:26 Uhr
Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates, dass wegen des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der Hamas im Durchschnitt alle zehn Minuten ein Kind im Gazastreifen getötet wird und dass "nirgendwo jemand sicher" sei.
https://odysee.com/
Ghebreyesus fügte hinzu, dass rund 70 Prozent der getöteten Palästinenser Frauen und Kinder seien.
Quelle: RTD.11.11.2023
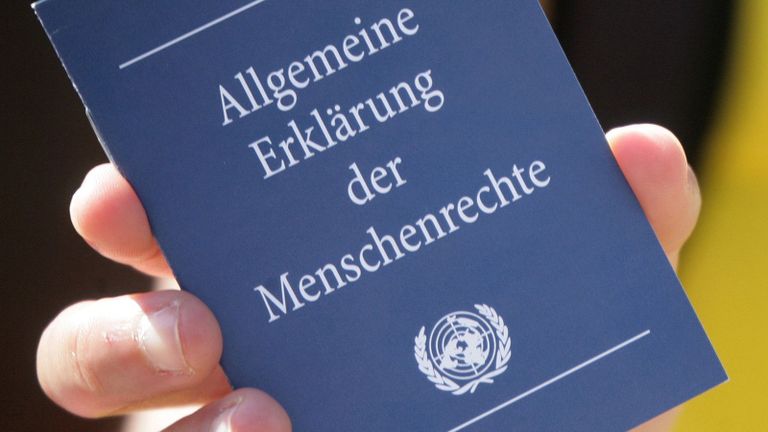
Verstoß gegen das Menschenrecht der Meinungsfreiheit in der BRD
Folgendes Video ist eine Live-Wiedergabe von einer friedlich geführte Demonstration, wo die Teilnehmer für den Frieden in Palästina eintreten:
Das Grundgesetz der BRD gewährleistet die freie Meinungsfreiheit !!!

Stoppt den Völkermord in Palästina !!!
Palästina-Aktion US-Kampagne startet zur Beendigung des israelischen Völkermords an Palästina und zur Schließung von Elbit
Palestine Action US wird Waffenfirmen in den USA schließen, die Israels Völkermord an Palästina bewaffnen.
Eine neue Kampagne wurde gestartet, um Waffenfirmen in den USA zu schließen, die Israels Völkermord an Palästina bewaffnen.
Am Donnerstag, den 12. Oktober, gingen die Organisatoren von Palestine Action US in seinem "Innovation Center" in Cambridge, Massachusetts, direkt gegen Israels größten Waffenhersteller, Elbit Systems, vor. Aktivisten blockierten den Haupteingang von Elbit, damit ihre Angestellten nicht hineinkommen konnten, und tränkten das Gebäude mit roter Farbe und Graffiti, um Elbit als Profiteur israelischer Kriegsverbrechen gegen Palästinenser zu entlarven. "Elbit Systems wird in unserer Stadt nicht wie gewohnt weitermachen, während ihre Waffen gerade jetzt das palästinensische Volk massenhaft ermorden", riefen die Aktivisten, als sie vor Elbits Haustüren eingesperrt wurden. "Kriegsverbrecher arbeiten am Bishop Allen Drive 130!"
Das Büro von Elbit in Cambridge wurde nach der Blockade am Donnerstag noch zweimal angegriffen. An diesem Abend wurde das Gebäude mit Graffiti verunstaltet, auf denen stand: "ELBIT PROFITIERT VOM VÖLKERMORD" und "KRIEGSVERBRECHER ARBEITEN HIER". Dann, am Sonntag, wurden Schlüsselkartenscanner an beiden Eingängen in Stücke gerissen, so dass die Mitarbeiter das Gebäude nicht betreten konnten, und das Gebäude wurde mit roter Farbe durchtränkt und Graffiti mit der Aufschrift "GAZA RESISTS" und "ELBIT ARMS GENOCIDE" hinterlassen.
Was Israel Palästina antut, ist nichts weniger als ein Völkermord, und Elbit hat Blut an ihren Händen. Elbit liefert 85 Prozent der israelischen Militärdrohnenflotte, zusammen mit Kugeln, Tränengas, landgestützter Ausrüstung und international geächteten Waffen. Allein in Gaza hat Israel seit dem 7. Oktober über 3.500 palästinensische Männer, Frauen und Kinder mit Elbit-Waffen ermordet und über 12.000 verletzt, wobei Tausende noch immer unter den Trümmern vermisst werden, als Vergeltung für die Al-Aqsa-Flut-Widerstandsoperation. Gestern beging Israel ein absolut schreckliches Kriegsverbrechen, indem es das Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza-Stadt aus der Luft angriff und mindestens 500 Palästinenser massakrierte, wobei Tausende noch immer unter den Trümmern vermisst werden – Ärzte, Patienten und Familien, die in das Krankenhaus geflohen waren, um Schutz zu suchen, nur um erneut bombardiert zu werden. Alle 15 Minuten wird in Palästina ein Kind ermordet. Diese Bombenangriffe dienen nicht nur der ethnischen Säuberung des Gazastreifens, sondern werden von Elbit auch dazu benutzt, ihre Waffen an repressive Regime auf der ganzen Welt zu vermarkten – von Kaschmir über Aserbaidschan bis zur Grenze zwischen den USA und Mexiko. Indem wir Elbit angreifen, zerstören wir ein entscheidendes Glied im Militärapparat des westlichen Imperialismus.
Palestine Action US fordert die Menschen der Welt auf, diese Zahlen mit der Ernsthaftigkeit zu verinnerlichen, die sie verdienen, den tiefen Terror und die Trauer anzuerkennen, die die Palästinenser seit Generationen erleben, und dort zu handeln, wo wir leben, um diesen 75 Jahre andauernden nackten Völkermord zu stoppen, der sich immer noch vor unseren Augen entfaltet. Solange wir Elbit erlauben, in unseren Gemeinden zu arbeiten, hat jeder von uns Blut an seinen Händen.
Die Solidarität mit Palästina verlangt, dass wir Elbit Systems und alle Waffenentwickler als Produzenten von Völkermord entlarven.
Die Solidarität mit Palästina verlangt von uns, dass wir direkte Maßnahmen ergreifen, bis Elbit seine Instrumente der Überwachung, der Unterdrückung und des Terrors aus unseren Gemeinschaften heraus nicht mehr "erneuern" kann.
Die Solidarität mit Palästina erfordert, dass wir die US-Kriegsmaschinerie in all ihren Formen unterbrechen, denn Elbits Waffen ermorden unterdrückte und kolonisierte Menschen auf der ganzen Welt, nachdem sie an Palästinensern "kampferprobt" wurden.
Wir machen die Palästina-Aktion zu einer transatlantischen Bewegung.
Anhaltende direkte Aktionen können dazu führen, dass das Geschäft für Elbit nicht mehr funktioniert. In Großbritannien ist dies bereits der Fall, wo Palestine Action nach unerbittlichen direkten Aktionen und einer Reihe von Verhaftungen eine Elbit-Fabrik und ihr Londoner Hauptquartier dauerhaft geschlossen hat. Nach den Aktionen der letzten Woche entfernte Elbit die Adresse seiner Einrichtung in Cambridge, Massachusetts, von seiner Website.
Sie haben Angst vor der Macht der Gemeinschaft, sich ihrer Kriegsgewinnlerei zu widersetzen.
Seit dem Lockdown am Donnerstag und den anschließenden Störungen in den USA und Großbritannien sind die Aktienkurse von Elbit gefallen, während die Gewinne aller anderen Waffenhersteller in die Höhe schnellen. Elbit ist nicht nur in Massachusetts tätig, sondern auch in New Hampshire, Pennsylvania, Virginia, Texas, Florida, Alabama und South Carolina. Stellen Sie sich vor, was eine landesweit koordinierte direkte Aktion gegen Elbit bringen wird.
Es ist jetzt an der Zeit zu handeln. Wir werden Elbit Systems und jede Waffenfirma schließen, die Israels Völkermord an Palästina bewaffnet. Um in Kontakt zu bleiben, folgen Sie uns @pal_actionus und kontaktieren Sie uns unter PalestineActionUS@protonmail.com.
Quelle: progressiv International v.23.10.2023

Der Kampf für den Frieden & Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 21.10.2023, Seite 8 / Ansichten
KOMMENTAR
Fässer ohne Boden
Kriege und US-Geopolitik
Von Jörg Kronauer
2023-1ALESTINIANS-BIDEN.JPG
Und wieder griff Joseph Biden in die unterste Schublade, die mit dem besonders übel stinkenden Dreck. »Wir können und wollen Terroristen wie die Hamas und Tyrannen wie Putin nicht gewinnen lassen«, warf er am Freitag, gerade aus Israel heimgekehrt, vom Oval Office aus in die Welt. Putin und die Hamas in einem Topf? Wer sich mit derart abstrusen Parolen an die Öffentlichkeit wagt, will entweder die stumpfeste Fraktion der härtesten US-Rechten für sich einnehmen, oder er hat ein Problem. Auf den US-Präsidenten trifft beides zu.
Biden hat sogar mehrere Probleme. Eines davon: Da stecken die Vereinigten Staaten und ihr Anhang seit mehr als eineinhalb Jahren Dutzende Milliarden US-Dollar in die Aufrüstung der Ukraine – und was geschieht? Die stolz mit Vorschusslorbeeren überschüttete ukrainische Offensive ist gescheitert. Immer mehr in den USA, insbesondere auf der Rechten, meinen: Nein, die Ukraine ist ein Fass ohne Boden. Nur, kann man Kiew denn einfach so den Hahn abdrehen? Die Ukraine wäre früher oder später verloren. Das darf nicht sein.
Nun kommt ein zweites Problem hinzu. Die Hamas hat mit einem Massaker Israel zu einem neuen Krieg provoziert. Kommt die Bodenoffensive, dann droht in Nah- und Mittelost ein Flächenbrand. Zumindest diejenigen Milizen in der Region, die eng mit Iran kooperieren, könnten dann losschlagen – die libanesische Hisbollah, Milizen in Syrien etwa; in den vergangenen Tagen griffen schiitisch-irakische Milizen, um einen Vorgeschmack zu geben, US-Militärstützpunkte in Syrien und im Irak an, während ein US-Kriegsschiff Huthi-Raketen aus dem Jemen abfing. Können die Vereinigten Staaten sich in dem mörderischen Inferno, das sich deutlich abzeichnet, aus dem Staub machen? Nein.
Sie haben also – so sieht bzw. fürchtet es Biden – in Kürze zwei Kriege am Hals. Biden hat, um vielleicht doch noch das Schlimmste zu verhindern, die israelische Regierung gewarnt, nicht denselben Fehler zu begehen wie die USA nach 9/11 und mit plumpen Gewaltorgien in eine strategische Niederlage zu steuern. Ob seine Einwände in Tel Aviv fruchten – man darf es bezweifeln. Dem US-Präsidenten bleibt also nur, die Mittel für beide Kriege aufzutreiben. Dafür braucht er nach Lage der Dinge eben die stumpfeste Fraktion der US-Rechten. Was tun? Nun, vielleicht kann man die Trumpisten ja mit einem hirnlosen Schenkelklopfer gewinnen. Also wirft Biden Putin und die Hamas in einen Topf.
Nur: Selbst wenn der Trick wirkt – und das ist beileibe nicht ausgemacht –, bleibt ein drittes Problem. Dass die USA sich aus Afghanistan komplett und weitgehend aus dem Nahen und Mittleren Osten zurückgezogen haben, das hatte einen Grund: Sie brauchen die militärische Hardware und das Geld für ihren Machtkampf gegen China. Alles, was in der Ukraine versumpft oder im Mittleren Osten verbrennt, fehlt letztlich in der Asien-Pazifik-Region. Dagegen hilft auch kein Wurf mit stinkendem Dreck.
Quelle: junge Welt v.21.10.2023/ Jonathan Ernst/REUTERS
Joseph Biden spricht zu seiner Nation (19.10.2023)

Protest gegen Verletzung der Menschenrechte und des Völkerrechts
Aus: Ausgabe vom 20.10.2023, Seite 1 / Titel
KRIEG IN NAHOST
Spanien klagt an
Linkspolitikerin verurteilt Kriegsverbrechen Israels in Gaza. Sanktionen auf EU-Ebene gefordert. Abbruch diplomatischer Beziehungen?
Von Volker Hermsdorf
In der EU und in Lateinamerika nimmt die Kritik an Israels Vorgehen in Gaza zu. Die spanische Ministerin für soziale Rechte und Vorsitzende der Linkspartei Podemos, Ione Belarra, forderte ihren sozialdemokratischen Koalitionspartner jetzt sogar auf, die diplomatischen Beziehungen zu Israel auszusetzen. Sie reagierte damit auch auf Unterstellungen der Botschaft des Landes nach einer Kritik an israelischen Massakern: Nachdem Belarra eine Untersuchung des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wegen Kriegsverbrechen gefordert hatte, erklärte die Botschaft Tel Avivs, »gewisse Mitglieder der spanischen Regierung haben entschieden, sich auf die Seite dieses IS-ähnlichen Terrorismus zu schlagen«.
Statt einzuknicken, bekräftigt die Politikerin nun ihre Kritik und legte nach. »Ich habe heute unseren Partner, den PSOE, gebeten, den Kampf gegen den geplanten Völkermord, den Israel am palästinensischen Volk verübt, ernster zu nehmen. Deshalb bin ich der Meinung, dass wir die diplomatischen Beziehungen zum Staat Israel dringend aussetzen sollten«, sagte Belarra am Mittwoch vor Journalisten in Madrid. Sie forderte die Regierung zudem auf, sich auf EU-Ebene für Wirtschaftssanktionen »gegen die Verantwortlichen für diese Taten, Premierminister Netanjahu und seine gesamte Regierung« und für ein Waffenembargo einzusetzen, »um den wahllosen Bombardierungen der Zivilbevölkerung ein Ende zu bereiten«. Spanien hatte am 1. Juli den Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernommen.
Vizepräsidentin Yolanda Díaz vom linken Bündnis »Sumar«, dem auch Podemos angehört, warnte zwar davor, den Krieg »in die interne Debatte über die spanische Politik« einzubringen, verurteilte aber ebenfalls die Bombardierung des Krankenhauses in Gaza als Kriegsverbrechen. Nicht überraschend warf der oppositionelle rechte Partido Popular (PP) den Ministerinnen pauschal »Antisemitismus« vor. Der PP-Politiker Esteban González habe Premier Pedro Sánchez (PSOE) im Namen seiner Partei aufgefordert, derartige Positionen innerhalb der Regierung »auszurotten«, berichtete die Agentur Efe. Demgegenüber wies der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch in einer Debatte im EU-Parlament darauf hin, dass die Unterbrechung der Wasserversorgung von Zivilisten »gegen internationales Recht verstößt« und es Europa »an moralischer Autorität mangelt«, wenn es sich darauf beschränkt, solche Fälle nur dann anzuprangern, wenn sie in der Ukraine geschehen.
Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping erklärte bei einem Treffen in Beijing am Donnerstag mit dem ägyptischen Premier Mustafa Madbuli, eine »Feuerpause und ein Ende des Krieges« habe oberste Priorität. Die Volksrepublik sei bereit, mit Ägypten und anderen arabischen Ländern eine langanhaltende Lösung für die »Palästina-Frage« zu koordinieren. Die USA dagegen hatten am Mittwoch im UN-Sicherheitsrat ihr Veto gegen einen Antrag Brasiliens eingelegt, in dem eine »humanitäre Feuerpause« und die Freilassung der Geiseln gefordert wurde. In Lateinamerika nimmt die Kritik am Westen nicht nur deswegen zu. Chiles Präsident Gabriel Boric bezeichnete die israelische Bombardierung des Gazastreifens als »barbarisch«. Und Kolumbiens diplomatische Beziehungen zu Israel stehen nach Einschätzung der Tageszeitung El País kurz vor dem Abbruch, nachdem Staatschef Gustavo Petro der Regierung Netanjahu ebenfalls Völkermord vorgeworfen hatte.
Quelle: junge welt v.20.10.2023/ Albert Gea/REUTERS
Protestdemonstration in Barcelona (11. Oktober)

Verhöhnung des Völkerrechts
Aus: Ausgabe vom 17.10.2023, Seite 8 / Abgeschrieben
Rheinmetall entwaffnen: Keine Waffen ins Kriegsgebiet!
In einer Stellungnahme von »Rheinmetall entwaffnen« vom Sonntag zur Eskalation des Krieges in Nahost heißt es:
Als antimilitaristisches Bündnis »Rheinmetall entwaffnen« wollen wir uns zu dem Umgang in der BRD mit der aktuellen Eskalation des Konflikts zwischen Israel und Palästina äußern. Seit Jahrzehnten herrscht ein asymmetrischer Krieg zwischen Israel und der palästinensischen Bevölkerung in Gaza und den besetzten Gebieten, welcher Ausdruck eines ungelösten politischen Konflikts ist. Ein Krieg, in dem es immer wieder zu Massakern an der Zivilbevölkerung kommt. Wir verurteilen diese Verbrechen – und den Krieg, in dem Millionen Menschen der Zugang zu Wasser, Strom und Lebensmitteln abgestellt wird. Ein Krieg, in dem schon wieder Hunderttausende vertrieben werden. Ein Krieg, an dem mehr Akteure als nur Israel und die Hamas beteiligt sind. Auch Deutschland ist durch die Lieferung von Kriegswaffen involviert. Medien und Politik versuchen derzeit jeglichen sichtbaren Widerspruch zur israelischen Kriegführung zu verhindern.
Wir werden durch die Medien mit schrecklichen Bildern von sexualisierter Gewalt der Hamas gegen Frauen konfrontiert. Bilder, wie es sie in jedem Krieg gibt. In jedem Land, in dem Krieg geführt wird, gilt die Unterwerfung von Frauen als Symbol des Sieges über den Gegner. Wir verurteilen diese sexualisierte Gewalt an Frauen als Inbegriff patriarchaler Gewalt. Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt im Krieg sind nur möglich, weil sie als Ausdruck patriarchaler Gewalt weltweit geduldet und eingesetzt werden. Ob in Israel, Palästina, Kurdistan oder sonstwo. Wir verurteilen aber ebenso die Instrumentalisierung dieser Bilder, welche hier gezielt medial genutzt werden, um die Angriffe Israels auf die Bevölkerung des Gazastreifens zu rechtfertigen.
Mit dem Bekenntnis zur »uneingeschränkten Solidarität« deutscher Politiker:innen dem israelischen Staat gegenüber trägt die BRD auch zur Entmenschlichung der gesamten palästinensischen Bevölkerung bei. Palästinenser:innen werden vom Staat Israel gerade durchweg als Terroristen, »menschliche Tiere« oder pauschal als antisemitisch dargestellt. Deutschland stellt sich auf die Seite des israelischen Staates, welcher verlautbaren lässt, die seit Jahrzehnten stattfindende mörderische Unterdrückung im Freiluftgefängnis Gaza weiter zu intensivieren.
Die BRD unterdes deklariert jegliche Solidaritätsbekundungen mit dem palästinensischen Volk als feindliche Handlung und behandelt sie auch so. Dies geht soweit, dass selbst eine Kundgebung der »Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost« verboten wurde und die palästinensische Autorin Adania Shibli ihren Literaturpreis nicht auf der Frankfurter Buchmesse verliehen bekommt. Antikriegskundgebungen und propalästinensische Demonstrationen werden medial als antisemitische Hassdemos diffamiert und mit Repression überzogen. Organisationen wie die Gefangenenunterstützungsorganisation Samidoun sollen verboten werden. Ohne jegliche rechtliche Grundlagen verbietet die Polizei das Zeigen von palästinensischen Flaggen und Symbolen.
Wir akzeptieren nicht, wenn jegliche Kritik an der Politik des israelischen Staates mit Antisemitismus gleichgesetzt wird. Wir stellen uns gegen die rassistische Hetze und stehen an der Seite fortschrittlicher Kräfte in Israel und Palästina gegen Krieg und Besatzung.
Quelle: junge welt v.17.10.2023/ Hartenfelser/IMAGO
Protestaktion von »Rheinmetall entwaffnen« im September 2022 in Kassel

Verstoß gegen Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 17.10.2023, Seite 2 / Ausland
KRIEG GEGEN GAZA
»Eine totale Verhöhnung des Völkerrechts«
Über das Recht auf Selbstverteidigung, Kriegsverbrechen im Gaza-Krieg und die Rolle der BRD. Ein Gespräch mit Norman Paech
Interview: Jamal Iqrith
Norman Paech ist Jurist und emeritierter Professor für Politikwissenschaft und Öffentliches Recht an der Universität Hamburg
Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei einer Regierungserklärung am vergangenen Donnerstag erklärt, Israel habe im Gazastreifen ein »völkerrechtlich verbrieftes Recht auf Selbstverteidigung«. Wo ist das festgelegt?
In Artikel 51 der UN-Charta ist deutlich verankert, dass derjenige, der militärisch angegriffen wird, ein solches Verteidigungsrecht hat. Das stimmt auch in diesem Fall: Israel kann sich gegen den Angriff der Hamas verteidigen, was allerdings mit der Einschränkung versehen ist, dass solch eine Verteidigung immer verhältnismäßig sein muss. Wenn die israelische Armee im Gazastreifen, der ohnehin seit Jahrzehnten abgeriegelt ist, ein wahres Blutbad anrichtet, ist das auf keinen Fall durch das Verteidigungsrecht nach Artikel 51 gedeckt.
Gilt Artikel 51 auch für eine Besatzungsmacht im von ihr besetzten Gebiet?
Ja. Aber der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zwischen Mittel und Zweck ist zentral. Eine Verteidigung hat sich stets innerhalb der Grenzen des humanitären Völkerrechts, die insbesondere in den »Haager« und »Genfer« Konventionen verankert sind, zu halten. Der Angriff ist erfolgreich zurückgeschlagen worden. Wenn die Armee aktuell darüber hinausgeht und erklärt: »Wir vernichten die Hamas«, und der Zivilbevölkerung Energie und Nahrung abschnürt, dann ist das bereits eine Überschreitung des Gebots der Verhältnismäßigkeit und daher völkerrechtswidrig.
Die Hamas und andere palästinensische Fraktionen berufen sich auf das »Recht zum bewaffneten Widerstand gegen die Besatzung«. Was hat es damit auf sich?
Völkerrechtlich gesehen ist auch das eine richtige Forderung, denn die israelische Besatzung ist völkerrechtswidrig und also wie ein Angriff. Nun wird behauptet, der Gazastreifen sei, nachdem die Siedler und die Armee sich 2006 aus dem Gebiet zurückgezogen haben, nicht mehr besetzt. Das stimmt nicht. Die Blockade wird international – auch durch das Auswärtige Amt – als rechtswidrige Besatzung gewertet. Gegen eine solche darf man sich verteidigen. Allerdings auch hier mit der Einschränkung, die Vorschriften des humanitären Völkerrechts einzuhalten. Zivilisten sind absolut tabu, das hat die Hamas verletzt.
Der Gazastreifen ist seit 2007 abgeriegelt, im aktuellen Krieg wurde eine vollständige Belagerung der Bevölkerung verhängt. Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
Das ist ein Kriegsverbrechen. Die Abschnürung von Energie, Nahrungsmitteln etc. ist ebenfalls rechtswidrig. Die Blockade war es bisher schon. Diese zusätzlichen Maßnahmen, die eine heftige Verschlechterung der Lebensbedingungen der Zivilbevölkerung in Gaza bedeuten, die bis hin zum Verhungern, Verdursten und Krankheit führen, sind Kriegsverbrechen und völkerrechtlich absolut verboten.
Die israelische Regierung hat am Freitag 1,1 Million Einwohner von Gaza-Stadt dazu aufgefordert, ihre Häuser in Richtung Süden zu verlassen. Wie ist das juristisch zu beurteilen?
Es ist eine totale Verhöhnung des Völkerrechts, wenn man sich dabei auf das Verteidigungsrecht der UN-Charta beruft. Die Allgemeinheit kennt die Situation vor Ort. Es gibt genügend Fotos, die zeigen, dass es faktisch gar keine Rückzugsmöglichkeiten für die Menschen im Norden gibt. Es handelt sich offensichtlich um die Vorbereitung, damit Gaza in Schutt und Asche gelegt werden kann. Das ist ein schweres Kriegsverbrechen, das sieht auch die UNO so.
Macht sich Deutschland an diesen Kriegsverbrechen mitschuldig?
Moralisch auf jeden Fall. Inwieweit das juristisch relevant wird, ist noch nicht klar. Wir hätten aber meines Erachtens nicht nur darauf bestehen müssen, dass die Versorgung der Bevölkerung bei der bevorstehenden Bodeninvasion gesichert ist, sondern alle politischen Hebel in Gang setzen müssen, um Netanjahu und sein furchtbares Kabinett davon abzubringen.
Wo soll das hinführen? Selbst wenn man die Hamas »vernichtet« und den Gazastreifen dem Erdboden gleichmacht, den Widerstand des palästinensischen Volkes wird man nicht brechen können. Mit solch einer Aktion wird nie Frieden in dieser Region eintreten. Das ist nur durch Verhandlungen und den Rückzug aus den besetzten palästinensischen Gebieten insgesamt möglich.
Quelle: junge Welt v.17.10.2023/ Anas al-Shareef/REUTERS
Resultat der Luftangriffe: Verheerende Zerstörung im Gazastreifen (Dschabalija, 11.10.2023)

Israel verstößt gegen Menschenrechte
UN-Menschenrechtskommissar: Belagerung von Gaza völkerrechtswidrig
10 Okt. 2023 15:46 Uhr
Die israelische Regierung hat bereits die Strom- und Wasserversorgung des Gaza-Streifens unterbrochen, und will auch die Versorgung mit Nahrung und Benzin blockieren. Der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte hat nun erklärt, diese Handlung verstoße gegen das Völkerrecht.
Quelle: www.globallookpress.com © Eduardo Parra
Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, erklärte, die von Israel geplante Abriegelung des Gaza-Streifens verstoße gegen das Völkerrecht.
"Das internationale humanitäre Recht ist klar: Die Verpflichtung, stetig dafür zu sorgen, dass die Zivilbevölkerung und zivile Objekte geschont bleiben, hat bei allen Angriffen weiter zu gelten."
Die israelischen Behörden, so die Erklärung, habe am 9. Oktober eine "volle Belagerung" von Gaza angeordnet und die Versorgung mit Elektrizität, Wasser, Nahrung und Treibstoff unterbrochen. Dies würde die ohnehin schon schwierige menschenrechtliche und humanitäre Lage in Gaza weiter verschlechtern. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant hatte diese Unterbrechung der Versorgung angekündigt.
"Es ist nach dem internationalen humanitären Recht untersagt, Belagerungen zu verhängen, die die Leben von Zivilisten gefährden, indem sie ihnen Güter verweigern, die von grundlegender Bedeutung für ihr Überleben sind."
Alle Beschränkungen der Bewegungsfreiheit von Menschen und Gütern, um eine Belagerung zu verhängen, müssten durch militärische Notwendigkeit begründet sein, andernfalls stellten sie eine kollektive Bestrafung dar.
"Wir wissen aus bitterer Erfahrung, dass Vergeltung nicht die Antwort ist, und letztlich unschuldige Zivilisten den Preis zahlen", sagte Türk.
Er forderte auch die palästinensische Seite auf, das Völkerrecht zu beachten. Und richtete die dringende Bitte an alle Staaten mit Einfluss, das "Pulverfass" bestehend aus Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten zu entschärfen.
"Die Welt kann sich nicht mehr Polarisierung leisten. Wir müssen Lösungen finden, die durch vollen Respekt vor dem internationalen humanitären Recht und den internationalen Menschenrechtsgesetzen geleitet werden."
Der österreichische Jurist Volker Türk ist seit September 2022 Hoher Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte. Das internationale humanitäre Recht, auf das er sich bezieht, ist das Zusatzprotokoll vom 8. Juni 1977 zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte; Abschnitt IV: Schutz der Zivilbevölkerung.
Quelle: RT. V.10.10.2023/ Volker Türk, UN-Menschenrechtskommissar, 04.10.2023

Kampf um die Einhaltung von Menschenrechten
Europas Krieg gegen Flüchtlinge befeuert den Aufstieg der extremen Rechten
Die international garantierten Rechte von Flüchtlingen erodieren auf beiden Seiten des Atlantiks.
Die 27 EU-Staaten beschließen stillschweigend noch härtere Maßnahmen gegen Flüchtlinge - und um sie einzudämmen, verbünden sie sich mit Diktatoren. Der reichste Kontinent der Welt wird auch zum habgierigsten – und befeuert damit die Ultrarechten.
Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Truthout veröffentlicht
Die Europäische Union führt Krieg gegen Flüchtlinge.
Italiens rechtsextreme Regierung hat kürzlich den Ausnahmezustand ausgerufen und ihre Häfen hermetisch abgeriegelt. Die anderen EU-Mitgliedsstaaten schauen weg.
Im Februar einigten sich die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder auf härtere Maßnahmen zur Bekämpfung der "illegalen Migration". Dazu gehören vor allem die gegenseitige Anerkennung von Abschiebeentscheidungen und Asylablehnungen sowie die Stärkung des Grenzschutzes, etwa durch neue Infrastruktur, mehr Überwachungskapazitäten und eine bessere Ausstattung der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache Frontex.
Währenddessen werden die Leichen von Hilfesuchenden an die europäischen Küsten gespült. Seit 2014 sind nach Angaben des UN-Hochkommissars für Menschenrechte, Volker Türk, mehr als 26.000 Menschen bei der Überquerung des Mittelmeers ums Leben gekommen oder werden vermisst.
Dies ist sicherlich eine deutliche Unterschätzung des wahren Tributs. Das Forschungsprojekt "Migrant Files" schätzt, dass zwischen 2000 und 2014 bis zu 80.000 Menschen, die aus ihren Ländern geflohen sind, allein im Meer starben – hinzu kämen mindestens genauso viele Opfer, die in Wüsten, Hunger oder Mord verdursten. Und dann gibt es noch diejenigen, die Gewalt oder Vergewaltigung erleben – darunter auch Kinder.
Der Krieg der EU gegen Flüchtlinge hat nicht heute begonnen. Es begann spätestens mit den militärischen Tragödien auf dem Balkan in den 1990er Jahren. Damals versuchten viele Menschen, in westeuropäische Länder zu fliehen.
1993 wurde das deutsche Asylrecht abgebaut, einschließlich einer Änderung des Grundgesetzes, um sich vor der Flucht aus dem ehemaligen Jugoslawien zu "schützen". Bis dahin war jeder politisch Verfolgte, der deutschen Boden erreichte, geschützt. Wer nach der historischen Wende über einen sogenannten sicheren Drittstaat einreiste, konnte sich nicht mehr auf das Asylrecht berufen. Nun hat Deutschland, das oft als das europäische "Powerhouse" bezeichnet wird, das restriktivste Asylrecht aller EU-Mitgliedsstaaten.
Darüber hinaus hat die EU unter Federführung des Bundeskanzleramtes das sogenannte Dublin-Übereinkommen geschaffen, das 1997 in Kraft getreten ist. Mit diesem Abkommen wurden die Länder an den EU-Außengrenzen verpflichtet, Menschen aufzunehmen, die auf der Suche nach Asyl nach Europa kommen.
Dieses System hält Migranten mehr oder weniger von den wohlhabenden nördlichen Ländern fern, während sich die Situation für Flüchtlinge in den ärmeren südlichen Ländern verschlechtert. Geflüchtete sitzen nun in den Grenzstaaten fest, die sie schlecht behandeln oder zwischen den Mitgliedstaaten hin- und hergeschoben werden. Die Ausgestaltung des Dublin-Systems zielt eindeutig darauf ab, Flüchtlinge zu demoralisieren und abzuwehren.
Gleichzeitig schloss die EU sogenannte "Pförtner-Deals" mit der Türkei, Libyen und anderen afrikanischen Ländern ab. Im Rahmen solcher Abkommen kooperiert die EU mit autokratischen Regimen, um Flüchtlinge in ihren Ländern aufzuhalten, sie zurück ins Meer zu schieben, sie in Gefängnisse zu stecken und abzuschieben, während die Regime im Gegenzug Hilfe und Geld erhalten. Auf diese Weise wurden Fluchtwege auf den Kontinent durch verschiedene reale und virtuelle Mauern versperrt und kriminalisiert. Seitdem gibt es im Wesentlichen keine sicheren und legalen Wege für Migranten, in die EU einzureisen.
Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel brachte die Abstoßungsstrategie 2009 in einer Rede vor der Bertelsmann-Stiftung auf den Punkt, als sie feststellte, dass sich auch die Bundesregierung am "Kampf gegen Flüchtlinge" beteilige – sie hätte sagen sollen: Es war Berlin, das die Blockade in der EU nach seinen Interessen durchgesetzt hat.
Während Deutschland in der Folge von dem verschärften Dublin-Verfahren "profitierte" (durch immer geringere Flüchtlingsströme und hohe Entschädigungszahlungen, die aus einem EU-Fonds an alle Mitgliedsstaaten entsprechend ihrer absoluten Flüchtlingszahlen verteilt werden), sah die Bundesregierung als Flüchtlingsschutz in den Hauptaufnahmeländern der EU an den Außengrenzen, wie Griechenland und Italien, tatenlos zu. zunehmend erodiert.
Der reichste Kontinent der Welt mit einer halben Milliarde Menschen konnte sich mit seinen verschiedenen Restriktions-, Abwehr- und Abschottungsmaßnahmen relativ erfolgreich von der Mehrzahl der Schutzsuchenden südlich des Mittelmeers isolieren. In über 30 Jahren hat die "Festung Europa" nur wenige Krisenphasen erlebt, wie zum Beispiel 2015/2016.
Damals erreichte die Situation von Millionen Syrern, Afghanen, Irakern oder Jemeniten auf der Flucht vor Kriegen und Zerstörung einen extremen Tiefpunkt. Die Flüchtlingslager in der Region waren überfüllt und es fehlten an Lebensmitteln und Medikamenten, da die UNHCR-Geberländer zu wenig Geld finanzierten. Und Nachbarländer wie der Libanon oder die Türkei waren nicht mehr in der Lage oder bereit, die schwere Arbeit zu leisten. Die Schutzsuchenden machten sich auf den Weg nach Norden.
Aber müsste nicht zumindest das Prinzip der Kausalverantwortung gelten? Die Kriege der USA und ihrer europäischen Verbündeten im Nahen Osten, der Syrienkrieg und die Unterstützung von Diktatoren und autoritären Regimen durch den Westen haben die Bedingungen geschaffen, vor denen viele Migranten fliehen – wie die Waffenlieferungen der USA oder Deutschlands in den von Saudi-Arabien geführten Krieg im Jemen. Diese Verwüstungen lösten eine Flüchtlingskrise nach der anderen aus, während die Mauern Europas immer höher wurden.
Es wurden auch echte Mauern gebaut, noch bevor Donald Trump sich an die Arbeit an seiner "großen, schönen Mauer" machte – wofür er von den Liberalen in Europa Empörung erntete. An der türkischen Grenze zu Syrien und dem Iran wurde 2018 eine hunderte Kilometer lange und drei Meter hohe Betonmauer fertiggestellt, auf der ein Stacheldraht gespannt wurde. Die EU hat die türkischen Grenzschützer mit Sicherheits- und Überwachungstechnik im Wert von 80 Mio. EUR ausgestattet.
Menschen werden an der Grenze misshandelt, getötet und unter Missachtung des internationalen Flüchtlingsrechts in Kriegsgebiete abgeschoben.
Die Folge: systematische Menschenrechtsverletzungen. Heute werden Flüchtlinge von der EU in Konzentrationslagern in Griechenland festgehalten, trotz heftiger Einwände von Menschenrechtsorganisationen. Viele ertrinken im Mittelmeer, weil Boote illegal ins Meer zurückgedrängt werden.
Über 100 Millionen suchen Schutz
All dies könnte abgemildert oder beendet werden. Experten und NGOs zeigen seit Jahrzehnten die Lösungen auf: Fähren für Flüchtlinge, fair geregelte Zusammenarbeit und Verteilung nach Kapazitäten zwischen den Ländern, Abbau von Barrieren, keine schmutzigen Geschäfte mit Autokraten, Internationalisierung der Asylverwaltung und -versorgung für Schutzsuchende, Harmonisierung der Standards für die Flüchtlingsversorgung und Asylanträge.
Vor allem die Fluchtursachen sollen bekämpft werden. Es gibt genug Lippenbekenntnisse von Regierungschefs, aber keine Taten.
Aber was ist mit der Beschwörung einer "maximalen Belastung" durch die Medien und Politiker, die Staaten davon abhält, mehr zu tun? Gibt es nicht Grenzen der Barmherzigkeit? Die Wahrheit ist: Wir könnten viel mehr tun. Wir verfügen über enorme Fähigkeiten und Ressourcen. Es ist eine Frage des politischen Willens, wie Flüchtlingsorganisationen zu Recht betonen.
Während sich die weltweiten Flüchtlingszahlen allein in den letzten zehn Jahren verdoppelt haben und nun den traurigen Rekord von 100 Millionen gebrochen haben, haben die EU-Länder in diesem Zeitraum bis Ende 2021 3 Millionen Flüchtlingen Schutz gewährt.
Aber vergessen wir nicht, was Kenneth Roth, ehemaliger Geschäftsführer von Human Rights Watch, 2015 sagte, als in Europa Alarm schlug vor einem "Tsunami" verzweifelter Flüchtlinge. "Diese 'Welle von Menschen' ist eher wie ein Rinnsal, wenn man sie mit dem Pool vergleicht, der sie absorbieren muss", sagte er.
Roth hat recht: Die EU ist eine extrem wohlhabende Region mit 500 Millionen Einwohnern, die in den letzten 15 Jahren buchstäblich Billionen ausgegeben hat, um Banken und Konzerne zu retten. So hat die EU-Kommission nach der Finanzkrise zwischen 2008 und 2017 1.564 Milliarden US-Dollar an kapitalähnlichen Hilfen plus 3.924 Milliarden US-Dollar als Liquiditätshilfe für den Finanzsektor bewilligt.
Während der COVID-19-Krise hat die EU ein massives Hilfsprogramm in Höhe von 763 Milliarden US-Dollar aufgelegt, um die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten wiederzubeleben und den von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Unternehmen zu helfen, überlebensfähig zu bleiben.
Und diejenigen, die zu uns kommen, brauchen Hilfe. Wie schon 2015/2016 erhalten die meisten von ihnen heute den Schutzstatus. Die Schutzquote in Deutschland liegt bei 72 Prozent. Bei Syrern und Afghanen sind es sogar 100 Prozent. Sie sind also echte Flüchtlinge. Sie abzuweisen, ist letztlich ein Verstoß gegen ein elementares, gesetzlich garantiertes Menschenrecht, die Genfer Flüchtlingskonvention.
Siebenundneunzig Millionen Flüchtlinge und Binnenvertriebene befinden sich nicht in der EU, sondern in sogenannten Frontstaaten, von denen die meisten Entwicklungsländer sind, die aufgrund grassierender Armut, ausbeuterischer Handelsabkommen und Schuldenvereinbarungen und vieler anderer Sorgen kaum in der Lage sind, die vielen Millionen zu schultern, die auf zusätzliche Hilfe angewiesen sind.
Dank der "Festung Europa" – und natürlich auch dank "Fort America" – bleiben die meisten Geflüchteten also in sogenannten "Höllenexperimenten" gefangen, wie es in einer ARTE TV-Dokumentation einmal hieß. Sie sind in menschenunwürdigen Lagersystemen zusammengepfercht, die wie riesige Zeltghettos aus Wüstensand und Schlamm wachsen.
Elend und Flüchtlingsapartheid sind keineswegs alternativlos. Europa zeigt einmal mehr, wie wir es mit der DDR und den osteuropäischen Flüchtlingen zu Sowjetzeiten getan haben, dass wir auch anders gehen können. Zwischen 1988 und 1992 wanderten innerhalb von fünf Jahren mehr als 2,2 Millionen Bürger aus den ehemals kommunistisch regierten Ländern Osteuropas in die Bundesrepublik Deutschland ein. Warum wurden diese Flüchtlinge aufgenommen? Weil sie während des Kalten Krieges für den Antikommunismus politisch nützlich waren.
Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine vor einem Jahr sind rund 4 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer in der EU angekommen und wurden willkommen geheißen. Polen, das traditionell migrantenfeindlich eingestellt ist, nahm 1,4 Millionen von ihnen auf, während die Polen die Geflüchteten mit Spenden und Hilfe unterstützten.
Obwohl die Regierung in Warschau begonnen hat, die Mittel für Ukrainer zurückzufahren, zeigt eine aktuelle Umfrage, dass 78 Prozent von ihnen in Polen erwerbstätig waren – weil der polnische Staat und die polnische Gesellschaft dafür sorgten, dass ukrainische Flüchtlinge Arbeit finden konnten. Inzwischen hat Deutschland ein unbürokratisches Aufnahmeverfahren für Ukrainerinnen und Ukrainer eingerichtet, das die erschöpfenden Asylanträge aussetzt und vor allem auch die Nutzung von entwürdigenden Massenunterkünften aussetzt.
Das war absolut richtig. Aber es ist heuchlerisch und rassistisch, wenn jetzt plötzlich wieder Flüchtlingspanik geschürt wird – oft aus politischen Gründen – und sich gezielt gegen Afrikaner, Araber und Muslime richtet.
Sicherlich gibt es echte Herausforderungen. Die Unterbringung von Flüchtlingen muss geregelt und ihnen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Aber die Probleme Europas sind hausgemacht und künstlich hergestellt. Der Grund dafür ist, dass die Mittel für die Kommunen gekürzt wurden und keine neuen Mittel in Sicht sind. Das muss sich so schnell wie möglich ändern.
Die Instrumentalisierung der bewusst reduzierten Kapazitäten dieser Kommunen, um Debatten über Grenzsicherung, verschärfte Barrieren, weitere Sabotage des Flüchtlingsschutzes (d.h. Verlagerung von Asylverfahren an die Außengrenze) und Begrenzung der Aufnahme zu instrumentalisieren, löst nicht nur keines der Probleme, sondern fördert auch Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Feindseligkeit in der Bevölkerung.
Wollen die Europäer wirklich wieder die protofaschistische "wir" gegen "die"-Rhetorik befeuern, wie wir es während der letzten "Flüchtlingskrise" getan haben? Damals brachte die Rhetorik von "Menschenströmen", Überfüllung und kriminellen Eindringlingen, die von Liberalen und Sozialdemokraten oft ebenso genutzt wurde wie von rechtsextremen Kräften, die Neonazi-Partei Alternative für Deutschland (AfD) in alle Landtage und in den Bundestag. Überall in Europa hat die Rechte dadurch neue Stärke gewonnen.
Wenn Europa so flüchtlingsfeindlich ist, warum ist es dann nicht aus der UN-Flüchtlingskonvention ausgetreten?
Es gibt wirklich keinen Grund für dieses Gerede von Überforderung, auch wenn die Zahlen nach Jahren rückläufiger Flüchtlingsaufnahmen wieder steigen. Dieser Anstieg ist angesichts der zahlreichen globalen Krisen und der COVID-19-Pandemie auch nicht überraschend.
So lag die Zahl der neu ankommenden Asylsuchenden im Jahr 2022 bei rund 193.000 und damit immer noch unter der von konservativen Parteien immer wieder geforderten Grenze von 200.000. Für 2023 wird jedoch mit einer deutlich höheren Zahl gerechnet. Trotzdem ist dies angesichts der 100 Millionen Menschen, die weltweit Schutz suchen, immer noch ein Rinnsal.
Im Gegensatz dazu hat allein Deutschland über eine Million Ukrainer aufgenommen, die, wie bereits erwähnt, kein Asylverfahren durchlaufen müssen.
Obwohl die Asylsuchenden nur einen kleinen Teil der Aufgenommenen ausmachen, stehen sie im Zentrum der medialen Debatte, die sich wieder auf höhere Barrieren, Abschiebungen und Ablehnung konzentriert, wie es während der letzten "Flüchtlingskrise" der Fall war – eine faktische Abschottungskrise, die mit noch mehr Non-Entrée-Maßnahmen beantwortet wurde.
Der Vorsitzende der konservativen Christdemokraten in Deutschland, Friedrich Merz, spricht wieder davon, dass die Nation die "maximale Belastung" erreicht habe – als sei das eine von den Naturgesetzen festgelegte Größe. Er fordert mehr Schutz des EU-Territoriums und Asylzentren an den Grenzen – eine recycelte AfD-Forderung. Eigentlich wollen die Rechtsextreme und der neue Sonderbeauftragte der Bundesregierung für Migrationsabkommen, Joachim Stamp (Liberale), diese Zentren in afrikanischen Ländern aufbauen.
Diese Rhetorik ist ein populistisches Ablenkungsmanöver ohne Grundlage, das den Menschen Sand in die Augen streut über die Realität, einschließlich des Völkerrechts. Afrikanische Staaten haben diese Ideen lange Zeit als "neokolonial" abgetan.
Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europäischen Parlament, der deutsche Politiker Manfred Weber (CSU), spricht von einem "Schlafwandeln der EU in eine neue Migrationskrise", von Hunderttausenden "illegalen Migranten" und betont: "Als letztes Mittel sollten Mauern gebaut werden, aber wenn es keine andere Möglichkeit gibt, die illegale Einwanderung zu stoppen, wir müssen bereit sein, Zäune zu bauen" – als ob die relativ geringe Zahl von "illegalen Migranten" ohne Rechte, die dazu verdammt sind, im Untergrund zu leben, ein Problem für die EU wären. Webers Kollege, der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, hat unterdessen die Sozialleistungen von Asylbewerbern in Frage gestellt.
Wenn sich die EU, Politiker und Elitejournalisten gegen das Recht unerwünschter Flüchtlinge auf Schutz positionieren wollen – und damit die politisch wertvollen Ukrainer ausschließen – und damit migrantenfeindliche Stimmung machen und punkten wollen, warum zieht sich die EU dann nicht einfach ganz aus der Flüchtlingskonvention zurück?
Eine Reihe von Staaten wie Indien haben die Genfer Konvention nicht unterzeichnet, ebenso wenig wie die Türkei, da das Land eine geografische Begrenzung ihrer Auswirkungen behält, was bedeutet, dass nur diejenigen, die aufgrund von "Ereignissen in Europa" fliehen, den Flüchtlingsstatus erhalten können. Warum also unternimmt die EU seit Jahrzehnten all diese Anstrengungen, um den Kontinent vor völkerrechtlich geschützten Flüchtlingen zu isolieren – Anstrengungen, für die übrigens viel Geld und Ressourcen sinnlos verschwendet wurden?
Die schmutzige Wahrheit hinter dem humanitären und liberalen Selbstverständnis europäischer und deutscher Eliten, die ihr Engagement für Menschen- und Flüchtlingsrechte stolz vor sich tragen, ist, dass sie weniger im Sinne humanitärer als geostrategischer und nationalistischer Interessen denken und handeln.
James C. Hathaway, einer der führenden Experten für Flüchtlingsrechte und Autor des Standardwerks "The Rights of Refugees under International Law", formulierte es einmal so:
Würde sich der globale Norden vollständig aus dem Flüchtlingsrecht zurückziehen, gäbe es keine politisch tragfähige Grundlage, um darauf zu bestehen, dass ärmere Länder weiterhin ihre flüchtlingsrechtlichen Verpflichtungen im Rahmen des derzeitigen Systems atomisierter Verantwortung und schwankender Wohltätigkeit gegenüber der reicheren Welt wahrnehmen. Und wenn weniger entwickelte Staaten diesem Beispiel folgen und das Flüchtlingsrecht vor dem Hintergrund der anhaltenden Instabilität in weiten Teilen des globalen Südens aufgeben würden, was zu oft massiven Flüchtlingsströmen führt, könnten die negativen Auswirkungen sowohl auf die globale Sicherheit als auch auf das wirtschaftliche Wohlergehen immens sein. In der Tat würde die Logik für Flüchtlinge, Schutz in der Nähe ihrer Heimat zu finden, mit Sicherheit zunehmen, wenn es weniger Möglichkeiten gibt, Schutz in der Ferne zu suchen – ein Szenario, das wohlhabendere Länder nicht einmal in Betracht ziehen wollen.
Es gibt rationale und nachhaltige Lösungen sowie Reformvorschläge, die über das Ad-hoc-Krisenmanagement hinaus für alle Beteiligten – insbesondere für die Flüchtlinge und die Frontstaaten, aber auch für die reichen Industrieländer und ihre Bevölkerungen – von Vorteil sind. Sie liegen seit Jahrzehnten auf dem Tisch und werden von parlamentarischen Beratungsgremien, Menschenrechtsorganisationen und der Wissenschaft ausgearbeitet. Sie finden auch in Europa breite Unterstützung, wenn sie fair umgesetzt werden.
Doch in der medialen Debatte fehlen diese Vorschläge so gut wie nicht. Solange das so ist, wird die EU weiterhin Krieg gegen unerwünschte Flüchtlinge führen, wie es die USA tun – mit allen schlimmen Folgen, die das mit sich bringt.
Leider gibt es keine Vorbilder. Die Biden-Regierung hat versprochen, Trumps Hardliner-Einwanderungsagenda zu demontieren. Stattdessen ersetzte er die Beschränkungen von Titel 42 durch eine noch härtere Politik. Jetzt sind flüchtende Menschen im Wesentlichen vom Asyl ausgeschlossen, da sie über eine unzuverlässige mobile App einen Termin an einem Einreisehafen im Voraus vereinbaren oder sich an eine fehlerhafte Drittstaatenregelung halten müssen – begleitet von verschiedenen Formen der Schikanierung an den Grenzen. Die international garantierten Rechte von Flüchtlingen erodieren auf beiden Seiten des Atlantiks, in den USA und in Europa.
Krokodilstränen über gefolterte Flüchtlinge – in Ländern, mit denen wir Pförtner-Deals ausgehandelt haben – und ertrinkende oder verhungernde Asylsuchende – die wir aufs Meer zurückschieben oder abschieben – ändern daran nichts.
David Goeßmann ist Journalist, Autor und Redakteur des Nachrichtenmagazins Telepolis.
Foto: Mstyslav Chernov / Wikimedia Commons
Erhältlich in
Verfasser
David Goeßmann
Datum
04.10.2023
Quelle: Progressiv international; Ausgabe Oktober 2023

Menschenrechte in BRD eingeschränkt
Menschenrechte: Deutschland schränkt laut Bericht Versammlungsfreiheit ein
n einer digitalen Weltkarte rechnet Amnesty International die Bundesrepublik erstmals zu den Ländern, die das Recht auf Protest erschweren. Kritisiert wird unter anderem die Präventivhaft für Klimaaktivisten in Bayern.
Deutschland schränkt laut Bericht Versammlungsfreiheit ein
Amnesty International beobachtet weltweit eine Zunahme staatlicher Unterdrückung von Protest. Behörden wendeten zunehmend unrechtmäßig Gewalt an und erließen repressive Gesetze, um Proteste niederzuschlagen, erklärte die Menschenrechtsorganisation. Auf ihrer weltweiten Karte "Protest Map" werde erstmals auch Deutschland aufgeführt als ein Land, in dem die Versammlungsfreiheit eingeschränkt werde.
In mindestens 86 der untersuchten 156 Länder hätten staatliche Stellen im vergangenen Jahr unrechtmäßige Gewalt gegen friedlich Demonstrierende eingesetzt, erklärte Amnesty. In 37 Ländern hätten Sicherheitskräfte sogar tödliche Waffen verwendet. Die Recherchen hätten außerdem gezeigt, dass Protestierende in 79 der untersuchten Länder willkürlich inhaftiert worden seien. Teils seien Demonstrierende schweren Repressionen ausgesetzt, würden gefoltert, misshandelt, verschwänden einfach oder würden getötet.
Deutschland unter anderem wegen Präventivhaft gelistet
Deutschland sei erstmals als Land gelistet, in dem das Recht auf Versammlungsfreiheit zunehmend eingeschränkt werde, hieß es. Angeführt werden Beispiele für Präventivhaft, Schmerzgriffe, repressive Gesetzgebung und Versammlungsverbote. Vor allem Klimaaktivistinnen und -aktivisten seien zurzeit zunehmenden Repressionen ausgesetzt.
So habe die bayerische Polizei seit Oktober 2022 Dutzende Aktivisten für bis zu 30 Tage in Präventivhaft genommen, zuletzt im Zusammenhang mit der Autoausstellung IAA in München. "Obwohl die Präventivhaft ursprünglich zur Verhinderung schwerer Gewaltdelikte gedacht war, wurde sie in den vergangenen Jahren vor allem zu Abschreckungszwecken gegen Klimaaktivistinnen und -aktivisten eingesetzt", sagte Amnesty-Expertin Paula Zimmermann.
In den vergangenen Jahren seien auch Fälle von übermäßiger Polizeigewalt gemeldet worden, insbesondere bei Straßenblockaden, führte Amnesty weiter an. "Wir appellieren an die Bundes- und Landesregierungen, die Versammlungsfreiheit in Deutschland umfassend zu schützen", sagte Zimmermann.
Quelle: SZ.de v.19.09.2023/Eine Klimaschützerin der © Hannes P. Albert/dpa

Kinderarmut in Deutschland
Aus: Ausgabe vom 15.09.2023, Seite 12 / Thema
DER STAAT UND SEINE BÜRGER
Streit ums Kind
Deutschland rettet seine Zukunft. Die Ampel-Koalition, die Kinderarmut und der Staatshaushalt
Von Theo Wentzke
Mehr zu diesem und zu weiteren Themen in Heft 3/23 der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Bestellung unter: gegenstandpunkt.com
Komplett anzeigen
Kinder sind unsere Zukunft. Diesem Motto der derzeit so kontroversen Familienministerin Lisa Paus widerspricht kein Politiker von ganz links bis ganz rechts. Warum auch? Politiker sind darin geübt, sich per erster Person Plural innigst mit den Bürgern zusammenzuschließen, über die sie regieren. Sie finden nichts dabei, sich auch über die größten ökonomischen und politischen Gegensätze unter ihren Bürgern hinwegzusetzen und sie alle als das große Wir-Volk rhetorisch zu vereinnahmen, als das sie sie praktisch beanspruchen. Warum sollten sie also vor unmündigen Kindern haltmachen? Vor denen, die sie gerne als die kleinen Träger des großen Potentials »unseres« großartigen Kollektivs veranschlagen? Gerade an den Kindern wird das nationale Wir beschworen – als quasifamiliäre Verantwortungsgemeinschaft, die sich über alle sonstigen Trennungen hinweg um ihren kollektiven Fortbestand als Volk kümmert, so als wären dessen Mitglieder miteinander wirklich über so etwas wie Blutsbande verbunden. Was gibt’s also bei der Einigkeit zu streiten – sogar unter Regierungspartnern?
Ein Problem der Teilhabe
Am Anfang steht der Umstand, dass die Zukunft sehr vieler Kinder sehr schlecht aussieht, weil sie durch die gegenwärtige Armut ihrer Eltern schon weitgehend feststeht: »Wir haben seit Jahren eine strukturell verfestigte Kinderarmut in Deutschland. Dahinter stehen Millionen von Kindern und Jugendlichen, deren Alltag es ist, nicht mitmachen und nicht dabeisein zu können. Das ist nicht nur ungerecht, sondern hat auch gravierende Folgen: auf den Bildungserfolg, auf die Gesundheit, auf die gesellschaftliche Teilhabe. Deshalb müssen wir mehr tun für die Bekämpfung von Kinderarmut« (Paus, bmfsfj.de). »Nicht mitmachen und nicht dabeisein können« – das ist vielleicht höflich.
Die Familienministerin weiß doch genausogut wie ihr marktwirtschaftlich erfahrenes Publikum, was den Alltag armer Kinder wie Erwachsener ausmacht: Das ist zunächst schlicht der Geldmangel. Von wegen also, die armen Kinder wären nicht alltäglich »dabei«. Sie machen doch hautnah Bekanntschaft mit dem Kernprinzip marktwirtschaftlichen Reichtums: Wem das Geld fehlt, der wird von dem ausgeschlossen, was er braucht und will; er wird auch dort – Stichwort: Bildung – faktisch benachteiligt, wo Geld von Staats wegen ausnahmsweise keine Rolle spielen soll. Mit »struktureller« Regelmäßigkeit kommt das bekannte Ergebnis heraus, das niemanden wirklich überrascht und zugleich jeden Anhänger der Chancengleichheit – also jeden – bekümmert. Was offensichtlich zur Realität der Marktwirtschaft gehört, gehört sich nach ihrem Selbstbild eben nicht: Kinder erben von ihren Eltern nicht nur manche natürliche Eigenschaft, sondern auch deren sozialen Status. Deren armutsbedingten Ausschluss vom gesellschaftlichen Reichtum müssen die Kinder täglich »mitmachen«; das macht ihre Armut überhaupt aus.
Erst recht bei den Eltern kann von mangelnder Teilhabe keine Rede sein: »Im Bürgergeld sind aktuell weniger als zwei Millionen Kinder. Es sind jedoch nicht nur Kinder im Bürgergeld von Armut bedroht. Fast vier Millionen Kinder leben in Familien, in denen die Eltern zwar hart arbeiten und weitgehend aus eigener Kraft für ihre Kinder aufkommen können, aber trotzdem staatliche Unterstützung brauchen, um ihren Kindern gute Chancen bieten zu können« (Interview mit Paus in der FAZ, 17.8.2023).
Hinter dem Geldmangel steht also offenbar eine untaugliche, »strukturell verfestigte« Geldquelle. Oder etwas deutlicher: Dahinter steht eine Einkommensart, die gar nicht erst daran Maß nimmt, ob sie Zugang zu dem gewährt, was den Kindern aus der verfremdenden Sicht besorgter Minister fehlt. Ihr Maß hat sie allein darin, den Zugriff eines kapitalistischen Unternehmers auf rentable Arbeit zu gewähren; also wenig Geld für den Arbeiter abzuwerfen und viel Leistung für seinen Anwender zu bringen. Bei den Lohnarbeitern hat das fürs Kinderkriegen und -erziehen dieselbe bekannte Wirkung wie für alle anderen Lebensentscheidungen dieser Klasse: Viel ist da nicht drin, für viele nicht einmal ein Existenzminimum.
Damit wäre man bei der Armut, die Ministerin Paus bekämpfen will: »Deshalb müssen wir mehr tun für die Bekämpfung von Kinderarmut. Die Kindergrundsicherung wird kommen! Sie ist für mich eine der wichtigsten Zukunftsinvestitionen« (bmfsfj.de). »Wir sagen ja immer: Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Aber was ist das für eine Gesellschaft, die ein Fünftel der jetzt schon geborenen Kinder im sozialen Abseits stehen lässt?« (Paus in der FAZ)
Und die Gründe?
Verstanden. Die ganze Welt der Arbeit, aus der die Armut stammt, geht die Familienministerin nichts an; die gehört nicht zu ihrem Kompetenzbereich. Ihre Kompetenz besteht statt dessen darin, die schlechten Konsequenzen der Arbeitswelt als ein furchtbares Problem zu definieren, das staatliche Kompensation erfordert, ohne den Gründen des Problems irgendwie nahezutreten. »Strukturell verfestigt«: Der Soziologismus steht bloß dafür, wie fest die Ministerin mit der Armut der Eltern rechnet, die sich – irgendwie – hartnäckig eingestellt hat. An die Stelle von ökonomischen Gründen für die Armut der Kinder setzt sie die denkbar allgemeinste moralische Schuldzuweisung, die jeden Unterschied und jede Klarheit in der Frage des Grunds zum Verschwinden bringt – jedenfalls bringen würde, wenn das überhaupt die Frage wäre. Sie kündigt eine »Bekämpfung« von Kinderarmut an, die keinen ökonomischen Gegner, nur eine moralische Bewährungsprobe kennt – gewissermaßen einen Auftrag der Gesellschaft gegen ihre eigene Gleichgültigkeit. So geht Armutsbekämpfung, wenn sie von Politikern betrieben wird, die die Armen wie alle anderen regieren, also selbst definieren, welches »Problem« die Armut ist und für wen: In diesem Fall ist sie ein Problem für die Leistung, die die Eltern von Staats wegen für ihre Kinder zu erbringen haben, dies aber aus eigener Kraft nicht können. Dass sie das nicht können, definiert Paus als ein »Versagen des Staates«. Damit sie das nun besser können, verlegt sie sich auf ein funktionales Äquivalent für die Bekämpfung ihrer Armut: Als private »Funktionäre« des staatlichen Interesses an ihren Kindern sollen Eltern mehr Geld bekommen. Dann, so wiederum das Anrecht und der Auftrag der Eltern, können ihre Kinder in den Genuss von mehr »Teilhabe« kommen.
Woran eigentlich? Die Ministerin redet von »Bildung«, »Gesundheit« und schon wieder von »Teilhabe« – so, als wären die selbst schon der Wohlstand, auf den es für die Leute ankommt, und nicht bloß die Bedingungen, um ihn überhaupt anzustreben. Genau darum geht es aber: um die Befähigung von Kindern, Konkurrenzsubjekte auf dem Arbeitsmarkt zu werden, damit über deren Abschneiden dort nicht schon vor ihrem Eintritt ins Arbeitsleben entschieden wird. Es geht also um Teilhabe an derselben Veranstaltung, an der auch ihre armen Eltern voll und ganz teilhaben. Natürlich sind die Eltern auch dann auf dem Arbeitsmarkt dabei, wenn kein Unternehmen sie gebrauchen will, und sie sind es erst recht, wenn ihre Arbeit – nach Auskunft der Ministerin: millionenfach – so nachgefragt und benutzt wird, dass das Ergebnis die Reproduktion des armseligen Ausgangspunkts ist.
Wird nun der Arbeitsmarkt für die Kinder darüber tauglicher, dass sie in ihn leichter hineinkommen? Solche Fragen würden die Familienministerin bloß wieder aus ihrem Kompetenzbereich herauskatapultieren: Es geht ja – wie gesagt – nicht darum, die Armut von Lohnarbeitern zu bekämpfen, wie es sie in der BRD gibt, sondern darum, Deutschlands Kinder besser vor der lohnarbeitsbedingten Armut ihrer Eltern zu schützen, bis sie selbst am Arbeitsmarkt teilhaben können. Und zwar – genau wie bei ihren Eltern – zu den Bedingungen, zu denen »die Wirtschaft« sie an ihrer Bereicherung »teilhaben«, d. h. dafür arbeiten lässt: »Die Kindergrundsicherung ist künftig die zentrale Leistung für alle Kinder. Sie vereinfacht das System der Familienförderung (…). Die Kindergrundsicherung soll aus einem für alle Kinder gleich hohen Garantiebetrag bestehen, der das heutige Kindergeld ablöst (…). Hinzu kommt ein einkommensabhängiger Zusatzbetrag. Zusammen decken Kindergarantiebetrag und Kinderzusatzbetrag das soziokulturelle Existenzminimum für Kinder ab. Mit dem Zusatzbetrag der Kindergrundsicherung werden Familien mit weniger Einkommen stärker unterstützt. Denn es geht darum, Armutsrisiken zu verringern und allen Kindern die gleichen Start- und Entwicklungschancen zu eröffnen« (bmfsfj.de). Ein Ziel, dem kein Politiker, weder aus der Regierung noch aus der Opposition, widersprechen mag.
Lindner streicht
Unsere Zukunft lebt allein vom Wachstum »unserer Wirtschaft«, bei der das Geld besser aufgehoben ist. Aber was heißt das schon? Welches Ministerium hat denn nicht unwidersprechliche Ziele für »unseren Wohlstand«, für die hoheitliche Geldmittel ebenso nötig sind? Zielkonflikte sind bekanntlich unvermeidlich, wenn ein finanziell seriöser Staatshaushalt daraus werden soll; bei aller Notwendigkeit der Aufgaben gilt es also, Ausgabendisziplin zu bewahren, was in aller Regel heißt: Abstriche machen. Darunter leidet das Notwendige, bisweilen entfällt es ganz; Unsachlichkeit im Wortsinne gehört eben zur haushälterischen Vernunft im Kapitalismus.
Deren Durchsetzung gehört in erster Linie zum Kompetenzbereich des Finanzministers. Und der aktuell regierende hat seiner Koalitionskollegin schon vor einigen Monaten mitgeteilt, ihr Projekt sei zwar »wünschenswert, aber nicht realisierbar« (Christian Lindner im Bild-Interview, 2.4.2023). Einige Monate später kündigt er an, nur zwei statt der geforderten zwölf Milliarden zu gewähren – »als Platzhalter« (tagesschau.de, 23.8.2023). Und so, wie er für diese Zurückweisung argumentiert, wird deutlich: Die erste und entscheidende Aufgabe eines bundesdeutschen Finanzministers besteht darin, mit spitzem Stift dicke Lügen zu erzählen. Er findet nichts dabei, Schulden in einem Ausmaß zu tragen und Jahr für Jahr neu zu beschließen, das kein Privathaushalt je hinkriegen könnte, und trotzdem so zu reden, als ob der Kredit noch nicht erfunden worden wäre: »Es kann nur das an Staatsgeld verteilt werden, was Menschen und Betriebe zuvor erarbeitet haben. Die logische Voraussetzung einer neuen Leistung wie etwa der Kindergrundsicherung ist, dass wir überhaupt eine prosperierende Wirtschaft haben« (Lindner in der FAZ, 17.8.2023). Zur einen – traditionsreichen – Lüge gesellt sich also gleich die zweite. Als ob der Mann anlässlich des »Sondervermögens Bundeswehr« nicht mit der Finanzkraft angeben würde, die Deutschland seiner »prosperierenden« kapitalistischen Akkumulationsmaschinerie verdankt.
Die finanzpolitische Propaganda hat dennoch ihren guten Sinn; sie ist in gewisser Weise sogar aufklärerisch: So unbedingt, wie Lindner darauf herumreitet, dass ein erfolgreiches nationales Wachstum und ein solides nationales Geld die absolut unerlässliche Bedingung für alles sind, was der Staat sonst noch für seine Bürger tut, wird klar, was der eigentliche Zweck aller staatlichen Auf- und Ausgaben ist. Es geht überhaupt um das Wachstum der Wirtschaft, um Geldvermehrung dort und um den schönen Effekt, den das auf das nationale Geld hat. An dem Kriterium hat sich die Kinderförderung wie alle anderen Aufgaben zu messen; und das sortiert diese Aufgaben wiederum sehr gründlich: Es scheidet Geld, das der Staat bloß ausgibt, also angeblich erst verdienen muss, von dem Geld, mit dem der Staat »Impulse« setzt, Wachstum ankurbelt, das also nicht erst verdient werden muss, weil es sich als »investive Staatsausgabe« in der Zukunft selbst verdient.
»Es ist offensichtlich, dass wir Impulse für mehr Wachstum brauchen. Ein wichtiger Baustein dafür ist das geplante Wachstumschancengesetz. Es sieht neue Investitionsprämien, Steuervereinfachungen, bessere Abschreibungsmöglichkeiten und mehr Forschungsförderung vor« (ebd.). An dieser Stelle versucht es die Familienministerin mit einer sicher gutgemeinten Retourkutsche, mit der sie die von ihr geplanten, bloß »konsumptiven Ausgaben« mit dem Ehrentitel »Investition« schönreden will: »Abgesehen davon ist es auch ökonomisch unvernünftig, diese Kinder, die einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Wohlstand leisten können, nicht zu unterstützen.« »Investitionen in unsere Kinder sind Investitionen in die Zukunft Deutschlands. Wir haben eine der ältesten Bevölkerungen der Welt – da wäre es kurzsichtig, das nicht zu beherzigen. Und ganz grundsätzlich gesagt: Immer wieder heißt es, wir müssten erst mal erwirtschaften, was wir verteilen können. Dabei ist es doch umgekehrt: Wir brauchen gute Rahmenbedingungen für Familien, auch, damit Eltern überhaupt erwerbstätig sein können« (Paus in der FAZ).
Es hilft zwar nichts gegen die Objektivität, die Lindner bei all seinen propagierten Unwahrheiten trotzdem auf seiner Seite hat: Geld für Soziales ist und bleibt ein zwar notwendiger, aber doch eben Abzug von dem Reichtum, auf den es in der Nation ankommt. Doch die Perspektive auf die Kinderförderung, die Paus mit ihrem Konter einnimmt, ist ganz im Sinne des Finanzministers: Wenn es schon um die Förderung der Zukunft Deutschlands geht und wenn der Maßstab dafür die Förderung der Beiträge ist, die Kinder und Eltern auf dem Arbeitsmarkt erbringen, dann sieht sich Lindner herzlich dazu eingeladen, über seine haushälterischen Belehrungen hinauszugehen und zu zeigen, dass er auch Familienpolitik kann – erst recht, wenn man ihn mit dem Vorwurf provoziert, ihm wären die armen Kinder offenbar egal: »Mir geht es auch darum, dass Kinder und Jugendliche gute Perspektiven haben. Nicht die Herkunft soll über den Lebensweg entscheiden« (Lindner in der FAZ).
»Hilft da wirklich mehr Geld?«
»›Hilft da wirklich mehr Geld auf das Konto der Eltern, oder sollten wir mehr tun für Sprachförderung und Arbeitsmarktzugang der Erwachsenen und für die Schulen der Kinder? Der finanzielle Anreiz zur Arbeitsaufnahme darf auch nicht verloren gehen‹, mahnte Lindner. Er betonte: ›Bevor wir ein Preisschild an die Kindergrundsicherung machen, sollten wir fragen, was wir eigentlich brauchen, um die Lebenschancen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern‹« (Welt, 21.7.2023). »Wenn wir über Kinderarmut reden, dann müssen wir noch einen anderen wichtigen Punkt beachten: Es gibt einen Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Kinderarmut. Sprachkenntnisse und Bildung, insgesamt die Arbeitsmarktintegration der Eltern, sind mitentscheidend für die Situation von Kindern. Unser Ziel muss es sein, dass Eltern ihr eigenes Einkommen erzielen. Ihnen einfach nur mehr Sozialtransfers zu überweisen verbessert nicht zwingend die Lebenschancen der Kinder« (Lindner in der FAZ).
Lindner beharrt also auf einer besonders konsequenten Fassung des Standpunkts, die Armut der Kinder bestünde und begründete sich in mangelnder »Teilhabe«, und die Funktion der Eltern bestünde darin, statt ihrer Armut ihre Integration in »die Gesellschaft« und deren Arbeitsmarkt weiterzugeben. Es ist zwar eine zynische – und gewollt durchsichtige – Verharmlosung, wenn Lindner dabei den Zwang zum Arbeiten, den er an die Stelle von Geldtransfers an die Eltern setzt, einen »finanziellen Anreiz« nennt. Aber in der Hauptsache hat er sogar recht: Dieser Zwang ist tatsächlich das politische Fundament der ganzen Veranstaltung, an der laut beiden Seiten des Koalitionsstreits Kinder und Eltern zuwenig teilhaben – oder wie kämen die von Paus angeführten Eltern millionenfach auf die Idee, »hart zu arbeiten« und dennoch generationenübergreifend arm zu bleiben, wenn nicht der Zwang der Alternativlosigkeit dahinterstünde? Lindners wahrer Zynismus liegt also nicht etwa in übler Nachrede gegenüber den armen, hauptsächlich mit Migrationshintergrund versehenen Eltern, wie sie ihm nach seinem soeben zitierten FAZ-Interview von vielen Seiten angekreidet wird.
Er liegt dort, wo ihn keine Seite im Streit entdecken will: in seinem mit aller Selbstverständlichkeit vorgetragenen, absolut affirmativen Verhältnis zur Zwangsveranstaltung namens freie Lohnarbeit. Auf der bestehen alle am Streit Beteiligten – nicht als die Quelle der Armut, die sich millionenfach so störend auch in der Lage der Kinder niederschlägt, sondern als Quelle des Wohlstands, der den Kindern fehlt. Insofern erweist sich Lindner als liberaler Fundamentalist der marktwirtschaftlichen Konkurrenz, auf die keine Partei etwas kommen lassen will.
Bloß nicht bei den Falschen
»Unserer Zukunft« dient eine Familienpolitik, die vor allem den Erfolg unterstützt, also die Erfolgreichen. Im Sinne der Solidität deutscher Haushaltsrechnungen fordert Finanzminister Lindner von der Kollegin im Familienministerium die Einsparung von 500 Millionen Euro aus ihrem Etat. Paus entscheidet sich »von den schlechten Varianten für die am wenigsten schlechte« (Interview im Spiegel 10.7.2023) und beschränkt den Kreis der Zugangsberechtigten für das Elterngeld von derzeit 300.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen auf künftig 150.000 Euro. Sie begründet das damit, dass sie »auf keinen Fall die Höhe des Elterngeldes kürzen wollte, um sozialpolitischen Schaden zu vermeiden«, und verweist darauf, dass Paare mit 150.000 Euro Einkommen »selbstverständlich wohlhabend« (Zeit online, 7.7.2023) sind und nur ungefähr fünf Prozent der Bezieher von Elterngeld ausmachen, so dass die Kürzung der Mittel den sozialen Zweck des Elterngeldes nicht konterkariert.
Das ist aber schon wieder nicht recht. Kaum verkündet, schallt ihr vom liberalen Koalitionspartner wie von der christlichen Opposition empörte Kritik entgegen. Die richtet sich genau gegen die soziale Stoßrichtung ihres Kürzungsvorschlags und liefert eine Klarstellung zur Aufgabe ihres Ministeriums: »›Lisa Paus ist nicht Sozialministerin, sondern Familienministerin‹, schimpft der FDP-Politiker im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Und schließlich gehe es hier um Gleichstellung und ein familienpolitisches Ziel – nämlich, dass ›junge Paare aus der Mitte der Gesellschaft es sich leisten können, Kinder zu bekommen‹. ›Elterngeld ist keine Sozialleistung, sondern bewusst eine Lohnersatzleistung, die zwar nicht für alle – es gibt ja eine Einkommensgrenze –, aber auch für die Mitte der Gesellschaft da ist – z. B. die Ingenieurin und den Lehrer‹« (tagesschau.de, 5.7.2023). »Warum wollen Sie besonders die Leistungsträger abstrafen?« (CSU-Abgeordnete Bär im Bundestag, 5.7.2023)
Die Kürzung mag keinen sozialen Schaden anrichten, wohl aber einen am Volkskörper – und um den geht es überhaupt in der Familienpolitik. Dem tut es nicht gut, wenn ausgerechnet diejenigen, die am Arbeitsmarkt so erfolgreich funktionieren, also auf höherem Niveau arbeiten und verdienen, nicht extra gefördert werden. Deren Kinder tun »unserer Zukunft« besonders gut; die zeichnen sich als förderungswürdige Volksmitglieder gerade dadurch aus, dass sie keine Hilfen zur »Teilhabe« brauchen. Diese Eltern brauchen wirklich nur Geld, um genauso erfolgreich wie in der Berufshierarchie als Produzenten von Kindern zu funktionieren, die so wenig Extrahilfen brauchen, weil sie schon in die »Mitte der Gesellschaft« hineingeboren werden, man sie also nicht erst mühsam mit – natürlich gut gemeintem, »anreizendem« – Zwang dort hinbringen muss.
Für die Kinder der Erfolgreichen Geld auszugeben heißt also, wirklich einmal Geld zu investieren, wo es sich für den Volkskörper lohnt – gerade diesen erfolgstüchtigen Menschenschlag darf man nicht mit Kürzungsvorschlägen von seinen erwünschten Reproduktionsabsichten abschrecken. Die Prämie namens Elterngeld muss um so höher ausfallen, je weniger es um die Behebung wirklichen Geldmangels und je mehr es um die Einflussnahme auf die freie Lebensplanung von Besserverdienenden geht. 65 Prozent des letzten Nettogehalts, maximal 1.800 Euro, sowie die Verpflichtung der Arbeitgeber auf ein Rückkehrrecht zu den vorherigen Bedingungen müssen schon drin sein.
Woanders sparen
Unsere Zukunft braucht ganz moderne Eltern, die möglichst beide den Machern unseres Wachstums zur Verfügung stehen. Auch und gerade für die SPD ist die Integration in den Arbeitsmarkt das höchste Gut, die wichtigste Sozialleistung. Auch ihr fällt an der Stelle ein Versagen des Staates ein, in dem Fall ein steuerpolitisches. SPD-Chef Lars Klingbeil knüpft an die Kritik seines Kollegen aus der FDP mit einer Belehrung der Familienministerin in Sachen politischer Regelkunde an, um auf sein familienpolitisches Vorhaben zu kommen: »SPD-Chef Lars Klingbeil hat vorgeschlagen, das Ehegattensplitting zu streichen, statt das Elterngeld zu kappen. ›Verteilungsfragen klärt man über die Steuerpolitik, nicht über das Elterngeld (…). Wir haben im Koalitionsvertrag schon festgelegt, dass wir Steuern gerechter verteilen wollen‹, sagt Klingbeil. Das jetzige Steuerrecht führe dazu, dass vor allem Frauen eher zu Hause blieben anstatt zu arbeiten, weil Frauen im Vergleich zu ihrem Partner häufiger weniger verdienen. Die SPD wolle das ›antiquierte System‹ für Ehen, die in Zukunft geschlossen werden, abschaffen. Auch, um Frauen stärkere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen (…). ›Das Elterngeld ist keine Sozialleistung‹, stellt Klingbeil fest. Es sei aus Aspekten der Gleichstellung eingeführt worden. Um Frauen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern und dass Frauen stärker dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stünden. Wenn man das Elterngeld nun kappe, egal an welcher Grenze, führe das am Ende dazu, ›dass mehr Frauen zu Hause bleiben, dass weniger Frauen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und einen solchen Weg finde ich nicht richtig‹« (ZDF-Interview, 10.7.2023). »Und der Staat würde Geld sparen« (Spiegel online, 10.7.2023). »Den Staat kostet die Einsparung für Verheiratete etwa 20 Milliarden Euro jährlich« (sueddeutsche.de, 10.7.2023).
Es fügt sich alles so schön zusammen: Frauen bekommen mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt, wenn man den gerechten Zwang – Lindner würde sagen: »finanziellen Anreiz« – stiftet, der Doppelbelastung von Familie und Beruf eine Chance zu geben. Das ist auch und gerade deswegen so schön, weil die Frauen dann – weniger »dem Arbeitsmarkt« als vielmehr – den Unternehmen zur Verfügung stehen, also deren Freiheit vergrößert wird, Arbeitskräfte zu finden, die zu ihren Gewinnrechnungen passen. Das alles dient der Gleichstellung und würde dem Finanzminister noch dazu bei seinen Drangsalen helfen.
»Unsere Zukunft« braucht vor allem einen kollektiven starken Mann an der Staatsspitze. Dass er sie überdauert, ist offenbar der größte Schaden am Volkskörper. Das ist jedenfalls für verärgerte Mahnungen von allen drei Koalitionspartnern und erst recht von einer aufgebrachten Öffentlichkeit gut: Bloß nicht schon wieder und immer weiter vor den Kindern streiten! Das ist schon wieder aufklärerisch: In der Demokratie besteht das erste Recht aller Bürger, alt und jung, in einer handelseinigen Regierung, die weiß, was sie will, und sich bei dessen Durchsetzung nicht selbst im Wege steht. Zumindest das ist der Koalition – zwar für den Geschmack der Öffentlichkeit zu spät und zu unglaubwürdig, aber – dann doch »vor Meseberg« gelungen.
Quelle: junge Welt 15.09.2023/ IMAGO/Funke Foto Services
Schöne Demokratie. In der Bundesrepublik ist jedes fünfte Kind von Armut betroffen. Mit der kapitalistischen Ökonomie soll das aber bitteschön nichts zu tun haben

Verstoß gegen die Menschenrechte in der BRD - Recht auf Wohnraum verwehrt
us: Ausgabe vom 12.09.2023, Seite 1 / Inland
WOHNUNGSKRISE
Familien ohne Bleibe
Statistik der Wohnungslosenhilfe erfasst mehr Hilfesuchende mit einem oder mehreren Kindern
Von David Maiwald
In der Bundesrepublik sind auch Familien zunehmend von Wohnungslosigkeit bedroht – mit steigender Tendenz, so die Befürchtung. Einen »sehr beunruhigenden Höchstwert« zeige sich der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Wohnungslosenhilfe beim Anteil von bei ihr Hilfe suchenden Familien, teilte die BAG zum Tag der wohnungslosen Menschen am Montag mit. Laut dem BAG-Jahresbericht »zur Lebenslage wohnungsloser und von Wohnungslosigkeit bedrohter Menschen« lebten demnach im Berichtsjahr 2021 rund elf Prozent der Hilfesuchenden in Haushalten mit einem oder mehreren Kindern, darunter Alleinerziehende und Paare mit Kindern. Die BAG nennt die Zahlen in ihrem Statistikbericht »alarmierend«.
Zwar seien Haushalte mit Kindern im Vergleich zu Haushalten ohne Kinder seltener akut von Wohnungslosigkeit betroffen, heißt es darin. Mit rund 37 Prozent habe dennoch mehr als jede dritte Familie, die im Jahr 2021 Hilfsdienste und Hilfseinrichtungen freier Träger aufsuchte, ohne eigene Wohnung gelebt. Der Wert sei demnach erstmals seit sechs Jahren wieder unter die Marke von 40 Prozent gesunken. Doch könnten erst die Daten der kommenden Jahre genauen Aufschluss darüber geben, »ob es sich hier um einen anhaltenden Rückgang von Familienwohnungslosigkeit handeln könnte oder ob diese Entwicklung nicht eher als Echo der Coronamaßnahmen verhallt«, heißt es im Bericht.
Erst Anfang August hatte das Statistische Bundesamt vermeldet, dass sich die Anzahl der in Unterkünften der Kommunen untergebrachten Menschen 2022 mit insgesamt 372.060 Personen fast verdoppelt hat. Die gesamte Zahl an Wohnungslosen sei »deutlich höher«, hatte BAG-Geschäftsführerin Werena Rosenke dazu gegenüber jW erklärt. So ist es auch hier: Seien zu Beginn der Coronapandemie vielerorts Zwangsräumungen zumindest in Haushalten mit Kindern zeitweilig ausgesetzt worden, seien viele dieser Räumungen »bereits 2021 wieder nachgeholt« worden, erklärte die BAG in ihrem Jahresbericht. In den kommenden Jahren könne daher »ein weiterer Anstieg akut wohnungsloser Familien« feststellbar werden.
Quelle: junge Welt v.12.09.2023/ Paul Zinken/dpa
Mehr als jede dritte Familie, die Angebote der Wohnungslosenhilfe aufsuchte, lebte 2021 ohne eigene Wohung

Verstoß gegen die Menschenrechte in der BRD - Leben in Armut im Ruhestand
Aus: Ausgabe vom 12.09.2023, Seite 5 / Inland
SOZIALPOLITIK
Habenichtse im Alter
Zahlen aus Bundesarbeitsministerium: Millionen Vollzeitbeschäftigte im Ruhestand in Armut
Von Ralf Wurzbacher
Hiobsbotschaften für aktuelle sowie kommende Rentnerinnen und Rentner setzt es hierzulande fast schon gewohnheitsmäßig. Am Montag folgte die nächste: Fast die Hälfte aller heute sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten wird sich später mit monatlichen Altersbezügen von unter 1.500 Euro begnügen müssen. Wie üblich trifft es die Menschen im Osten der Republik besonders hart. Hier droht eine Mehrheit mit 1.300 Euro abgespeist zu werden. Geliefert hat die Zahlen das Bundesarbeitsministerium (BMAS) auf Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linke. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) warnte deren Vorsitzender Dietmar Bartsch vor »sozialem Sprengsatz«, der bei der Ampelkoalition »alle Alarmglocken« schrillen lassen müsse. »Es reicht nicht mehr aus, an Stellschrauben zu drehen. Wir brauchen substantielle Verbesserungen«, befand er.
Um später staatliche Zuwendungen von 1.500 Euro zu erhalten, muss man gemäß BMAS-Erhebung 45 Jahre 40 Stunden wöchentlich bei einem Stundenlohn von 20,78 Euro gearbeitet haben, was einem Bruttomonatsverdienst von 3.602 Euro entspricht. Von den derzeit rund 22 Millionen Menschen in beruflicher Vollzeit erreichen etwa 9,3 Millionen gerade so diese Grenze beziehungsweise liegen darunter. Verdient man stündlich 18,01 Euro oder 3.122 Euro im Monat, stehen einem im Alter 1.300 Euro zu. Um auf eine Rente von 1.200 Euro zu kommen, ist nach den Berechnungen ein Stundensatz von 16,62 Euro erforderlich oder 2.882 Euro monatlich. 36 Prozent der Vollzeitbeschäftigten schaffen es nicht über diese Schwelle, womit sie im Rentenalter auch offiziell unterhalb der Armutsgrenze verharren. Die verlief im Vorjahr bei 1.250 Euro. Linderung verspricht auch die geplante Erhöhung des Mindestlohns nicht. Mit der kläglichen Aufstockung von zwölf auf 12,41 Euro zum 1. Januar 2024 bleibt das Instrument ein Garant für Altersarmut.
»Das ist zynisch und respektlos gegenüber Millionen Beschäftigten«, bemerkte Bartsch und forderte eine Anhebung auf 14 Euro. Da überdies immer mehr Menschen nicht auf 45 Arbeitsjahre kämen, werde das Verarmungsrisiko auf dem Altenteil »weiter ansteigen«. Die von seiner Partei, Gewerkschaften und Sozialverbänden geforderten 14 Euro ab dem kommenden Jahr wären ein »Zeichen des Respekts«, so der Linke-Politiker. »Perspektivisch muss der Mindestlohn zu einer auskömmlichen Rente führen.« Außerdem empfahl er, das Rentenniveau von 48 Prozent auf 53 Prozent des Durchschnittsweinkommens aufzuwerten, sowie eine »schnell wirksame« außerordentliche Anpassung von zehn Prozent oder mindestens 200 Euro im Monat. »Handelt die Bundesregierung nicht, läuft der Countdown mit der Gefahr, dass das Land sozial implodiert«, so Bartsch.
Nichts dergleichen kommt den Regierenden in den Sinn. Statt dessen setzt die Ampel auf die »Aktienrente« und darauf, das in Gestalt der Riester-Rente kapital gescheiterte private Alterssparen unter neuem Namen künftig noch mehr zu pushen. Ferner machte CDU-Chef Friedrich Merz dieser Tage mit dem Vorstoß von sich reden, das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung zu koppeln – noch so eine Rentenkürzung durch die Hintertür. Reiner Heyse von »Seniorenaufstand«, einem Koordinierungskreis gewerkschaftlicher Seniorenpolitiker im norddeutschen Raum, schweben andere Maßnahmen vor. Gegenüber jW plädierte er am Montag für Renten, die »mindestens 75 Prozent des im Arbeitsleben erzielten durchschnittlichen Nettoeinkommens betragen«. Außerdem brauche es eine »Erwerbstätigenversicherung, in der alle grundsätzlich gleichbehandelt werden und in der auch Beamte, Selbstständige und Politiker organisiert sind«, sowie »Mindestrenten, die stets über der Armutsgrenze liegen«.
Sorgen bereiten Heyse vor allem auch die zwölf Millionen Pflichtversicherten, die nicht in Vollzeit arbeiten. »Das sind Minijobber, Teilzeitbeschäftigte, Arbeitslose, von denen so gut wie niemand an die 1.200 Euro heranreicht.« Sein Fazit: »Im Angesicht der weiter rasant ansteigenden Altersarmut wird das Sozialstaatsgebot im Artikel 20 des Grundgesetzes zur zynischen, inhaltsleeren Papiernummer.«
Quelle: junge Welt v.12.09.2023/ Oliver Berg/dpa
Am Ende der Erwerbsarbeitszeit steht für immer: die Grundsicherung

Verstoß gegen die Menschenrechten in den USA - Kein Schutz indigener Minderheiten
Aus: Ausgabe vom 12.09.2023, Seite 3 / Schwerpunkt
POLITISCHER GEFANGER
Noch ein Geburtstag im Knast
USA: Indigener Aktivist Leonard Peltier wird 79. Kampf um Begnadigung geht auch nach fünf Jahrzehnten Haft weiter
Von Michael Koch
Hintergrund: Lese- und Vortragstour
Mehr Informationen zum Fall Leonard Peltiers und dessen Hintergründe finden sich in dem Buch »Ein Leben für die Freiheit – Leonard Peltier und der indianische Widerstand« der Autoren Michael Koch und Michael Schiffmann. Nach Erscheinen des Buches 2016 fanden bislang 87 Veranstaltungen statt. Mehrere tausend Besucher hatten somit die Möglichkeit, sich über den Fall des mittlerweile 79jährigen politischen Gefangenen, aber auch über andere Belange Indigener zu informieren. Dabei reichte das inhaltliche Spektrum der Veranstaltungen von Themen wie Völkermordgeschichte, aktuelle Lebensbedingungen in Reservationen, Repression und Widerstand über die sogenannten Missing and Murdered Indigenous Girls and Women und Frauen im indigenen Widerstand bis hin zum Komplex »Umwelt, Menschenrechte und soziale Kämpfe«.
So unterschiedlich wie die jeweiligen Themenschwerpunkte waren auch die Veranstaltungsorte: Autonome und soziokulturelle Zentren, Gemeindehäuser und Buchläden, Stadtteilbüros, Vereinsfeste, als Livestream auf Youtube oder in den Hüttendörfern des Danneröder-, Hambacher- und Fechenheimer Waldes sowie bei Antikohleaktionen in Lützerath und Keyenberg. Dabei sind die Veranstaltungen ein Mix aus freiem Vortrag, Lesung, Medieneinspielungen und eigenen Songs sowie Interaktion mit dem Publikum. Die 13. Lese- und Vortragsvortragstour beginnt an diesem Dienstag, dem 79. Geburtstag Peltiers, bei der Mahnwache in Frankfurt gegenüber dem US-Generalkonsulat, Gießener Str. 30, um 18 Uhr. Weitere Stationen sind bislang: Venedig am 16. September, Nürnberg am 4. November, außerdem in Planung sind derzeit Leipzig und Ludwigshafen. (mk)
Verkleinern
An diesem Dienstag, dem 12. September, wird der indigene politische Langzeitgefangene Leonard Peltier 79 Jahre alt. Für den seit vielen Jahren schwerkranken Aktivisten des American Indian Movement (AIM) bedeutet das unter anderem, dass dies der 48. Geburtstag nach seiner Festnahme am 6. Februar 1976 ist, den er in einem der berüchtigten US-Hochsicherheitshaftanstalten verbringt, isoliert von Freunden und Familie, eingesperrt in einer winzigen Zelle, weiterhin der Willkür von Justiz, FBI und einer gnadenlosen Politik ausgesetzt.
Über die Hintergründe von Peltiers Inhaftierung und Verurteilung berichtet die jW seit Dekaden immer wieder. Daher hier nur eine kurze Zusammenfassung. 1975, auf dem Höhepunkt tödlicher Angriffe einer durch die Oglala-Lakota-Stammesregierung gegründeten und unter anderem durch FBI und Polizei aufgerüsteten Todesschwadron (Guardians of the Oglala Nation, GOON) auf traditionelle sowie junge, sich politisch engagierende Lakota der Pine Ridge Reservation, riefen Oberhäupter und Stammesälteste der Oglala das AIM zur Hilfe. Am 26. Juni 1975 rasten die beiden FBI-Agenten Jack Coler und Ronald Williams mit einem ungekennzeichneten Wagen in ein AIM-Camp, das zum Schutz älterer Reservationsbewohner eingerichtet worden war. Nach Jahren des GOON-Terrors, dem mindestens 59 Lakota zum Opfer fielen, war dies der Funke, der die Situation endgültig eskalieren ließ.
An einen Überfall glaubend, leisteten Camp- und Reservationsbewohner zur Selbstverteidigung bewaffneten Widerstand. Bei dem Schusswechsel starben der junge AIM-Aktivist Joe Stuntz und die beiden FBI-Agenten. Als Hauptverdächtige präsentierte die US-Bundespolizei der Öffentlichkeit sofort die AIM-Aktivisten Dino Butler, Bob Robideau und Leonard Peltier. Butler und Robideau wurden noch 1975 festgenommen und später aufgrund des Verdachts, dass das FBI die Anklagebeweise manipuliert habe und der anzunehmenden Notwehrsituation freigesprochen. Als Peltier am 6. Februar 1976 in Kanada festgenommen und aufgrund von Falschaussagen einer angeblichen Zeugin an die USA ausgeliefert wurde, hatte er bei seinem Prozess keinerlei Chance auf ein faires und korrektes Verfahren. Das FBI setzte alles daran, seine Verurteilung zu bewirken.
1977 wurde Peltier zu zweimal lebenslänglich verurteilt. Und bis heute verhindern das FBI und andere Kräfte, dass dem Aktivisten endlich Gerechtigkeit widerfährt. Längst haben sich frühere, an den zahlreichen Verfahren beteiligte Richter und Staatsanwälte für Peltiers Begnadigung eingesetzt. Der lange Jahre aufsichtführende Staatsanwalt James Reynold hat sich bei ihm entschuldigt und US-Präsident Joseph Biden gebeten, Peltier freizulassen. Es gebe keinerlei Beweise für dessen Mitschuld am Tod der FBI-Agenten. Zum gleichen Schluss kam die UN-Arbeitsgruppe zu diskriminierenden Inhaftierungen in einem 17seitigen Bericht im August 2022. Und auch der Nationalkongress der Demokratischen Partei der USA hat einstimmig die Forderung nach Peltiers Freilassung in ihr Partei- und Wahlprogramm aufgenommen. Dennoch bewegt sich auf den alles entscheidenden Ebenen immer noch nichts, was auf eine baldige Begnadigung Peltiers hinweisen könnte.
An Peltiers 79. Geburtstag werden daher wieder zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen mit der Forderung nach sofortiger Freiheit für den politischen Gefangenen stattfinden. In den USA sind in mehreren Städten Aktionen geplant, unter anderem von Amnesty International direkt vor dem Weißen Haus. Aber auch hier in Europa sind Mahnwachen und andere Aktionen geplant, so in Wien, Mailand, Venedig, Viterbo, in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig und Hamburg. Eine Übersicht finden Interessierte unter leonardpeltier.de. Und auch die 2021 begonnene Postkartenaktion wird weitergeführt. Mittlerweile sind 65.000 Postkarten im Umlauf, die US-Präsident Biden um Begnadigung Peltiers bitten. Postkarten und Unterschriftenlisten können über die Adresse lpsgrheinmain@aol.com angefordert werden. Koordiniert werden die Aktionen unter anderem durch den Verein Tokata-LPSG RheinMain e. V. und die European Alliance for the Self Determination of Indigenous Peoples.
Quelle: junge Welt v.12.09.2023/ privat
Inhaftiert seit 1977: Leonard Peltier ist einer der am längsten einsitzenden politischen Gefangenen (o. D.)

Info über Kolumbien
Ehemaliger paramilitärischer Macaco gestand Verbindungen zu Staatsanwälten und Richtern
Herausgegeben von Editora Bogotá | 17.2023.<> | Menschenrechte, Featured
17. Aug. CI.- Auf dem Treffen für die Wahrheit, das am Donnerstag vom Außenministerium organisiert wurde, erkannte der ehemalige paramilitärische Führer Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco", die Verbindungen des Paramilitarismus zu hohen Staatsbeamten wie dem ehemaligen Staatsanwalt Nestor Humberto Martínez und dem Richter José Leonidas Bustos an.
Carlos Mario Jimenez, alias "Macaco", der die Vereinigten Selbstverteidigungskräfte Kolumbiens (AUC) in Magdalena Medio befehligte, kam aus dem Gefängnis von Itagui in das Bogotá Memory Center.
Macaco sagte, die Regierung von Alvaro Uribe habe sie nach ihrer Demobilisierung verraten und an die Vereinigten Staaten ausgeliefert, um ihn und andere paramilitärische Führer zum Schweigen zu bringen.
Der ehemalige Paramilitär sagte, er werde Details über ein Komplott gegen Präsident Gustavo Petro bekannt geben und fügte hinzu: "Die bedingungslose Unterstützung, die der ehemalige Richter José Leónidas Bustos und der ehemalige Staatsanwalt Néstor Humberto Martínez auf vielfältige Weise geleistet haben, mit der festen Absicht, das Bild des heutigen Präsidenten Gustavo Petro auf seinem Weg zu den zukünftigen politischen Bestrebungen, die er zu dieser Zeit entwickelte, systematisch zu verfolgen und durch die Staatsanwaltschaft zu zerstören."
Ecopetrol-Diebstahl und Infiltration im Staat
Carlos Mario Jiménez erklärte, dass die Paramilitärs mit Unterstützung der Politiker die Finanzen des Staatsunternehmens Ecopetrol ausgeblutet hätten.
Er sagte auch, dass er mehr Informationen über die Verbindungen zwischen dem Paramilitarismus und dem Staat habe: "Wir haben einige Richter der Obersten Gerichte infiltriert und korrumpiert für verschiedene Themen, wie die Präsidentschaftswahlen und Wiederwahlen, die Wahl des Generalstaatsanwalts der Nation, Senatoren, Vertreter der Kammer, Gouverneure, Bürgermeister. Auch andere schwerwiegende Korruptionsvorfälle."
Macaco entschuldigt sich bei den Opfern
Carlos Mario Jiménez versprach, Informationen über Vermisste und Massengräber in den Grenzgebieten zu Venezuela und Ecuador zu liefern.
Darüber hinaus entschuldigte er sich bei allen Opfern und beim Außenminister selbst, den die Paramilitärs irgendwann zum militärischen Ziel erklärten.
Er gab auch zu, dass sie planten, Senator Iván Cepeda und den derzeitigen Präsidenten Gustavo Petro zu ermorden. Jimenez räumte ein, dass es sich um "gescheiterte" und falsche Handlungen handelte.
Schließlich bat Macaco die Sondergerichtsbarkeit für den Frieden (JEP), mehr paramilitärische Kommandeure anzuhören, damit seiner Meinung nach die ganze Wahrheit bekannt wird.
Wahrheit und Nichtwiederholung: Außenministerin Leyva
Außenminister Álvaro Leyva betonte, dass seine Behörde der "totalen Wahrheit" verpflichtet sei und versicherte: "Der kolumbianische Staat hat die Pflicht, mit angemessenen Mitteln in seinem Rahmen Wahrheit, Gerechtigkeit, Wiedergutmachung und Maßnahmen der Nichtwiederholung in Bezug auf schwere Verletzungen des humanitären Völkerrechts und schwere Menschenrechtsverletzungen zu gewährleisten."
In Bezug auf die Äußerungen von Macaco forderte der Außenminister, dass sie gegenübergestellt und überprüft werden, wofür er anerkannte, dass das System, das die JEP hat.
Dieses Ereignis der Nichtwiederholung ist das zweite nach Juan Frio, Norte de Santander, wo die Aussagen von Salvatore Mancuso gehört wurden.
Das kolumbianische Außenministerium organisierte das Treffen, an dem Delegierte aus Spanien, Schweden, der Schweiz, Ecuador, Kuba, Katar, Nicaragua, Honduras, Argentinien, Uruguay und der Dominikanischen Republik sowie Vertreter der Mission zur Unterstützung des Friedensprozesses in Kolumbien und der OAS teilnahmen.
Quelle: Columbia Informa CI CZ/FC/17/08/2023/19:40

Kampf um Menschenrechte in der BRD
Aus: Ausgabe vom 10.08.2023, Seite 8 / Abgeschrieben
DKP: Verfassungsbeschwerde gegen Maulkorb für Kriegsgegner
Die Vorsitzenden der DKP haben Verfassungsbeschwerde gegen einen neugefassten Paragraphen des Strafgesetzbuches eingelegt. In einer Pressemitteilung vom Mittwoch heißt es dazu:
Die beiden Vorsitzenden der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP), Wera Richter und Patrik Köbele, haben gemeinsam mit dem Juristen Dr. Dr. Ralf Hohmann Verfassungsbeschwerde gegen die Neufassung des Paragraphen 130 des Strafgesetzbuches eingelegt. Sie argumentieren, dass die Neufassung des Paragraphen einen Verstoß gegen die grundgesetzlich gesicherte Meinungsfreiheit und die grundgesetzlich vorgeschriebene Bestimmtheit eines Gesetzes darstellt. Die Verfahrensweise der parlamentarischen Beschlussfassung als sogenanntes Omnibusgesetz, also als Anhang eines anderen Gesetzes ohne inhaltlichen Bezug, wird vor allem deshalb moniert, weil das Gesetz »ohne tiefgehende parlamentarische Befassung durchgepeitscht worden ist«.
Richter und Köbele erklären weiter: »Wurde der Volksverhetzungsparagraph in der Vergangenheit viel zu selten gegen die Leugnung und Verharmlosung der Verbrechen des Faschismus eingesetzt, so soll er jetzt als Waffe gegen alle die genutzt werden, die die Aufrüstungs- und Kriegspolitik, die die NATO-Gefolgschaft der Bundesregierung ablehnen. Das ist Teil einer Politik des reaktionären Staatsumbaus, die wir auf allen Ebenen, auch auf der juristischen, bekämpfen. Wir gehen davon aus, dass die Neufassung des Gesetzes verfassungswidrig ist.«
kurzelinks.de/verfassungsbeschwerde
Quelle: junge welt v.10.08.2023/ Christian Ditsch
Patrik Köbele, Vorsitzender der DKP, auf der XXI. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz (Berlin, 9.1.2016)

Verletzung der Menschenrechte der indigenen Bevölkerung
Katholische "Heime" in Französisch-Guayana: Indigene Gemeinschaften mobilisieren sich für Reparationen
Die erzwungene Assimilation indianischer und kastanienbrauner Kinder in katholischen Internaten, die in dem Buch Allons enfants de la Guyane enthüllt wird, könnte Gegenstand einer Wahrheits- und Versöhnungskommission sein. Darauf hoffen viele indigene Organisationen.
"Es war notwendig, den Indianer zu töten, aber den Mann zu behalten." So fasst Alexis Tiouka, ein indigener Aktivist, die elf Jahre seines Lebens zusammen, die er in den "Häusern" verbracht hat. Diese katholischen Residential Schools nahmen ab den 1930er Jahren indianische und kastanienbraune Kinder auf, um sie unter dem Deckmantel des Zugangs zu Bildung zu evangelisieren und "sozial zu assimilieren".
Dieser Artikel wird von Guyaweb über den Wire-Partner Mediapart erneut veröffentlicht
Dieses System wurde 1935 in Mana eingeführt und 1949, nachdem Französisch-Guayana ein Departement geworden war, vom Staat genehmigt, indem es die Unterbringung von Kindern und die Entwicklung von Heimen öffentlich finanzierte.
Das im September erschienene Buch der Journalistin Hélène Ferrarini, Allons enfants de la Guyane, wirft ein grelles Licht auf diesen verschütteten Teil der Geschichte Guayans. Eine Geschichte, die immer noch andauert, denn ein letztes Heim befindet sich noch in Saint-Georges-de-l'Oyapock und wird von etwa sechzig Kindern aus Trois-Sauts, einem Dorf ohne Schule, besucht.
Internatsschule von Saint-Laurent-du-Maroni, 1964. © Foto: AGFMM
Die Untersuchung unseres Kollegen legt die ersten Meilensteine eines Testimonials. Von den 2.000 Kindern, die durch die Heime gingen, "haben etwa vierzig ehemalige Bewohner in dem Buch ausgesagt, aber es gibt noch viel zu enthüllen", erklärt Hélène Ferrarini während einer Debatte, die am 10. Dezember im Eldorado-Kino Cayenne organisiert wurde.
Sie ist der Meinung, dass "jedes Haus, von Iracoubo, Sinnamary, Maripasoula..., eine spezifische Forschung verdient, weil es nicht so viele gibt, außer der Pionierarbeit von Françoise Armanville", die vor zehn Jahren veröffentlicht wurde.
Aber "seit der Veröffentlichung des Buches gibt es einen Schneeballeffekt, ein Bedürfnis, die Wahrheit zu sagen, Bewusstsein und Mut zu sprechen. Die Dinge werden sich ändern, wenn die ehemaligen Bewohner sich entscheiden, ihre Geschichten zu erzählen", sagt der Anwalt Alexis Tiouka, der sich für die Anerkennung der indigenen Völker von Französisch-Guayana einsetzt.
Das Bedürfnis, frei zu sprechen, ist dringend, da direkte Zeugen allmählich verschwinden, wie Jean Appolinaire, ein Kalin'a, der im Juni 2021 starb und dessen Geschichte Gegenstand eines Kapitels des Buches ist.
"Es ist sehr schwierig, über das zu sprechen, was wir erlebt haben"
An diesem Abend erzählten ehemalige Internatsschüler im Beisein von Hélène Ferrarini, wie sie von ihren Familien getrennt und in katholische Residential Schools geworfen wurden.
Wie Alexis Tiouka, der im Alter von sechs Jahren in einem Heim untergebracht wurde: "In den Heimen mussten wir uns vor den Ordensleuten verbeugen, das wurde uns eingetrichtert. Unsere Haare wurden wie beim Militär rasiert, während sie für uns Kalin'a eine Quelle des Stolzes und der Spiritualität sind. Haare sind in unserer Kultur sehr wichtig. All diese Regeln wurden auferlegt. Wir wurden die ganze Zeit diskreditiert und gedemütigt. Es ist sehr schwierig, über das zu sprechen, was wir erlebt haben."
"Was mich am meisten verletzt hat, war, dass ich meine Sprache nicht mehr sprechen konnte", sagt Eleonore "Kadi" Johannes, die mit vier Jahren ins katholische Internat kam. "Die Heime prägten den Rest meines Lebens. Es ist kein Zufall, dass ich auch heute noch ein wütender Aktivist bin. Es ist eine Frage des Überlebens", sagt der Sprecher des Kollektivs namens Or de question.
Wenn diese Aktivisten der indianischen Sache ihre Stimme erheben, "dann nur, um zu vermeiden, dass sich das gleiche Muster wiederholt, das heute andere Namen trägt: Gastfamilie, Internat", betont Alexis Tiouka. Vielleicht liegt es an der Art der Veranstaltung, aber unter den Interventionen des Publikums sticht eine Stimme hervor. Das ist die von Jean-Paul Fereira, Bürgermeister von Awala-Yalimapo und erster Vizepräsident der territorialen Gemeinschaft. Er wurde in den 1970er Jahren geboren und gehört zu der letzten Generation, die das Mana-Heim vor seiner Schließung in den 1980er Jahren besucht hat.
Roucou war, wie andere kulturelle Verbindungen, den Bewohnern verboten. Nur Hängematten waren erlaubt. © Foto: Boris R-Thébia
Als er um das Buch gebeten wurde, hatte er noch nie zuvor über seine Erfahrungen gesprochen und ein wertvolles Zeugnis für die gedämpfte Einrichtung des Kinos abgelegt.
"Als wir in das Internat kamen, bekamen wir eine Nummer. Ich war die Nummer 11. Ich erinnere mich noch heute daran. Es gab körperliche und sexuelle Misshandlungen, aber viele Menschen wollen nicht darüber reden. Auch wenn das Heim geschlossen ist, ist es ein aktuelles Ereignis, weil wir es in unseren Köpfen, in unseren Adern, in unserem Fleisch leben. Ich möchte Hélène Ferrarini für dieses Buch danken, aber ich bedauere die Tatsache, dass es oft die anderen sind, die für uns sprechen, wenn es um indigene Völker geht, die für uns sprechen."
"Diese Geschichte ist schmerzhaft, traumatisch und tabuisiert", erklärt Boris Thebia, ein Guainese-Dokumentarfotograf, der seit sieben Jahren in Kanada lebt. Dort erfuhr die indigene Bevölkerung die gleiche erzwungene Assimilation durch Bildung in großem Umfang (150.000 untergebrachte Kinder). Eine Geschichte, die mit der der Häuser in Guayana übereinstimmt, die Boris Thébia bekannter machen möchte. In Kanada sei dies "ein echtes soziales Problem", seit die Regierung 2009 mit der Arbeit an Anerkennung und Reparationen begonnen habe.
"Die Geschichte von Guayana könnte auf die Vereinigten Staaten, Australien, Skandinavien übertragen werden, überall dort, wo die indigene Bevölkerung dies erlebt hat. In all diesen Ländern wurden Wahrheits- und Versöhnungskommissionen eingerichtet, um dieses Trauma zu reparieren. Nicht in Frankreich", erklärt Juraprofessor Jean-Pierre Massias, Präsident des Louis-Joinet-Instituts, das sich auf Übergangsjustiz spezialisiert hat. "Eine der Konsequenzen des Buches, um das Trauma zu überwinden, könnte ein universitäres Forschungsprogramm und eine Wahrheits- und Versöhnungskommission sein", fügt er hinzu.
In Kanada (hier in der Provinz Manitoba, 1940) wurden Kinder in "Internatsschulen" untergebracht. 150.000 Menschen erlebten dieses erzwungene Assimilationssystem, so staatliche Untersuchungen zwischen 2009 und 2015. © Fotothek und Archiv Kanada
"Geben Sie zu, dass es in Frankreich passiert ist"
In Zusammenarbeit mit dem Gewohnheitsgrossen Rat (GCC) und zahlreichen indigenen Organisationen (Foag, Onag, JAG, Copag) kam Jean-Pierre Massias nach Guayana, um rechtliche Schritte in Anerkennung der erlittenen Gewalt einzuleiten. Diese Kommission, die sich aus Experten (Juristen, Psychiatern, Historikern, Opfern, Anthropologen) zusammensetzte, hatte zum Ziel, "Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen, Verstöße zu identifizieren, den Opfern zuzuhören, Verantwortlichkeiten zu bestimmen, Maßnahmen zur Wiedergutmachung und Reorganisation der Gesellschaft vorzuschlagen, um zu vermeiden, dass sich dieselben Fakten wiederholen", sagt der Rechtsexperte, der in Palästina und in Afrika gearbeitet hat. "Das sind die vier Prinzipien der Wahrheits- und Versöhnungskommission, die nicht dazu da ist, eine Regierung zu verurteilen, sondern im Namen der Würde Wiedergutmachung zu erwirken."
Unter den möglichen Wiedergutmachungen werden die symbolischen – "Entschuldigung, Errichtung von Denkmälern, Rückgabe gestohlener Gegenstände" – am häufigsten verwendet. "Schwer zu quantifizierende und sehr teure" finanzielle Reparationen werden nach der Erfahrung von Jean-Pierre Massias selten verwendet.
"Wir könnten so weit gehen, dass wir kulturelle Identität anerkennen. Um die Bewahrung der indigenen Sprache und Kultur zu gewährleisten und damit das System wieder aufzubauen, indem soziale Reformen vorgeschlagen werden, insbesondere im Bildungsbereich", hofft der Rechtsexperte.
Im Moment ist Guayana weit von dieser Anerkennung entfernt. Der Gewohnheitsgrosse Rat organisierte Mitte Dezember ein Seminar, um das Projekt der Wahrheits- und Versöhnungskommission (TRC) zu diskutieren. Das Budget wurde jedoch von der Präfektur, der Verwaltungsorganisation, die für das Vertretungsorgan zuständig ist, eingefroren.
Eine Budgetkürzung von "15.000 Euro", so Christophe Yanuwana Pierre, der Vizepräsident des Unternehmens. Und das nicht wegen leerer Kassen. Laut Christophe Pierre waren Anfang Dezember "85.000 Euro Budget im GCC übrig, von insgesamt 195.000 für 2022. Seitdem wurde als Zeichen der verstärkten Aufsicht auch das Budget (25.000 Euro) für das Wohlstandstreffen vom 17. bis 18. Dezember ausgesetzt.
Dänemark, Finnland, Kanada und die Vereinigten Staaten haben alle dieses "Instrument zur Erneuerung der Demokratie, das ist die TRC", aktiviert, sagt Jean-Pierre Massias, "nicht Frankreich". Eine "ganz ähnliche" Kommission gab es zwar während des Skandals um die "Reunionesen der Creuse", bei denen Kinder aus dem Kinderfürsorgesystem ohne ihre Zustimmung in französische Departements verlegt wurden, die von Landflucht bedroht waren, aber "Beispiele bleiben rar", sagt der Jurist. "Das Hindernis für die Umsetzung ist nicht rechtlicher oder finanzieller, sondern psychologischer Natur: zuzugeben, dass es in Frankreich passiert ist."
Um diese symbolische und historische Anerkennung dessen, was einem kolonialen Verbrechen gleicht, zu erreichen, muss das guyanische Narrativ "strukturierter sein, indem zum Beispiel die Kirche eingeladen wird, zu diesem Thema zu sprechen", erklärt der Präsident des Joinet-Instituts, der gekommen ist, um eine Methode zu destillieren und Fragen zu beantworten: Was ist der Zweck einer TRC? Wie sollte man es einrichten, welche Mission hätte es? Diese Fragen wurden während eines Seminars zum Thema "Aborigines und Schule, Wiedergutmachung von Ungerechtigkeit" diskutiert und bearbeitet, das am 13. Dezember an der Universität von Guayana stattfand.
An einem Nachmittag traf sich der GCC zu einer Sonderversammlung und legte den Grundstein für die Einrichtung einer Wahrheits- und Versöhnungskommission. Ein Bericht über diese Arbeit ist in Vorbereitung. Es wird der erste Schritt zur Eröffnung eines TRC sein.
"Wir müssen daher eine Machbarkeitsstudie vor Ort für drei Monate starten. Dann ein bis zwei Jahre Arbeit, um Zeugen zu hören, Verantwortlichkeiten festzulegen und Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen, die in einem Bericht festgehalten werden sollen", erklärt Jean-Pierre Massias. Ein Projekt, das finanzielle Mittel benötigt, um ein Expertenteam aufzubauen, eine Aneignung durch die Indianer und den politischen Willen, es ins Leben zu rufen.
Zu diesem Zweck ist bereits Lobbyarbeit bei Parlamentariern im Gange. Darüber hinaus fiel das Seminar mit einem Besuch der Präsidentin der Nationalversammlung, Yaël Braun-Pivet, in Französisch-Guayana zusammen, die nach Camopi reiste. Sie bestätigte, dass sie informell zu den Häusern und dem Kommissionsprojekt befragt worden sei und dass der Präsident der Versammlung das Thema "frontal" angehen wolle.
"Es ist eine ständige Herausforderung, kleine Kinder aus diesen isolierten Gebieten auszubilden und zu erziehen, ohne ihre Kultur und Geschichte zu vernichten. Über die Bildung hinaus betrifft dieses Thema die Integration und den Respekt der indigenen Bevölkerung in Französisch-Guayana und in ganz Frankreich", erklärte sie.
Ein seltenes Wort von den "Behörden", obwohl weder der Staat noch die Präfektur seit der Veröffentlichung des Buches ein Wort gesagt haben und dem Seminar, zu dem sie eingeladen wurden, ferngeblieben sind. Unsere Bitte um ein Gespräch mit dem Unterpräfekten der Binnengemeinden wurde auch vom örtlichen Vertreter des Staates abgelehnt.
"Wir müssen das Gesetz selbst in die Hand nehmen", sagt Christophe Yanuwana Pierre, Sprecher der Jeunesses autochtones, deren Mutter und Großmutter ehemalige Bewohner der Häuser sind.
Dies sei eine Möglichkeit, die Zivilgesellschaft zum Handeln zu drängen, ohne auf die Zustimmung des Staates zu warten, während "es legitim ist, eine Wahrheits- und Versöhnungskommission in Guayana zu eröffnen, weil die Geschichte der Häuser eine Zeitbombe in der Gesellschaft ist. Sie spielt eine Rolle bei innergemeinschaftlicher Gewalt, bei Selbstmorden und bei der kulturellen Destabilisierung", sagt Jean-Pierre Massias. "Und die Einsetzung einer solchen Kommission könnte andere traumatische Erfahrungen wie die Sklaverei, die Strafkolonie eröffnen ... und anderen Gemeinschaften in Guyana die Möglichkeit zu geben, sich zu emanzipieren."
"Minderheiten sind oft die vorausschauenden", sagte der Abgeordnete Jean-Victor Castor (DDR-Gruppe), der der Vorführung im Eldorado beiwohnte. "Ihr organisiert euch. Vielleicht führt der indigene Kampf zu einer allgemeineren Emanzipation?"
Die indianischen Häuser wären dann der Ausgangspunkt einer größeren Frage: der Assimilation oder Beherrschung der indigenen Völker durch die westliche Welt. Eine Kommission würde es ermöglichen, dieses Ereignis in etwas Systemischeres zu verlagern.
Bildung, der Eckpfeiler
Selbst wenn die Schulen – die letzte, die in Saint-Georges in Betrieb ist, mit der Eröffnung eines Schulkomplexes in der Stadt im September 2023 geschlossen werden sollten, so die Territorialbehörde von Französisch-Guayana (CTG) – "hört die Geschichte nicht auf und ein Kontinuum von Integrationsschwierigkeiten, Gewalt und Armut geht weiter", analysiert Jean-Pierre Massias. die sich für tiefgreifende systemische Reformen einsetzt, insbesondere im Bildungsbereich.
Die Schulbildung indigener Kinder und ihre Unterbringung sind auch im Jahr 2022 wichtige Themen. Nach Angaben von Libération sind derzeit etwa 300 Schüler aus abgelegenen Gemeinden in Internaten oder bei Gastfamilien untergebracht, meist an der Küste und ab der sechsten Klasse, da es keine lokalen Schulen gibt. Das ist alles andere als ideal und führt zu Schulabbrüchen.
Die CTG arbeitet seit einem Jahr an einer neuen Richtlinie für Gastfamilien, um die zahlreichen Funktionsstörungen dieses Systems zu beheben.
Aus diesem Grund könnten über die Anerkennung der Gewalt durch den Staat hinaus Bildungsfragen eine zentrale Rolle bei den von der Wahrheits- und Versöhnungskommission vorgeschlagenen Maßnahmen zur Nichtwiederholung spielen.
"Bildung ist ein Menschenrecht an sich und ermöglicht die Verwirklichung anderer Rechte", erinnert Alexis Tiouka im Vorwort zu Allons enfants de la Guyane. Diese Haltung ähnelt der des Vertreters von Französisch-Guayana von Unicef, der UN-Organisation für Kinder, die an dem an der Universität organisierten Seminar teilnahm.
Laut einem Bericht der Beobachtungsstelle für sprachliche Praktiken aus dem Jahr 2017 werden in Französisch-Guayana etwa 20 "Erstschulsprachen" verwendet. Seit 1998 ermöglicht das muttersprachliche Lautsprechersystem den Unterricht in diesen Regionalsprachen. Dies ist eine der seltenen Bemühungen, die Bildungseinrichtung an indigene Schüler anzupassen.
"Bildung ist eng mit Fragen des Kinderschutzes oder der Gastfamilien verflochten, denn das Wohnen in Französisch-Guayana ist aufgrund seiner Abgeschiedenheit ein Faktor für den Zugang zu Bildung und den Bildungserfolg. Das ist eine der Besonderheiten hier, zusammen mit den Sprachen", bemerkt David Chenu.
Während des Seminars leitete er einen Workshop über die Lebensrealitäten indigener Schüler: Unterkunft an der Küste, Transport, Mobilität, Verbindung zwischen Familie und Schule. Zwischen 60 und 70 Personen nahmen teil, verglichen mit 30 beim CVR-Workshop, ein Zeichen für das starke Interesse an diesen alltäglichen Themen.
Am Ende dieses Workshops wurden mehrere Beobachtungen gemacht und ein Bericht wird in den kommenden Wochen verfasst. Sie sind nicht neu und erfordern zunächst eine engere Anbindung an die Bildungseinrichtung. "Das wäre zum Beispiel in Trois-Sauts relevant, wo es ein Potenzial von 150 zukünftigen Sekundarschülern gäbe", betont David Chenu.
Zweitens die Notwendigkeit, die indianische Kultur an der Küste zu fördern, "mit Ideen wie der Vervielfachung der Zahl der indianischen Kontaktstellen in den Schulen, in denen indigene Schüler willkommen sind. Diese Anlaufstelle würde eine Verbindung schaffen, um die schulischen Mechanismen zu verstehen, die gleiche Sprache zu sprechen, Blockaden zu vermeiden und schließlich einen Schulabbruch zu vermeiden", sagt der Unicef-Delegierte.
Nur eine Schule auf der Insel Cayenne hat laut David Chenu eine solche Stelle. Wir waren nicht in der Lage, diese Informationen mit der Schulbehörde abzugleichen.
Dritte Beobachtung: die Notwendigkeit, die Beteiligung von Kindern und Familien an bestehenden Systemen zu erhöhen, um ein besseres Verständnis und eine bessere Unterstützung zu erreichen.
"Wir müssen sie einbeziehen, um darüber nachzudenken, was sich ändern könnte, damit die Regeln nicht nur von den Institutionen festgelegt werden. Dadurch ist es möglich, mehr Verbindungen zu schaffen, um zum Beispiel Notfallmechanismen einzurichten, wenn es Bedenken gibt", erklärt David Chenu.
Während des Workshops wurde auch mehr Transparenz gefordert, damit alle die Lebensrealitäten von Kindern und Familien verstehen können, "und um zu vermeiden, dass junge Menschen auf der Straße landen, wenn die Internate an Wochenenden oder in den Ferien schließen", betont der Unicef-Vertreter.
"In Französisch-Guayana gibt es viel zu tun, aber wir könnten uns von dem inspirieren lassen, was zum Beispiel in Polynesien getan wurde, wo die Inseln über die Oberfläche Europas verstreut sind. Die Antwort dort sind weiterführende Schulen mit mehreren Standorten, das ist eine Idee."
Es steht viel auf dem Spiel: Lokale Einrichtungen, die in der Lage sind, eine angemessene Ausbildung anzubieten, damit die Wohnungen nicht einfach durch eine anders benannte Struktur ersetzt werden, die die gleichen Ergebnisse liefert.
Quelle: Progressive international, August 2023

Leben in Würde - ein Menschenrecht !
Aus: Ausgabe vom 27.07.2023, Seite 1 / Titel
KINDERARMUT
Jugend ohne Zukunft
Jedes vierte Kind in der BRD ist arm. Ampelkoalition priorisiert Aufrüstung und sagt Kindergrundsicherung faktisch ab
Von Gudrun Giese
Die Massenverarmung in der BRD schreitet voran. Den jüngsten Beweis dafür lieferte das Statistische Bundesamt am Mittwoch. Denn nach Zahlen der Behörde ist die Anzahl armer Kinder im vergangenen Jahr hierzulande gestiegen: Mittlerweile ist es jedes vierte. Betroffen sind vor allem Kinder und Jugendliche aus Elternhäusern mit »niedrigem Bildungsabschluss«, wie es heißt. Hinlänglich bekannt, bedarf der erneute Beleg für das soziale Scheitern dieser Gesellschaft einer behördlichen Einordnung: Armut sei ein »mehrdimensionales Phänomen« und könne sich »nicht nur in finanziellen, sondern auch in sozialen Faktoren niederschlagen«, hieß es. Danke für nichts.
Konkret sind der Erhebung zufolge 37,6 Prozent der unter 18jährigen arm, wenn ihre Eltern über einen Haupt- oder Realschulabschluss, aber keinen beruflichen Abschluss verfügen. Kinder aus Familien mit mittlerem Bildungsabschluss waren in 14,5 Prozent der Fälle arm. Bei Eltern mit Hochschul- oder Meisterabschluss lag die Quote mit 6,7 Prozent deutlich niedriger.
Die Ergebnisse, über die das Statistische Bundesamt berichtete, entstammen der Europäischen Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen, der amtlichen Hauptdatenquelle für die Messung von Armut und Lebensbedingungen in allen EU-Ländern. Danach gilt als »armutsgefährdet« (Technokratensprech für »arm«), wer über weniger als sechzig Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung verfügt. Für Alleinlebende lag der Schwellenwert in der BRD im vergangenen Jahr bei 1.250 Euro netto monatlich, für zwei Erwachsene mit zwei Kindern im Alter unter 14 Jahren bei 2.625 Euro.
Nach diesem Maßstab ist die Situation in der BRD im Europäischen Vergleich besonders gravierend: In zwei Dritteln aller EU-Staaten ist die Kinderarmut niedriger. Laut Statistikern war in Slowenien mit 10,3 Prozent, in Tschechien mit 13,4 Prozent und in Dänemark mit 13,8 Prozent die »Armutsgefährdung« bei Kindern am niedrigsten. Am höchsten fielen die Werte mit 41,5 Prozent in Rumänien, 33,9 Prozent in Bulgarien und 32,2 Prozent in Spanien aus. In absoluten Zahlen waren im Jahr 2022 rund 20 Millionen Kinder und Jugendliche EU-weit arm.
Würde in der BRD ab kommendem Jahr eine Kindergrundsicherung eingeführt, die diesen Namen verdient, könnte die Armut unter Minderjährigen reduziert werden. Doch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will nur zwei Milliarden Euro dafür bereitstellen – viel zu wenig, um den Betroffenen ernsthaft zu helfen, wie Sozialverbände und Gewerkschaften seit Wochen unisono kritisieren. Während Familienministerin Elisabeth Paus (Bündnis 90/Die Grünen) sich inzwischen von ihrer ursprünglichen – ohnehin zu niedrigen – Forderung von zwölf Milliarden Euro verabschiedet hat, erklärte Armutsforscher Christoph Butterwegge im Gespräch mit dieser Zeitung bereits im April, dass mehr als 20 Milliarden Euro nötig wären, um Kinderarmut wirksam zu bekämpfen.
20 Milliarden Euro – das ist exakt die Summe, die Verteidigungsminister Boris Pistorius nun allein für neue Artillerie- und Panzermunition bei Rheinmetall und Co. ausgeben will, wie er am Montag dem Spiegel erklärte. Die Äußerung des kriegsfreudigen Ministers unterstreicht erneut eindrücklich die Prioritäten der Ampelkoalition: Da stehen Aufrüstung und Krieg – insbesondere zum Leidwesen der armen Kinder in diesem Land – deutlich vor Bemühungen für Armutsbekämpfung, Bildung und Frieden.
Uelle¨junge Welt v.27.07.2023/ imago images/photothek
Von der Ampelkoalition haben Kinder und Jugendliche nicht viel zu erwarten

UN-verurteilt Einsatz der US-Streumunition
UN-Generalsekretariat verurteilt den Einsatz von US-Streumunition durch Kiew
21 Juli 2023 21:47 Uhr
Nach offiziellen Angaben aus Washington setzt die Ukraine bereits seit einer Woche aus den USA gelieferte Streumunition ein. Das Generalsekretariat der UNO zeigte sich am Freitag besorgt über diese Tatsache.
Quelle: www.globallookpress.com © Giada Papini Rampelotto/EuropaNe
Berichte über den Einsatz von US-Streumunition durch Kiew seien besorgniserregend, sagte der Sprecher des UN-Generalsekretärs, Stéphane Dujarric, bei einem Briefing am Freitag.
"Wir haben diese Berichte gesehen, sie sind sehr beunruhigend. Wie wir bereits gesagt haben, sollten diese Arten von Munition der Vergangenheit angehören und nicht mehr eingesetzt werden", sagte er.
Am 7. Juli verkündete US-Präsident Joe Biden die Entscheidung, dem Kiewer Regime Streumunition zur Verfügung zu stellen, und eine Woche später teilte das Pentagon mit, dass die Ukraine diese Munition bereits erhalten habe, und zwar nicht nur von den Vereinigten Staaten, sondern auch von anderen Ländern.
Nach Angaben des Verteidigungsministeriums haben die ukrainischen Streitkräfte bereits Streumunition zum Beschuss des Donbass eingesetzt. Dies zeige, dass die ukrainischen Truppen ihre Aufgabe darin sähen, so viele Zivilisten wie möglich zu töten, so der offizielle Sprecher des Ministeriums, Igor Konaschenkow.
Auch US-Medien berichteten, dass die durch das Pentagon gelieferte Streumunition bereits im Einsatz sei. Der Koordinator für strategische Kommunikation des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, John Kirby, bestätigte dies am Donnerstag. Nach seinen Worten setze die Ukraine bereits seit einer Woche von den USA gelieferte Streumunition ein:
"Sie (die Munition - Anm. d. Red.) ist seit etwa einer Woche auf dem Schlachtfeld im Einsatz. Wir erhalten Rückmeldungen von den Ukrainern, sie setzen sie sehr effektiv und angemessen ein", sagte Kirby gegenüber Reportern.
Die internationale Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch erklärte, dass die Weitergabe dieser Waffen an Kiew unweigerlich zu langfristigem Leid der Zivilbevölkerung führen und die internationale Kritik an ihrem Einsatz aushöhlen würde.
Quelle: RT v.21.07.2023/Bild Stéphane Dujarric.

Verletzung der Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 14.07.2023, Seite 1 / Titel
ERNÄHRUNGSPOLITIK
735 Millionen hungern
Welthungerhilfe legt Jahresbericht vor: Zahl chronisch Unterernährter weiter auf »hohem Niveau«. Verschärfung der Lage befürchtet, vor allem für Frauen
Von Oliver Rast
Sie merkte kurz auf – sagte dann entschieden: »Darauf ein klares Ja!« Denn: »Hunger ist weiterhin weiblich, oder?« hatte der jW-Autor Augenblicke vorher die Präsidentin der Welthungerhilfe, Marlehn Thieme, gefragt. Eine spezielle Ungleichheit auch nach Jahrzehnten von »Entwicklungsarbeit« im globalen Süden.
Der Anlass der Unterredung: Am Donnerstag vormittag präsentierte die Nichtregierungsorganisation (NGO) ihren Jahresbericht 2022 in einem Verwaltungstrakt in Berlin-Mitte an der Friedrichstraße. »Wir sind damit sehr aktuell«, betonte Thieme. Tags zuvor hatte bereits die UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) ihren Welternährungsbericht (SOFI) vorgestellt. Die Zahl Hungernder weltweit bleibe auf »zu hohem Niveau«. Im vergangenen Jahr waren 735 Millionen Menschen unterernährt; chronisch, wohlgemerkt. Das seien 122 Millionen mehr als vor dem ersten Coronajahr 2019. Die »Hungertreiber«, welche sind das? Auf einen Nenner gebracht, die »drei Ks«: Krise, Krieg und Klimawandel. Thieme: »Extrem dramatisch ist die Situation am Horn von Afrika.« Nach vierjähriger Dürreperiode seien rund 36 Millionen Bewohner auf humanitäre Überlebenshilfe angewiesen, sonst erwartet sie der Hungertod.
Dennoch, Thieme versprühte Optimismus. Hunger sei zwar eines der größten Probleme der Welt, aber eben auch ein lösbares. Deshalb halte sie am Ziel »Zero Hunger« fest. Nicht irgendwann, sondern 2030. So hatte es die UN samt »17 Nachhaltigkeitszielen« 2015 beschlossen. Das Problem: Es passt nicht mit der Streichliste im BRD-Haushalt zusammen. Für das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) sollen im kommenden Jahr 700 Millionen Euro weniger bereitstehen. Thieme diplomatisch: »Wir haben natürlich auch Verständnis für die schwierige Haushaltslage.« Ihr Generalsekretär Mathias Mogge wurde hingegen etwas deutlicher. Vor allem die BMZ-Posten »Krisenbewältigung« und »Wiederaufbau« seien »Sparziele«. Nicht nachvollziehbar – und, so Mogge: »ein fatales Signal«. Dabei sei politischer Wille bei der Hungerbekämpfung zentral. Was tun? »Wir müssen den Druck aufrechterhalten, immer wieder die Dringlichkeit des Handelns klarmachen.« Wer ist »wir«? Die Zivilgesellschaft, NGOs etwa, hierzulande und vor Ort in betroffenen Regionen.
Nachgehakt bei der Präsidentin: »Frau Thieme, Sie fordern ›grundlegende Reformen für ein gerechtes und nachhaltiges Ernährungssystem‹. Was heißt das konkret?« möchte jW wissen. Das beispielsweise: Andere Ernährungsweisen im Norden, keine Lebensmittelverschwendung und nicht zuletzt funktionierende Lieferketten.
Überzeugend klingt das nicht, findet Philipp Mimkes. »Zunächst, wir müssen endlich begreifen, dass Hunger kein Schicksal ist«, befand der Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation FIAN Deutschland am Donnerstag im jW-Telefonat. Hunger sei meist ein Resultat von Benachteiligung und Ausgrenzung. Gestärkt werden müssten lokale Bäuerinnen, Hirtenvölker und Kleinfischer. Sie produzierten im globalen Süden rund zwei Drittel aller Nahrungsmittel. Statt dessen verließen sich politisch Verantwortliche »einseitig auf die jahrzehntelangen Versprechen der Agrar- und Ernährungskonzerne, dass ihr industrielles Produktionsmodell den Hunger beendet«. Nur: Seitdem gebe es immer mehr Hungernde.
Auch Thieme spricht – trotz aller Zuversicht – von Krisen, die zu Katastrophen würden. Ein Indikator: »Neben chronisch Unterernährten sind weitere 900 Millionen Menschen temporär unterernährt.« Tendenz steigend. »Eine echte Verschärfung der Lage, besonders für Frauen.«
Quelle: junge Welt v. 14.04.2023/ Farah Abdi Warsameh/picture alliance / ASSOCIATED PRESS
Keine Nahrung ist kein Schicksal, sondern gemacht: Krise, Krieg und Klimawandel (Mogadischu, 30.6.2022)/
Christian-Ditsch.de
Pressekonferenz zu aktuellen Zahlen des globalen Hungers (v. l. n. r.): Simone Pott, Moderatorin; Marlehn Thieme, Welthungerhilfe-Präsidentin; Mathias Mogge, Welthungerhilfe-Generalsekretär (Berlin, 13.7.2023)

Info über den UNO -Menschenrechtsrat
Menschenrechtsrat der UNO verurteilt Koranverbrennung
12 Juli 2023 16:41 Uhr
Die Koran-Verbrennung in Schweden Ende Juni sorgt in islamischen Ländern nach wie vor für Proteste und Wut. Nun hat der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen eine Resolution verabschiedet, die die Aktion verurteilt. Doch es gab auch Gegenstimmen.
Quelle: Legion-media.ru
Nach der viel kritisierten Koran-Verbrennung in Schweden hat der UNO-Menschenrechtsrat gegen die Stimmen einiger europäischer Länder und der USA sowie Costa Ricas eine Resolution verabschiedet. Darin wird die Koran-Verbrennung als Akt der Provokation verurteilt, der eine Verletzung der internationalen Menschenrechtsnormen darstellt. Unter den 47 Ratsmitgliedern gab es heute 28 Ja-Stimmen, zwölf Nein-Stimmen und sieben Enthaltungen.
Mit der Annahme wurde für die nächste Sitzung des Rates eine Debatte darüber beschlossen, wie sich religiöser Hass zeige, was dazu führe und wie dem entgegengewirkt werden könne. Andere konkrete Auswirkungen hat die Resolution nicht.
Im Namen der EU sagte der belgische Botschafter, dass es schwierig sei, die Grenze zwischen Meinungsfreiheit und Aufstachelung zu Hass zu ziehen. Das erfordere eine delikate Balance, die mit dem Text der Resolution nicht gegeben sei. "Vielmehr wird versucht, das internationale Menschenrecht (…) grundlegend zu ändern, indem die strengen Bedingungen, die immer dann gelten, wenn Staaten das Recht auf freie Meinungsäußerung einschränken wollen, abgeschafft werden", sagte der Botschafter.
Der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hatte zum Auftakt der Dringlichkeitsdebatte gestern hetzerische Handlungen gegen Muslime und Angehörige anderer Religionen verurteilt. Er warnte aber davor, die freie Meinungsäußerung pauschal einzuschränken, um "religiöse Lehren vor kritischer Überprüfung zu schützen".
Bei einer Demonstration in Stockholm Ende Juni war vor einer Moschee ein Koran angezündet worden. Mutwillige Koranschändungen gelten im Islam als blasphemisch.
Quelle:RtD. V.12-07.2023/ Symbolbild: Proteste in Karichi, Pakisten, gegen die Koranverbrennung in Schweden. Aufnahme vom 7. Juli 2023.

Ukraine verstößt gegen Menschenrechte
UN-Bericht: Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine nehmen deutlich zu
28 Juni 2023 17:57 Uhr
Die Zahl der Verletzungen des Rechts auf Freiheit und Sicherheit der Person durch ukrainische Sicherheitskräfte hat nach Angaben des Büros des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) seit dem 24. Februar 2022 wesentlich zugenommen.
Quelle: Legion-media.ru © Kim Petersen
Die Zahl der Verstöße ukrainischer Truppen gegen Rechte der Menschen auf Freiheit und Sicherheit hat seit dem 24. Februar 2022 dramatisch zugenommen. Dies ist einem jüngsten Bericht des Büros des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) zu entnehmen. Demnach dokumentierte das OHCHR zwischen dem 24. Februar 2022 und dem 23. Mai 2023 unter anderem 75 Fälle von willkürlicher Inhaftierung von Zivilpersonen (17 Frauen, 57 Männer und ein Junge). Vor allem handelte es sich dabei um Festnahmen durch Strafverfolgungsbehörden oder die Streitkräfte der Ukraine. Bei einigen der Inhaftierungen sei es zu einem gewaltsamen Verschwindenlassen gekommen, hieß es. Insgesamt 43 im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt inhaftierte Personen, 34 Männer und neun Frauen, sollen "glaubwürdige und verlässliche Berichte über Folter und Misshandlungen durch Vollzugsbeamte, Angehörige der Streitkräfte oder Wachpersonal in inoffiziellen Haftanstalten oder – in wesentlich geringerem Maße – in offiziellen Untersuchungshaftanstalten" abgegeben haben.
Zudem sollen ukrainische Strafverfolgungs- und Sicherheitsbeamte von Februar bis März 2022 mehrere Personen ohne Haftbefehl wegen angeblicher Mitgliedschaft in bewaffneten Gruppen der Volksrepubliken Donezk und Lugansk festgenommen haben. Da die vorgeworfenen mutmaßlichen Handlungen sich zwischen 2014 und 2020 ereignet hätten, habe es keine dringende Notwendigkeit gegeben, eine Straftat zu verhindern oder zu beenden. Somit stellten diese Festnahmen unrechtmäßigen Freiheitsentzug dar.
Als besorgniserregend bezeichnet das OHCHR die Tatsache, dass mehrere Zivilisten, die in den von der russischen Armee kontrollierten Gebieten humanitäre Hilfe verteilt hatten, von ukrainischen Behörden verhaftet wurden.
Das OHCHR besuchte nach eigenen Angaben elf Haftanstalten, in denen mit dem bewaffneten Konflikt verbundene Inhaftierte festgehalten wurden. Darüber hinaus dokumentierte das Büro die Nutzung von 29 inoffiziellen Inhaftierungsorten, darunter Wohnungen, Sanatorien, Keller von verlassenen Gebäuden, Polizeireviere, Keller und Verwaltungsräume lokaler Büros des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU.
Quelle: RTD. V.28.06.2023/ Palais Wilson, Sitz des Büros des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, OHCHR, Genf, Schweiz

USA-Verstoß gegen Menschenrechte
UN-Berichterstatterin fordert Schließung des US-Gefangenenlagers Guantánamo
Aktualisiert am 27.06.2023, 17:07 Uhr
Guantánamo ist ein dunkles Kapitel in der US-amerikanischen Geschichte. Immer noch werden dort über 30 Gefangene festgehalten. Die UN-Expertin Fionnuala Ni Aolain fordert daher jetzt die sofortige Schließung.
Die Behandlung der verbliebenen Insassen im US-Gefangenenlager Guantánamo auf Kuba ist nach Einschätzung einer UN-Sonderberichterstatterin nach wie vor "grausam, unmenschlich und herabwürdigend". "Ich habe beobachtet, dass nach zwei Jahrzehnten der Haft das Leid der Inhaftierten tief und anhaltend ist", sagte Fionnuala Ni Aolain, Sonderberichterstatterin der UN für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Terrorismusbekämpfung. Sie äußerte sich am Montag bei der Vorstellung ihres Berichts vor Journalisten in New York.
Zuvor hatte Ni Aolain als erste UN-Sonderberichterstatterin das Gefangenenlager besucht, mit offizieller Genehmigung der USA. Sie bedankte sich bei den Vereinigten Staaten für die Erlaubnis und betonte, sie habe vollständigen Zugang bekommen. Sie habe auch "bedeutende Verbesserungen" im Vergleich zu früheren Zustandsberichten bekommen.
Dennoch zeichnet Ni Aolain kein gutes Bild von den Umständen in Guantánamo. Die Gefangenen hätten zahlreiche Misshandlungen ertragen und seien nur unzureichend medizinisch versorgt worden. Zudem hätten sie nicht ausreichend Kontakt zu ihren Familien gehabt, sei es durch Besuche oder Anrufe."Die Gesamtheit all dieser Praktiken und Unterlassungen […] kommt in meiner Untersuchung gemäß internationalen Rechts anhaltender grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung gleich", sagte die UN-Sonderberichterstatterin.
UN prangert Menschenrechtsverletzungen in Guantánamo an
Washington müsse sich immer noch mit den eklatantesten Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit den Gefangenen auseinandersetzen: Ihrer geheimen Ergreifung und dem Transfer nach Guantánamo Anfang der 2000er-Jahre und der oftmals massiven Folter durch US-Vertreter in den ersten Jahren nach den Anschlägen vom 11. September.
Priorität habe weiter die Schließung des Gefangenenlagers, das außerhalb der Zuständigkeit der US-Justiz liegt, betonte Ni Aolain.
Im Februar hatte das US-Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass mehr als zwei Jahrzehnte nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 noch 34 Häftlinge in dem Gefangenenlager auf Kuba untergebracht sind. Es war nach den Terroranschlägen während der Regierungszeit des damaligen republikanischen Präsidenten George W. Bush errichtet worden, um mutmaßliche islamistische Terroristen ohne Prozess festzuhalten.
In dem Lager, das sich im US-Marinestützpunkt Guantánamo Bay befindet, waren zeitweise fast 800 Menschen inhaftiert. Menschenrechtsorganisationen verlangen seit langem die Schließung – nach der Vorstellung des UN-Berichts bekräftigte Amnesty International diese Forderung. (afp/dpa/the)
Quelle: Ein US-Soldat läuft durch die Gänge des berüchtigten Gefangenenlagers Guantánamo Bay. Eine UN-Sonderberichterstatterin fordert die Schließung der Einrichtung. © imago/ZUMA Press
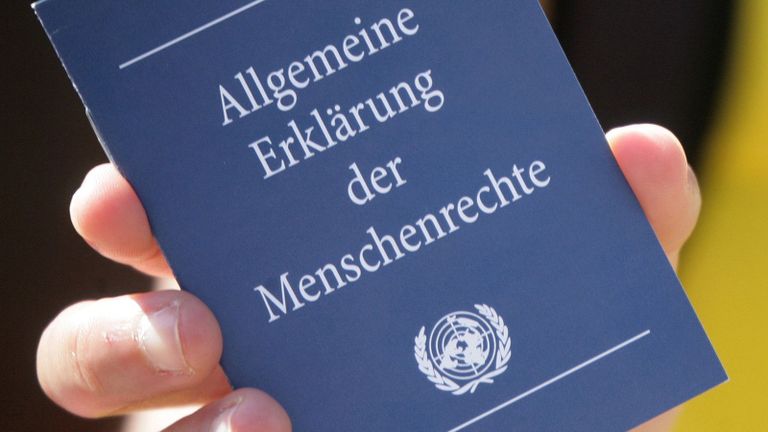
UN-Menschenrechtsrat
UN-Menschenrechtsrat verurteilt "illegale" Sanktionen
Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (VN) hat eine Resolution verabschiedet, in der der Einsatz einseitiger Zwangsmaßnahmen als Mittel zur Ausübung politischen und wirtschaftlichen Drucks, insbesondere auf die am wenigsten entwickelten Länder und Entwicklungsländer, verurteilt wird.
Die Resolution wurde von Aserbaidschan im Namen der Bewegung der blockfreien Staaten während der 52. Sitzung des Gremiums in Genf vorgestellt und enthält 35 Punkte, die den Einsatz einseitiger Zwangsmaßnahmen, auch Sanktionen genannt, und deren negative Auswirkungen auf die Wahrnehmung der Menschenrechte kritisieren.
Der Text der Resolution fordert alle Staaten ausdrücklich auf, "die Verabschiedung, Aufrechterhaltung, Durchführung oder Einhaltung einseitiger Zwangsmaßnahmen, die nicht im Einklang mit dem Völkerrecht, dem humanitären Völkerrecht und der Charta der Vereinten Nationen stehen, einzustellen".
Der Text der Resolution fordert alle Staaten ausdrücklich auf, "die Verabschiedung, Aufrechterhaltung, Durchführung oder Einhaltung einseitiger Zwangsmaßnahmen, die nicht im Einklang mit dem Völkerrecht, dem humanitären Völkerrecht und der Charta der Vereinten Nationen stehen, einzustellen".
Das Dokument fordert ferner die "Abschaffung" einseitiger Zwangsmaßnahmen und verurteilt deren Anwendung und Durchsetzung als "Druckmittel" durch "bestimmte Mächte", um die Souveränität der Staaten bei der Bestimmung ihrer politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systeme einzuschränken, insbesondere gegenüber den am wenigsten entwickelten Ländern und Entwicklungsländern.
Die Sprache spiegelt den zunehmenden Einsatz von Sanktionen durch die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten als Zwangsmittel gegen Staaten wider, die nicht mit den Interessen Washingtons übereinstimmen. Die Zunahme einseitiger Sanktionen wurde von Menschenrechtsexperten unter die Lupe genommen und ihre unverhältnismäßigen Auswirkungen auf Frauen, Kinder und andere gefährdete Gruppen hervorgehoben.
Ana Gabriela Salazar, Forschungskoordinatorin der venezolanischen Menschenrechtsorganisation SURES, sagte gegenüber Venezuelanalysis, dass die Abstimmung im Menschenrechtsrat die "Heuchelei" von Ländern wie den USA entlarvt, die behaupten, sich für die Menschenrechte in der Welt einzusetzen, und die "politische Instrumentalisierung der Menschenrechte" im Dienste des US-Imperialismus aufdeckt.
"Auf der einen Seite behaupten diese Länder, Verteidiger und Förderer der Menschenrechte auf globaler Ebene zu sein, und im Gegensatz dazu unterstützen sie die Verhängung dieser illegalen Maßnahmen gegen die Völker der Welt", sagte Salazar.
Seit 2017 haben die USA und ihre Verbündeten ein weitreichendes Sanktionsregime gegen Venezuela verhängt, das erstmals vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump umgesetzt und von seinem Nachfolger Joe Biden weitgehend beibehalten wurde. Nach den Finanzsanktionen gegen PDVSA im Jahr 2017 verhängte das US-Finanzministerium 2019 ein Ölembargo, das die Haupteinnahmequelle des Landes effektiv blockierte, was die wirtschaftliche Entwicklung des Landes stark eingeschränkt hat. Analysten schätzen die Verluste auf bis zu 30 Milliarden US-Dollar pro Jahr.
Salazar unterstützt die Behauptung, dass einseitige Zwangsmaßnahmen darauf abzielen, die "Unterordnung" eines Staates unter das Diktat eines anderen Staates zu erreichen, was ihrer Meinung nach "eindeutig gegen die Prinzipien der politischen Unabhängigkeit und der Nichteinmischung in Angelegenheiten verstößt, die im Wesentlichen in die innere Zuständigkeit von Staaten fallen".
Die venezolanische Regierung fordert seit langem von den USA die Aufhebung der Sanktionen, die sie für illegal hält, was Washington und seine Verbündeten standhaft abgelehnt haben. Der stellvertretende US-Außenminister für Angelegenheiten der westlichen Hemisphäre, Brian Nichols, erklärte kürzlich, dass Washington die gegen Venezuela verhängten Sanktionen nur dann aufheben werde, wenn es "Fortschritte" bei den Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition gebe.
Washington and Caracas appear to be at a stalemate, with Nicolás Maduro government conditioning talks with the hardline opposition on the release of US $3 billion in Venezuelan funds abroad, illegally seized by Washington and allies since 2019. The fund is part of the agreement signed by both the government and the opposition in México City.
The US has also ignored various calls from voices inside the UN, including from High Commissioner for Human Rights Volker Türk, to lift its Venezuela sanctions.
Salazar told Venezuelanalysis that SURES hopes last month's vote will “help make visible the impacts on peoples’ fundamental human rights, as well as the generalized use of unilateral coercive measures and related phenomena such as secondary sanctions and overcompliance.”
Overcompliance refers to instances whereby firms refuse to do business with a sanctioned country due to fear of running afoul of strict US sanctions despite not necessarily violating unilateral coercive measures.
SURES hat sich für die Verteidigung der Menschenrechte vor Ort in Venezuela eingesetzt und zuvor die Arbeit von UN-Gruppen kritisiert, die im Land nicht präsent sind. Im September stellte die Organisation einen Bericht der Unabhängigen Internationalen Untersuchungskommission über die Bolivarische Republik Venezuela in Frage, in dem sie behauptete, dass es den hochkarätigen Vorwürfen von Menschenrechtsverletzungen an Objektivität und Unparteilichkeit mangele.
Die Abstimmung im Menschenrechtsrat verlief weitgehend entlang geopolitischer Linien, was den ehemaligen ecuadorianischen Außenminister Guillame Long dazu veranlasste, als Reaktion auf das Abstimmungsergebnis zu twittern: "Globaler Norden vs. Globaler Süden".
Salazar argumentierte, dass die Abstimmung eine Tendenz zeige, das UN-System mit "zunehmender Häufigkeit" für politische Zwecke zu nutzen, sowie die "Politisierung bestimmter Agenden innerhalb des Menschenrechtsrates".
Sie fügte hinzu, dass sie hoffe, dass die Resolution des letzten Monats Venezuela auch helfen werde, in internationalen Foren zu argumentieren, dass die Verhängung von Sanktionen gegen das Land bei der allgemeinen regelmäßigen Überprüfung des UN-Menschenrechtsrats berücksichtigt werden müsse. Während der letzten Überprüfung Venezuelas forderte Vizepräsidentin Delcy Rodríguez die UN-Mitgliedstaaten ebenfalls auf, das Menschenrechtssystem nicht für politische Zwecke zu nutzen.
Quelle: progressiv international Mai2023

Menschenrechtsbericht
Aus: Ausgabe vom 02.05.2023, Seite 12 / Thema
MENSCHENRECHTSPOLITIK
Allenthalben Doppelmoral
Dokumentiert. Der aktuelle Bericht der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik lobt deren »Werteorientierung«. Bei näherem Hinsehen bleibt davon nicht viel
Von Norman Paech
Norman Paech ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft und Öffentliches Recht und saß zwischen 2005 und 2009 für die Partei Die Linke im Deutschen Bundestag. Er schrieb an dieser Stelle zuletzt am 13. Mai 2022 über das Völkerrecht angesichts des Krieges in der Ukraine.
Wir dokumentieren im Folgenden die Stellungnahme Norman Paechs, die dieser am 17. April 2023 in Reaktion auf den 15. Bericht der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des Deutschen Bundestags abgegeben hat. (jW)
Für die Bundesregierung stellen offensichtlich die Menschenrechte den obersten Wert in der Rangfolge ihrer Verpflichtungen in der Außenpolitik dar. Sie garantieren nicht nur den Schutz der Rechte des einzelnen, sondern sie sollen die Menschen auch zur Erkenntnis und Wahrnehmung ihrer Rechte befähigen, um ihre Grundbedürfnisse autonom und selbstbestimmt sichern zu können. Die feministische Pointierung dieser Politik zielt auf die bisher eher vernachlässigten Aufgaben der Nivellierung der Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern und die strukturelle Veränderung der Bedingungen für die Ungleichheit. Dieser neugeschaffene Schwerpunkt verändert aber nicht die grundsätzliche Aufgabe der Menschenrechte, die sozialen, ökonomischen, politischen und kulturellen Grundbedürfnisse aller Menschen herzustellen und zu garantieren.
Feministische Außenpolitik
1. Zu diesem neuen Bekenntnis der Bundesregierung heißt es in dem Menschenrechtsbericht: »Die Bundesregierung verfolgt eine feministische Außenpolitik mit dem Ziel, die Rechte, Ressourcen und Repräsentanz von Frauen und Mädchen weltweit zu stärken und gesellschaftliche Diversität zu fördern.« Soweit damit die Gleichstellung von Frauen und Mädchen weltweit, die Verurteilung sexueller Gewalt und Vergewaltigungen als Mittel des Krieges, der gleiche Zugang zu Arbeit, Ressourcen, Geld und sozialer wie politischer Teilhabe und die gleiche gesellschaftliche Repräsentanz von Frauen verfolgt wird, ist diese Politik vorbehaltlos zu begrüßen.
Im Bericht steht jedoch auch: »Die Bundesregierung unterstützt das Engagement der NATO, Geschlechtergleichheit zu fördern und Genderperspektiven in allen NATO-Aktivitäten in politischen, zivilen, und militärischen Strukturen, von Politik und Planung, über Training und Ausbildung, bis zu Missionen und Operationen zu integrieren.« Diese Aussage zeigt die problematische Seite der feministischen Außenpolitik, da Frauenrechte nicht unabhängig von den geforderten Tätigkeiten zum Beispiel in völkerrechtlich zweifelhaften NATO-Einsätzen (Jugoslawien, Afghanistan) gesehen werden können. Sodann dürfen Frauenrechte nicht als Vorwand für militärische (zum Beispiel: in der Ukraine Vergewaltigungen als Begründung für Panzerlieferungen) und völkerrechtlich problematische Sanktionen (zum Beispiel Iran) benutzt werden. Eine solche Praxis würde ein unübersehbar weites Feld von Interventionen in Staaten eröffnen, in denen die Stellung der Frauen nicht unseren Ordnungsvorstellungen entspricht. Angesichts der zunehmend in die Auseinandersetzung um eine neue Weltordnung von den USA eingebundenen NATO mit einem klaren imperialistischen Herrschaftsanspruch, in dem Frauenrechten allenfalls noch eine legitimatorische Funktion übrigbleibt, entspricht diese Inanspruchnahme von Frauenrechten durch den militärischen Einsatz nicht der Intention des menschenrechtlichen Schutzauftrags.
2. Es fällt dabei ferner auf, dass der Bericht eine vollkommen unkritische Stellung zu Sanktionen einnimmt. Sie werden im Bericht nur an einer Stelle erwähnt: »Die schärfste Reaktionsform stellen schließlich Sanktionen dar. Die EU hat im Berichtszeitraum unter der EU-Präsidentschaft ein Menschenrechtssanktionsregime verabschiedet und Personen und Entitäten unter dem Sanktionsregime gelistet, das schwere Menschenrechtsverletzungen sanktioniert. Die Bandbreite der Instrumente gibt der Menschenrechtspolitik Spielraum für ein der jeweiligen Sachlage angepasstes und möglichst effektives Vorgehen«. Mit keinem Wort wird der Bericht des Sonderbeauftragten des UN-Menschenrechtsrats, Idriss Jazairy, vom Mai 2019 erwähnt, der die einseitigen Sanktionen der USA gegen Venezuela, Kuba, und Iran als völkerrechtswidrig bezeichnet hat, da sie »humanitäre Katastrophen von beispiellosem Ausmaßen auslösen« könnten. Jazairy schlussfolgert: »Regime-Change durch Wirtschaftsmaßnahmen, die zur Beschneidung der grundlegenden Menschenrechte und zu Hungersnot führen können, ist nie eine akzeptierte Praxis in den internationalen Beziehungen gewesen.«¹ Der Bericht nimmt auch keine Kenntnis davon, dass die beiden Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs für das »Oil for Food Program« im Irak, Dennis Halliday und Hans-Christoph Graf Sponeck, ihre Arbeit vorzeitig aufgegeben haben, da sie schwerste menschenrechtliche Bedenken gegen die gegen den Irak verhängten Sanktionen hatten, die durch das OfF-Programm nicht kompensiert werden könnten. Dennis Halliday kommentierte seinerzeit seinen Abschied mit den Worten: »Ich wurde zum Rücktritt getrieben, weil ich mich weigerte, die Anordnungen des Sicherheitsrates zu befolgen, der gleiche Sicherheitsrat, der die völkermordverursachenden Sanktionen eingerichtet hat und diese aufrechterhält, die die Unschuldigen im Irak treffen. Ich wollte nicht zum Komplizen werden, ich wollte frei und öffentlich gegen dieses Verbrechen sprechen. Der wichtigste Grund ist, dass mein angeborenes Gerechtigkeitsempfinden verletzt war und ist angesichts der Gewalttätigkeit der Auswirkungen, die die UN-Sanktionen auf das Leben von Kindern und Familien hatten und haben. Es gibt keine Rechtfertigung für das Töten der jungen, der alten, der kranken, der armen Bevölkerung des Irak. Einige werden Ihnen sagen, dass es die Führung ist, die das irakische Volk bestraft. Das ist nicht meine Wahrnehmung oder Erfahrung, die ich vom Leben in Bagdad gemacht habe«.²
An dieser Stelle fehlt zudem ein Hinweis auf die seit über 60 Jahren gegen Kuba praktizierte völker- und menschenrechtswidrige Embargopolitik der USA. Das Ziel dieser Sanktionen, einen Regimewechsel herbeizuführen, macht sie für sich genommen schon völkerrechtswidrig. Die Folgen des Embargos, der spürbare Versorgungsmangel und die drastischen Einschnitte in den Lebensstandard der Bevölkerung – beides politisch gewollt – widerspricht allen von der deutschen Bundesregierung propagierten Geboten der Menschenrechte. Diese Politik ist ein weiterer Beweis dafür, dass Sanktionen bestimmt nicht die geeigneten Instrumente sind, »die der Menschenrechtspolitik Spielraum für ein der jeweiligen Sachlage angepasstes und möglichst effektives Vorgehen« gibt, wie es die Bundesregierung in dem Bericht behauptet. Die negativen Beispiele, die mit dem Völkerrecht kaum zu vereinbaren sind, ließen sich mit den Sanktionen gegen den Iran und Syrien ergänzen.
3. Der Bericht erwähnt – wenn auch nur am Rande und allgemein – die historische Verantwortung für die Vergangenheit und auch die Vergangenheit des deutschen Kolonialismus. Allerdings fällt auf, dass diese Erwähnung ohne einen Hinweis auf die Kolonialverbrechen in Afrika (Deutsch-Südwest und Deutsch-Südost sowie Kamerun), die Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg und den Holocaust geschieht. Gerade aus dieser deutschen Vergangenheit ergaben und ergeben sich immer noch eine bestimmte Verantwortung und Verpflichtung der Außenpolitik.
Kriegspolitik
4. Wichtiger als die innenpolitische Dimension der neuen Außenpolitik, die institutionelle Veränderungen im eigenen Ressort vorsieht, die vorbehaltlos zu begrüßen sind, sind solche Entscheidungen, die offensichtlich eine grundsätzliche außenpolitische Umorientierung in der Kriegs- und Friedenspolitik andeuten. So heißt es in den »Leitlinien des Auswärtigen Amtes für eine feministische Außenpolitik«, dass »feministische Außenpolitik nicht gleichbedeutend mit Pazifismus« sei. Gerade unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges zeige sich, »dass im Angesicht brutaler Gewalt Menschenleben auch mit militärischem Mittel geschützt werden müssen«. Selbst wenn es weiter heißt, dass feministische Außenpolitik zugleich der »humanitären Tradition verpflichtet (sei), aus der sich klassische Friedenspolitik und Rüstungskontrolle speise«, fragt sich, ob diese neue Friedenspolitik angesichts des klaren Bekenntnisses der Außenministerin zu einer »Unterstützung bis zum Sieg«, d. h. bis zur erfolgreichen Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete der Ukraine, mit dem Bekenntnis zu den Menschenrechten vereinbar ist. Denn mit dieser Politik der Gewalt als Ultima ratio wird der Wert der territorialen Souveränität über den Wert der Menschenleben und ihrer Sicherheit gestellt, die in unverhältnismäßigem Ausmaß geopfert werden müssen. Da es heute bei Politik und Militär weitgehend einhellige Meinung ist, dass keine der beiden Seiten, weder Russland noch die Ukraine, einen Sieg auf dem Schlachtfeld erringen kann, bedeutet die unbegrenzte Waffenlieferung an die ukrainische Armee die unbegrenzte Fortführung des Krieges und des Verlustes an Menschenleben.
Die Umkehrung der Devise »Territorium vor Menschen« in »Menschen vor Territorium« würde der menschenrechtlichen Verpflichtung einer Friedenspolitik in humanitärer Tradition mehr entsprechen, als die der alten Kriegslogik entsprechende Souveränitätspolitik. Die außerordentlich hohe Zahl von Toten und Verwundeten auf beiden Seiten verlangt nach einem umgehenden Ende der Kampfhandlungen. Die auch von der Bundesregierung zugesagten weiteren Waffen- und Munitionslieferungen werden in absehbarer Zeit die Rückeroberung der verlorenen Gebiete nicht ermöglichen, das wird auch von der NATO anerkannt. Sie werden jedoch den Krieg verlängern und die Opferzahlen in unverhältnismäßigem Ausmaß erhöhen. Erst unlängst forderte die Generalversammlung der Vereinten Nationen »nachdrücklich die sofortige friedliche Beilegung des Konflikts zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine durch politischen Dialog, Verhandlungen, Vermittlung und andere friedliche Mittel«.³ Wenn die USA nach neuesten Aussagen ihres Außenministers Blinken derzeit zu keiner Art Waffenstillstand oder Verhandlungen mit der russischen Seite bereit sind, so wäre es die Pflicht der deutschen Außenpolitik, entsprechend ihrer menschenrechtlichen Werteaußenpolitik auf die US-amerikanischen Kollegen einzuwirken, ihre Haltung zu ändern, statt ihr vorbehaltlos zu folgen.
5. In diesem Zusammenhang werfen auch die Rüstungsexporte und Waffenlieferungen der Bundesrepublik an Länder in Spannungsgebieten, oder in denen Krieg herrscht, Fragen nach der Vereinbarkeit mit einer an den Menschenrechten orientierten Außenpolitik auf. So heißt es in dem Bericht: »Bei Entscheidungen über die Ausfuhr von Rüstungsgütern spielt das Menschenrechtskriterium eine wichtige Rolle. (…) Die Beachtung der Menschenrechte im Empfängerland spielt bei der Entscheidung zu Rüstungsexporten eine hervorragende Rolle.« Zudem fordern die »Politischen Grundsätze für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern« der Bundesregierung, dass Lieferungen nicht in Länder genehmigt werden, »die in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt sind oder wo eine solche droht, in denen ein Ausbruch bewaffneter Auseinandersetzungen droht oder bestehende Spannungen und Konflikte durch den Export ausgelöst, aufrechterhalten oder verschärft würden«. Es ist aber bekannt, dass deutsche Waffen, die nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) geliefert wurden – selbst Staaten mit bekannten Menschenrechtsproblemen – im Krieg im Jemen eingesetzt werden.⁴ Die Bundesregierung behauptet zwar, dass sie davon keine Kenntnis habe, will aber dennoch weiterhin Waffen in die VAE liefern. Trotz der beschlossenen Exportbeschränkungen für Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien waren es 2022 so viele wie seit 2018 nicht mehr. Die Bundesregierung hat die Lieferung von Rüstungsgütern für 44,2 Millionen Euro genehmigt, in ein Land, in dem gerade die Frauenrechte im krassen Gegensatz zu den allgemeinen Menschenrechtsstandards stehen.
Nukleare Teilhabe
6. Das Festhalten an der sogenannten Nuklearen Teilhabe wirft ebenfalls erhebliche menschenrechtliche Probleme auf. Sie bildet die Grundlage für die Stationierung US-amerikanischer Atomraketen auf deutschem Boden und die Beteiligung der Bundeswehr im Fall eines eventuellen Einsatzes der Waffen. Bekanntlich ist jedoch der Einsatz von Atomwaffen und schon dessen Androhung sowohl nach humanitärem Völkerrecht als auch nach dem internationalen Menschenrecht auf Leben (Art. 6 UN-Zivilpakt) verboten. Dies haben sowohl das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 8. Juli 1996 als auch der Comment Nr. 36 des UN-Menschenrechtsausschusses vom 30. Oktober 2018⁵ unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, hat aber bei der Bundesregierung bisher kein Umdenken gebracht.
7. Besonders kritikwürdig ist jedoch die Haltung der Bundesregierung gegenüber Staaten, die sich ganz offen schwerer Völkerrechtsverstöße schuldig machen. Seit 2016 interveniert die Türkei militärisch ohne völkerrechtliches Mandat des UN-Sicherheitsrats und ohne sich auf das Selbstverteidigungsrecht gemäß Art. 51 UN-Charta berufen zu können im Norden Syriens (Operation »Schutzschild Euphrat«). Seit 2018 hält sie nach ihrer Militäroffensive (Operation »Olivenzweig«) die syrische Provinz Afrin besetzt, vertreibt dort die kurdische Bevölkerung und siedelt arabische Menschen, die vor dem Krieg in Syrien in die Türkei geflohen waren, völkerrechtswidrig in Afrin an. Diese bis heute andauernden militärischen Übergriffe der Türkei auf ihren Nachbarn Syrien stellen nicht nur einen schweren Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar, sondern sind auch von gravierenden Verletzungen der Menschenrechte begleitet. Die Bundesregierung ruft die türkische Regierung zur Zurückhaltung und Verhältnismäßigkeit ihrer Maßnahmen auf, liefert jedoch weiterhin Waffen in die Türkei und setzt ihre normalen diplomatischen und Handelsbeziehungen fort.
8. Ebenso ungestört und unberührt von der Jahrzehnte andauernden völkerrechtswidrigen Besatzungspolitik in Palästina verlaufen die diplomatischen, wirtschaftlichen und militärischen Beziehungen mit Israel. Die schon seit 2007 dem UN-Menschenrechtsausschuss vorliegenden Berichte über schwere Menschenrechtsverbrechen einschließlich des Verbrechens der Apartheid in den besetzten Gebieten⁶ sind in den letzten Jahren durch umfangreiche Berichte von Human Rights Watch, Amnesty International und B’Tselem bestätigt und um erschreckende Beispiele ergänzt worden. 2009 erklärte der erste Sonderberichterstatter des Menschenrechtsrats, John Dugard, als er auf Druck Israels und der USA von seinem Posten abgelöst wurde: »Ich bin Südafrikaner, der in der Apartheid gelebt hat. Ich zögere nicht zu sagen, dass Israels Verbrechen unendlich viel schlimmer sind als die Verbrechen, die Südafrika mit seinem Apartheidregime begangen hat.«⁷ Die Bundesregierung hat auch nach diesen unbestreitbaren und erschütternden Dokumenten nichts unternommen, um die israelische Regierung zum Rückzug aus den besetzten Gebieten und Beendigung ihrer Apartheidpolitik zu bewegen. Ihre finanziellen Leistungen an die palästinensischen Institutionen in Ramallah und Gaza vermögen ihre Untätigkeit und offensichtliche Gleichgültigkeit gegenüber diesem nun schon Jahrzehnte dauernden menschenrechtlich inakzeptablen Zustand nicht zu kompensieren. Auch eine Berufung auf die Schuld der eigenen Geschichte vermag nicht die Unterstützung einer derart langen zutiefst menschenrechtswidrigen Politik zu exkulpieren.
Ökonomische Interessen
9. Diese widersprüchliche Politik der Doppelmoral zeigt sich jetzt auch in der veränderten Haltung der Bundesregierung zur Westsahara-Frage. Während die vorherige Koalition unter Bundeskanzlerin Merkel die Besatzung der Westsahara durch Marokko nicht anerkannte und stets auf die UN-Resolutionen verwiesen hatte, um eine »gerechte, praktikable, dauerhafte und für alle Seiten akzeptable Lösung des Konflikts« unter »Achtung des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte« zu erreichen, ist Außenministerin Baerbock von dieser Position abgerückt, und bezieht sich auf den von der UNO abgelehnten Autonomieplan des marokkanischen Königshauses. Dieser Plan zielt darauf ab, die Besatzung zu legalisieren und die Westsahara als einen Teil Marokkos auszuweisen. Dass dabei eindeutig ökonomische Interessen infolge der neuen Energiepolitik und der Wunsch, von Marokko in der Zukunft günstig Energie beziehen zu können, im Vordergrund stehen, wird auch nicht bestritten. Währenddessen weisen Internationale Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch darauf hin, dass die marokkanischen Behörden in der Westsahara weiterhin Aktivisten verfolgen, die sich für die Selbstbestimmung der Sahraoui einsetzen. Die Organisation beklagt auch, dass »Folter« und ungerechte Verfahren mit langen Haftstrafen auf Basis von »gefälschten Geständnissen« zu den Methoden der Besatzung gehören.⁸ (…)
10. Der Bericht legt berechtigten Wert auf die Bedeutung rechtsstaatlicher Institutionen für die Ausübung und den Schutz der Menschenrechte. Dafür sind ein funktionierendes Justizsystem und die Bekämpfung der Straflosigkeit zentrale Voraussetzungen. Im Bericht heißt es: »Ein Fokus der Bundesregierung liegt dabei auch auf der Bekämpfung der Straflosigkeit für Völkerrechtsverbrechen, wie etwa Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschheit oder Völkermord. Sie setzt sich sowohl für die internationale gerichtliche Aufarbeitung dieser Verbrechen ein. Das beinhaltet auch eine Stärkung der internationalen Gerichtsbarkeit sowie den Einsatz für die Umsetzung ihrer Urteile. Wenn solche Verbrechen konsequent geahndet werden, wird die Schwelle für potentielle Täter höher«.
Dieser Ansatz verdient vorbehaltlose Zustimmung. Wenn derzeit geplant ist, ein Sondertribunal für die Anklage gegen den russischen Präsidenten Putin wegen des Verbrechens der Aggression (Art. 8 bis Römisches Statut) zu errichten, so wäre das aber nur dann im Sinn der Menschenrechtskonzeption der Bundesregierung uneingeschränkt zu begrüßen, wenn das Tribunal gleichzeitig für entsprechende Tatvorwürfe gegenüber den Regierungschefs der USA, Großbritanniens, Israels oder der Bundesrepublik wegen der Kriege gegen Jugoslawien, Irak oder Gaza zuständig wäre. Denn alle diese möglichen Kriegsverbrechen unterliegen keiner Verjährung (Art. 29 Römisches Statut). Da eine Erweiterung des Tribunals aber offensichtlich nicht geplant ist, fehlt ihm die notwendige politische Legitimation. Es kann zudem nicht zur geforderten Stärkung der internationalen Strafgerichtsbarkeit durch den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag beitragen. Im Gegenteil, es schwächt durch die Einrichtung einer Paralleljustiz die Rechtsprechungskompetenz des IStGH, wie es auch sein Chefankläger Karim Kahn beklagt hat. Der IStGH kann keine Ermittlungen ausführen, die sich auf das Verbrechen der Aggression (Angriffskrieg) gem. Art. 8 bis Römisches Statut erstrecken. Denn nach Art. 15 bis Abs. 5 Römisches Statut kann der IStGH keine Strafverfolgungsmaßnahmen einleiten, wenn der Staat, durch dessen Angehörige oder auf dessen Territorium die Verbrechen begangen wurden, nicht Vertragspartei des Statuts ist. Da weder die Ukraine noch Russland dem Statut beigetreten sind, könnte nur der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit einem Beschluss nach Art. 42 UN-Charta den Strafgerichtshof beauftragen. Das wird auf jeden Fall am Veto Russlands scheitern.
Darüber hinaus ist auf folgende Besonderheit hinzuweisen. Der Internationale Strafgerichtshof war im Jahr 2000 gerade mit der Intention gegründet worden, dem Internationalen Strafrecht eine allgemeine und international unbegrenzte Gültigkeit und Wirksamkeit zu verschaffen und damit die nur begrenzt tätig werdenden Sondertribunale für die Zukunft zu ersetzen. Es waren aber gerade die Staaten, die heute ein Sondertribunal fordern, die 2010 in Kampala den Ermittlungsrahmen für das Verbrechen der Aggression durch Art. 15 bis Abs. 5 Römisches Statut selbst für Vertragsstaaten so eingegrenzt haben, dass ihre Staatsspitzen von jeglicher strafrechtlichen Verantwortung ausgenommen werden. Anstatt die Begrenzung auf Vertragsstaaten und solche Staaten, die auch den »Kampala-Zusatz« ratifiziert haben, aufzuheben und dem Römischen Statut ohne Einschränkung und Vorbehalt Geltung zu verschaffen, baut man sich ein Tribunal »à la carte«, das man nach Erfüllung seines politischen Zieles wieder auflöst.
Die einzige überzeugende Lösung wäre der Beitritt aller Staaten zum Römischen Statut ohne Einschränkungen und Immunitätsvorbehalte, für den sich die Bundesregierung einsetzen müsste. Doch von diesen Überlegungen ist im Bericht der Bundesregierung nichts zu finden.
Wertlose »Werte«
11. Zum Schluss fällt auf, dass von den 32 aufgeführten Ländern, in denen die Bundesregierung Menschenrechtsprobleme identifiziert, 30 in Afrika und Asien liegen sowie zwei Staaten, Kuba und Venezuela, in dem vornehmlich christlichen Mittel- und Lateinamerika. Demgegenüber wurde kein Staat in Europa und wurden auch nicht die USA mit ihrer kubanischen Enklave Guantanamo der »Auswahl von Staaten mit kritischer Menschenrechtslage« für wert befunden. Es drängt sich hier doch die Frage auf, ob in dieser Teilung nicht die alte koloniale Weltsicht fortwirkt.
Die kurze Analyse hat gezeigt, dass es zwischen dem in der Öffentlichkeit vertretenen Menschenrechtsanspruch und der praktischen Politik eine große Kluft besteht. Die offensichtliche Diskrepanz zwischen der wortreichen Preisung einer »werteorientierten« Außenpolitik und der tatsächlich interessengeleiteten Praxis legt es nahe, auf den unscharfen und beliebigen Begriff der »Werte« zu verzichten, und die Außenpolitik strikt an dem einzigen weltweit akzeptierten Wert, dem Völkerrecht, wie es in der UNO-Charta und den internationalen Verträgen kodifiziert ist, auszurichten.
Anmerkungen:
1 https://kurzelinks.de/jazairy
2 https://gandhifoundation.wordpress.com/2003/01/30/2003-peace-award-denis-halliday-2/
3 UNGV v. 18. 3. 2023, A/Res/ES-11/1.
4 Vgl. DW-Recherche, Saudische Koalition setzt deutsche Waffen im Jemen ein, 26.2.2019
5 https://kurzelinks.de/comment36
6 Vgl. Norman Paech: Menschenrechte. Geschichte und Gegenwart, Köln 2019, S. 145–159
7 Vgl. Dugard, John: International Law and the Occupied Palestinian Territories. In: European Journal of International Law 24 (2013), No. 3, S. 867–913
8 https://kurzelinks.de/Western-Sahara
Quelle: junge welt v.02.05.2023/ Umit Bektas/REUTERS
Angesichts der handfesten und sehr konkreten außenpolitischen Interessen der Bundesrepublik erweist sich die Parole von der feministischen Außenpolitik als nachgerade zynisch. Außenministerin Annalena Baerbock mit ihrem türkischen Amtskollegen Mevlut Cavusoglu (Istanbul, 29.7.2022)
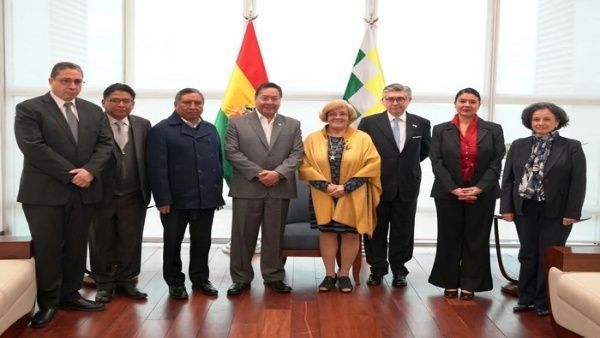
01.04.
2023
Info über Bolivien
Bolivien erhält Auftrag von regionaler Menschenrechtsorganisation
Das Team aus fünf Kommissaren und 20 weiteren Vertretern der IACHR beendete die Mission am Freitag mit Besuchen in den Departements La Paz, Sucre, Cochabamba und Santa Cruz.
Der Präsident Boliviens, Luis Arce, empfing am Freitag in der Casa Grande del Pueblo eine Mission der Interamerikanischen Menschenrechtskommission (IACHR), in der er das "festeste und unerschütterlichste Engagement für die Erfüllung und Garantie der Menschenrechte" seiner Regierung in dieser Angelegenheit bekräftigte.
Das Team von fünf Kommissaren und 20 weiteren Vertretern der IACHR schloss am Freitag die Mission ab, die am Montag mit Besuchen in den Departements La Paz, Sucre, Cochabamba und Santa Cruz begann, um die Menschenrechtslage in dem Andenstaat "vor Ort" zu beobachten.
Lokalen Medien zufolge lag der Schwerpunkt bei den Treffen und Besichtigungen auf demokratischen Institutionen, dem Zugang zur Justiz und rechtlichen Garantien. Zugang zu wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und ökologischen Rechten und Diskriminierung von Bevölkerungsgruppen, die sich in historischen Situationen der Verwundbarkeit befinden.
Er identifizierte jedoch auch "große strukturelle Herausforderungen, die heute im Land bestehen, sowie das Wiederaufleben besorgniserregender Situationen in Bezug auf Partisanengewalt, die das Ergebnis einer extremen politischen Polarisierung sind, die zu einem Bruch in der Gesellschaft geführt hat und dringend überwunden werden muss".
Die IACHR-Mission bewertete die Anerkennung der Rechte indigener Völker, den Kampf gegen Diskriminierung und Rassismus sowie die Ergebnisse der Sozial- und Wirtschaftspolitik, wie z.B. eine niedrige und kontrollierte Inflation, in einem ungünstigen Kontext.
Als Höhepunkt des Besuchs rief die Mission die politischen und sozialen Führer Boliviens dazu auf, zusammenzuarbeiten, um diese Situation umzukehren.
Quelle: teleSUR v.01.04.2023




Info über Peru
Abgeschrieben
Junge Welt v. 31.03.2023
Sevim Dagdelen, Obfrau der Fraktion von Die Linke im Auswärtigen Ausschuss und Sprecherin für Internationale Politik und Abrüstung, erklärte am Donnerstag zur Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage ihrerseits:
Es ist skandalös, dass die Bundesregierung sich feige wegduckt und keinen Exportstopp von Dual-Use- und Rüstungsgütern nach Peru plant ungeachtet der massiven Menschenrechtsverletzungen bei der Niederschlagung der Proteste gegen die »Übergangsregierung« von Dina Boluarte. Medienberichten zufolge sind seit dem 7. Dezember 2022 in Peru deutsche Waffen von Heckler & Koch zum Einsatz gekommen und mindestens 60 Menschen von Sicherheitskräften getötet worden – laut Amnesty International durch Schüsse in die Brust, den Oberkörper oder den Kopf.
Wenn bei der »Entscheidungsfindung« bei der Genehmigung von Rüstungsexporten laut Ampel-Regierung die »Beachtung der Menschenrechte im Empfängerland eine hervorgehobene Rolle« spielen, ist im Fall Perus ein sofortiger Exportstopp sowohl bei Genehmigungen als auch bei der tatsächlichen Ausfuhr für Güter, die zur internen Repression und Überwachung oder zu sonstigen fortdauernden und systematischen Menschenrechtsverletzungen verwendet werden können, darunter Güter gemäß Anhang III der Anti-Folter-Verordnung wie Wasserwerfer, Reizgas, Pfefferspray, Tränengasgranaten, Elektroschocktechnologien und Fußfesseln, zwingend.

Info über Nicaragua
Abgeschrieben
Junge Welt v. 31.03.2023
Sevim Dagdelen, Obfrau der Fraktion von Die Linke im Auswärtigen Ausschuss und Sprecherin für Internationale Politik und Abrüstung, erklärte am Donnerstag zur Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage ihrerseits:
Es ist skandalös, dass die Bundesregierung sich feige wegduckt und keinen Exportstopp von Dual-Use- und Rüstungsgütern nach Peru plant ungeachtet der massiven Menschenrechtsverletzungen bei der Niederschlagung der Proteste gegen die »Übergangsregierung« von Dina Boluarte. Medienberichten zufolge sind seit dem 7. Dezember 2022 in Peru deutsche Waffen von Heckler & Koch zum Einsatz gekommen und mindestens 60 Menschen von Sicherheitskräften getötet worden – laut Amnesty International durch Schüsse in die Brust, den Oberkörper oder den Kopf.
Wenn bei der »Entscheidungsfindung« bei der Genehmigung von Rüstungsexporten laut Ampel-Regierung die »Beachtung der Menschenrechte im Empfängerland eine hervorgehobene Rolle« spielen, ist im Fall Perus ein sofortiger Exportstopp sowohl bei Genehmigungen als auch bei der tatsächlichen Ausfuhr für Güter, die zur internen Repression und Überwachung oder zu sonstigen fortdauernden und systematischen Menschenrechtsverletzungen verwendet werden können, darunter Güter gemäß Anhang III der Anti-Folter-Verordnung wie Wasserwerfer, Reizgas, Pfefferspray, Tränengasgranaten, Elektroschocktechnologien und Fußfesseln, zwingend.

Info über Kolumbien
Kolumbianischer Staat verantwortlich für die "Ausrottung" der politischen Partei UP
Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte hat festgestellt, dass der kolumbianische Staat an einer intensiven Gewaltkampagne beteiligt war, bei der in den 1980er und 90er Jahren Tausende von Mitgliedern der linken Partei Patriotische Union (UP) getötet wurden
Mehr als zwei Jahrzehnte lang beteiligte sich der kolumbianische Staat an intensiven Menschenrechtsverletzungen gegen die linke Partei Patriotische Union (UP) in einer Kampagne der "Vernichtung", wie ein wegweisendes Urteil des Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte erklärt hat. Ab 1984 wurden mehr als 6.000 UP-Aktivisten, Mitglieder und Unterstützer ins Visier genommen. Das Urteil bekräftigt die Rolle des Staates bei Gräueltaten gegen die Zivilgesellschaft während des bewaffneten Konflikts.
Die UP wurde 1985 im Rahmen eines Friedensabkommens zwischen der damaligen Regierung von Belisario Betancur und den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (FARC) gegründet. Es brachte ehemalige Guerillas und andere linke Gruppen zusammen, die politische Veränderungen mit Wahlmitteln anstrebten, eine große Abkehr vom bewaffneten Kampf, den die FARC zuvor geführt hatte.
Nachdem die UP jedoch auf regionaler und lokaler Ebene Wahlgewinne erzielt hatte, arbeiteten staatliche Kräfte mit Paramilitärs, Politikern und Wirtschaftsgruppen zusammen, um brutale Gewalt gegen die Partei auszuüben, in einer Kampagne, die in Kolumbien gemeinhin als "politischer Völkermord" bezeichnet wird. Das Ziel war einfach: zu verhindern, dass die UP zu einer glaubwürdigen Alternative zu seit langem etablierten Machtstrukturen wird und, wie das Urteil feststellt, "dem Aufstieg der UP in der politischen Arena entgegenzuwirken".
Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte ist ein autonomes Tribunal, das mit der Durchführung von Ermittlungen zu Menschenrechtsverletzungen in ganz Amerika beauftragt ist. Einige dieser Untersuchungen können nicht ohne weiteres in den Ländern durchgeführt werden, in denen sie angeblich stattgefunden haben.
Das Urteil besagt, dass zu den "systematischen Gewalttaten", unter denen die Opfer leiden und die landesweit verübt werden, das Verschwindenlassen, Massaker, außergerichtliche Hinrichtungen und Morde, Drohungen, körperliche Angriffe, Stigmatisierung, rechtliche Verfolgungen, Folter, Vertreibung und andere gehören. Dies wurde durch Untersuchungen erleichtert, die, wenn sie überhaupt durchgeführt wurden, beklagenswert ineffektiv waren und durch "ein hohes Maß an Straflosigkeit gekennzeichnet waren, das als Formen der Toleranz seitens der Behörden wirkte". In Übereinstimmung mit der aktiven Absprache der Behörden bei der Gewalt ermöglichte das Fehlen von Konsequenzen, dass die Morde und andere Misshandlungen ungehindert fortgesetzt werden konnten.
Darüber hinaus befand das Gericht den Staat für die Verletzung der Rechte der Opfer auf Meinungs- und Vereinigungsfreiheit verantwortlich. Dies äußerte sich in der anhaltenden Stigmatisierung einer Partei, die als "innerer Feind" dargestellt wurde, ein Diskurs, der die Verfolgung der UP legitimierte. Hochrangige Staatsbeamte waren am prominentesten bei der Förderung des Klimas der Aggression durch den politischen Diskurs, der, in den Worten des Gerichts, dazu führte, dass "die Situation der Verwundbarkeit ... und ein Motiv zu erzeugen, um Angriffe gegen sie zu fördern." Dies beeinträchtigte nicht nur ihre körperliche Sicherheit, sondern hatte auch schwerwiegende psychologische Auswirkungen auf viele UP-Mitglieder und -Unterstützer.
Die Rechte der Opfer werden bis heute verletzt, da der Staat es versäumt hat, die Gewalt ordnungsgemäß zu untersuchen, die Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen oder das Recht der Opfer auf Wahrheit zu wahren.
In seinem Urteil erließ der Gerichtshof mehrere Formen staatlicher Wiedergutmachung:
- Gewährleistung strenger Untersuchungen und Schlussfolgerungen, die nicht länger als zwei Jahre dauern dürfen, um die Wahrheit über die Geschehnisse zu ermitteln, die Strafmaßnahmen festzulegen, mit denen die Täter konfrontiert werden sollten, und ein Ende der Straflosigkeit zu gewährleisten.
- Finden Sie die Überreste von Opfern des Verschwindenlassens, deren Aufenthaltsort noch unbekannt ist
- Medizinische, psychologische oder psychiatrische Behandlung der Opfer
- Verbreitung und Förderung des Urteils des Gerichtshofs
- Organisation eines öffentlichen Aktes der Anerkennung der Verantwortung des Staates
- Schaffung eines nationalen Gedenktages für Opfer und Durchführung von Aktivitäten, um das Bewusstsein dafür zu schärfen, auch in Schulen und Hochschulen
- Errichten Sie ein Denkmal für das Gedenken an die Opfer und ihr Vermächtnis
- Anbringen von Gedenktafeln an mindestens fünf öffentlichen Plätzen zum Gedenken an die Opfer
- Produktion und Veröffentlichung eines Dokumentarfilms über die Kampagne gegen die UP
- Starten Sie eine öffentliche Kampagne, um die Öffentlichkeit für die Gewalt, Verfolgung und Stigmatisierung der UP zu sensibilisieren
- Organisation akademischer Foren an mindestens fünf Universitäten im ganzen Land
- Erstellung eines Berichts in Zusammenarbeit mit der UP, der sich mit Möglichkeiten zur Verbesserung und Stärkung der Sicherheit für Parteimitglieder befasst
- Zahlung einer Entschädigung gemäß dem Urteil des Gerichtshofs
Dies ist nicht das erste Gerichtsurteil zu Gewalt gegen die UP. Im März letzten Jahres enthüllte die Sondergerichtsbarkeit für den Frieden (JEP), das im Friedensabkommen von 2016 geschaffene Übergangsgericht, dass 5.733 UP-Mitglieder von 1984 bis 2018 ermordet wurden oder verschwunden sind. Insgesamt dokumentierte das GEP fast 8.300 Personen, die wegen ihrer Zugehörigkeit zur UP ins Visier genommen worden waren. Der Verrat des Staates am Friedensabkommen von 1985 führte in den 1990er und 2000er Jahren zur Eskalation des bewaffneten Konflikts auf seinen Höhepunkt. Der Staat und seine paramilitärischen Stellvertreter griffen routinemäßig Gewerkschafter, Bauern, Studenten, indigene und afrikanisch-kolumbianische Gemeinschaften und andere an, die fälschlicherweise als "Subversive" bezeichnet wurden. Als Reaktion darauf kehrten viele ehemalige Kämpfer, die die FARC in Richtung UP verlassen hatten, in die Reihen der Guerilla zurück.
Im Januar 2021 berichtete der Journalist Alberto Donadio, dass der kolumbianische Präsident Virgilio Barco Vargas, der Belisario Betancur im Jahr nach der Gründung der UP nachfolgte, die Vernichtungskampagne gegen die Partei genehmigte. Die Architekten der Kampagne konnten sie als Erfolg betrachten, da die UP so geschwächt war, dass ihr 2002 ihr Status als politische Partei entzogen wurde. Dies wurde 2013 umgekehrt, als die UP in den Wahlkreis zurückkehrte. Heute ist die UP unter der Leitung von Senatorin Aida Avella, die 1996 nach einem Attentat ins Exil gezwungen wurde, Mitglied der Koalition des Historischen Pakts von Präsident Gustavo Petro, die letztes Jahr als erste linke Regierung in der kolumbianischen Geschichte gewählt wurde.
Nick MacWilliam ist Mitherausgeber von Alborada.
Quelle: Progressiv international; März 2023

Info über Brasilien
Justiz soll möglichen Genozid an Yanomami untersuchen
(31. Januar 2023, La Diaria) Luís Roberto Barroso, Richter am Obersten Bundesgericht Brasiliens, hat die Generalstaatsanwaltschaft des Landes angewiesen, zu untersuchen, ob Staatsorgane während der Regierung des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro einen Völkermord an der indigenen Gemeinschaft der Yanomami begangen haben. Da das Ermittlungsverfahren noch läuft, wurden bisher keine Namen von verdächtigten Personen bekannt gegeben.
Die Untersuchung soll ebenso feststellen, ob in diesem Zusammenhang auch Gerichtsurteile missachtet, Geheimnisse verletzt und Umweltverbrechen begangen wurden. Laut Barroso könnte ein Urteil des Obersten Bundesgerichts missachtet worden sein. In diesem war die Regierung verpflichtet worden, dafür zu sorgen, dass etwa 20.000 illegale Bergleute das Schutzgebiet der Yanomami verlassen. Damit sollte verhindert werden, dass Bergleute die dort lebende Bevölkerung mit Covid-19 infizieren, berichtet die spanische Nachrichtenagentur Efe. Darüber hinaus besteht der Verdacht, dass die Weitergabe von Informationen über geplante Maßnahmen gegen den illegalen Bergbau ermöglicht hätte, dass Bergleute die Kontrollen umgehen konnten.
Grundlage für die Entscheidung des Richters waren Informationen, die dem Gericht von der brasilianischen Regierung und der indigenen Organisation Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) vorgelegt wurden. Wie in den letzten Tagen berichtet, leiden tausende Yanomami an Unterernährung, Wasserverschmutzung und verschiedenen Krankheiten, die in den letzten vier Jahren den Tod von 570 Kindern verursacht haben. Die Krise veranlasste die Regierung, für das etwa zehn Millionen Hektar große Gebiet der Yanomami einen „Gesundheitsnotstand“ auszurufen. Etwa 27.000 Menschen leben hier.
Das Magazin Carta Capital berichtet, dass Barroso der Regierung von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva eine Frist von 30 Tagen eingeräumt hat, um eine Bewertung der Lage in dem indigenen Gebiet sowie eine Strategie und einen Zeitplan für die Bekämpfung des illegalen Bergbaus vorzulegen. Dieser, insbesondere der Goldbergbau, ist für die Quecksilberverschmutzung der Flüsse in der Region verantwortlich. Für Barroso zeigen die vorgelegten Daten ein „sehr ernstes und besorgniserregendes Bild, das darauf hindeutet, dass hier Gesetze missachtet und zahlreiche illegale Handlungen begangen wurden.“
Verteidigungsminister José Mucio kündigte einen Besuch mit Befehlshabern der Streitkräfte im Bundesstaat Roraima an, um Einsatzkräfte zu unterstützen, die von der Regierung mit der Bekämpfung des illegalen Bergbaus beauftragt worden waren. Er fügte hinzu, dass verschiedene Einheiten spezielle Aufgaben übernehmen werden: Die Armee wird Kriminelle identifizieren, die Marine wird die Flüsse kontrollieren und die Luftwaffe wird den Luftraum überwachen. „Wir brauchen ein gemeinsames Vorgehen aller Institutionen, damit wir das Problem lösen können. Es ist eine Tragödie. Bevor wir [die Verantwortlichen] finden, müssen wir diese Bevölkerung retten“, sagte Barroso dem brasilianischen Fernsehsender BandNews TV. Ende Januar beschlagnahmten Militär und Polizei 24 Flugzeuge von Goldsuchern. Laut Efe sagte die Polizei, dass weitere Flugzeuge während der Operationen zerstört wurden.
Quelle: Nachrichtenpool Lateinamerika; Ausgabe Februar 2023/Das Militär hat in Roraima ein medizinisches Versorgungszentrum für die Bewohner:innen der Region errichtet. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil via Fotos Públicas.

Verstoß gegen die Menschenrechte
El Salvadors Umweltführer forderten Freiheit
Menschenrechtsorganisationen sagen, dass eines der wahren Ziele der Verhaftungen darin besteht, "den Widerstand der Gemeinschaft zu schwächen".
Verschiedene Menschenrechtsorganisationen und salvadorianische soziale Bewegungen forderten am Donnerstag die sofortige Freilassung von Gemeindeführern aus Santa Marta im Norden des Landes und Vertretern der Association of Social Economic Development (ADES), die von einem örtlichen Gericht wegen angeblicher Verbrechen von vor 40 Jahren ins Gefängnis geschickt worden waren. In einer Erklärung, die gestern veröffentlicht wurde und deren wesentliche Elemente auf einer Pressekonferenz am Donnerstag aufgegriffen wurden, forderten die Organisationen das Gericht erster Instanz von Sensuntepeque (Norden des Landes) auf, "die vorläufige Inhaftierung rückgängig zu machen und das Gerichtsverfahren mit den Inhaftierten in Freiheit fortzusetzen, wie von ihrem Verteidiger gefordert".
In diesem Sinne argumentierten sie, dass keine Fluchtgefahr bestehe, da Gemeindeleiter und Umweltschützer "total in der Gemeinschaft verwurzelt sind und wichtige soziale Arbeit leisten", so dass sie diesen Ansatz der Staatsanwaltschaft als "unbegründet" bezeichneten. Ebenso wiesen sie darauf hin, dass das fortgeschrittene Alter einiger Häftlinge und das Leiden an chronischen Krankheiten "die Inhaftierung zu einer Bedrohung für ihr Leben macht", da sie unter anderem Gesundheitskontrollen und Medikamente behindert.
Gleichzeitig betonten sie, die Inhaftierung sei eine "Willkür und Ungerechtigkeit" sowie "diskriminierend und stellt einen eklatanten Verstoß gegen das Gleichheitsprinzip dar, denn in allen anderen Gerichtsverfahren zu während des Krieges begangenen Verbrechen werden die Angeklagten in Freiheit verfolgt".
Dementsprechend bekräftigten sie, dass die wahren Ziele der Verhaftungen darin bestehen, "den Widerstand der Gemeinschaft zu schwächen, um gesetzlich verbotene Bergbauprojekte zu reaktivieren, in der Auflösung des Friedensabkommens gipfeln und die Verfolgung sozialer Organisationen zu vertiefen".
Zu den Unterzeichnern der Beschwerde gehören die Zentralamerikanische Allianz gegen Bergbau, die Allianz gegen die Privatisierung des Wassers, die Feministische Versammlung, der Block des Widerstands und der Volksrebellion, das Nationale Gesundheitsforum, die Antifaschistische Jugend, der Tisch für Ernährungssouveränität und die Bürgersicherheitsplattform.
Die Klage kam, nachdem das Gericht erster Instanz von Sensuntepeque am Mittwoch den Antrag abgelehnt hatte, die vorläufige Inhaftierung der Führer von Santa Marta und ADES rückgängig zu machen, was Proteste vor dem Gericht auslöste, um weiterhin Gerechtigkeit zu fordern.
Quelle: teleSUR v.09.02.2023

Verstoß gegen Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 31.01.2023, Seite 6 / Ausland
MENSCHENRECHTE USA UND EU
Verstoß gegen Menschenrechte
UNO kritisiert Sanktionen der EU und USA gegen Venezuela
Von Volker Hermsdorf
Die von den USA und der EU gegen Venezuela verhängten Sanktionen verstoßen nach Einschätzung der UNO gegen die Menschenrechte. Das bestätigte der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Volker Türk, am Sonnabend bei einer Pressekonferenz auf dem Internationalen Flughafen in Caracas. Zum Abschluss eines dreitägigen Besuchs des südamerikanischen Landes forderte Türk, »alle Maßnahmen aufzuheben, die sich nachteilig auf Venezuela und dessen Bevölkerung« auswirken.
Es sei für ihn offensichtlich, »dass die seit 2017 gegen Venezuela verhängten sektoralen Sanktionen die Wirtschaftskrise verschärft und die Menschenrechte beeinträchtigt haben«, fasste der aus Österreich stammende Jurist seine Eindrücke zusammen. Die Vorwürfe gegen die USA und die EU erhob der UN-Vertreter, nachdem er sich über die Folgen der einseitigen Strafmaßnahmen für die venezolanische Bevölkerung informiert hatte. Er sei in den vergangenen zwei Tagen mit mehr als 125 Mitgliedern der Zivilgesellschaft, mit Menschenrechtsverteidigern, Vertretern der Kirche, Oppositionspolitikern und hochrangigen Regierungsmitgliedern zusammengetroffen, sagte Türk vor seiner Abreise.
Neben der Kritik an den westlichen Sanktionen bot der Menschenrechtsbeauftragte die Unterstützung der Vereinten Nationen beim Dialog zwischen Regierung und Opposition an, der in Mexiko stattfindet. Er erklärte seine Bereitschaft, »aufgrund der Erfahrung im Bereich der Menschenrechte eine Brücke zwischen der Opposition und der venezolanischen Regierung« zu schlagen und forderte beide Seiten auf, »einander in einem sinnvollen Dialog zuzuhören, um eine gemeinsame Vision für die Zukunft zu finden«. Während seines Aufenthalts war Türk unter anderem mit Präsident Nicolás Maduro und Mitgliedern der gesprächsbereiten Opposition zusammengetroffen.
Zeitgleich mit dem Besuch des UN-Vertreters kündigte die Nationalversammlung am Donnerstag an, einen Ausschuss einzurichten, der unter anderem die Unterstützung einiger Oppositioneller für Aktivitäten der USA zum Sturz der gewählten Regierung untersuchen soll. Anlass ist die kürzlich erfolgte Veröffentlichung des Buches »Never Give an Inch« (Niemals einen Zoll nachgeben) von Michael Pompeo, dem ehemaligen US-Außenminister (2018–2021) und CIA-Direktor (2017–2018). »Wir konnten nicht dulden, dass ein Land, das nur 1.400 Meilen von Florida entfernt ist, Russland, China, Kuba und dem Iran den roten Teppich ausrollt«, schreibt Pompeo. Washington habe Sanktionen verhängt, um das Land »von einem Diktator zu befreien«. Ziel war es, so Pompeo, der venezolanischen Regierung »die Möglichkeit zu nehmen, Devisen zu erwirtschaften, und sie daran zu hindern«, Öl und Gold zu exportieren, was »ihre Haupteinnahmequellen« seien. Vor den Wahlen im Jahr 2018 »sahen wir die Chance, dem Regime mit Hilfe eines relativ unbekannten 35jährigen Oppositionspolitikers namens Juan Guaidó, das Leben schwerzumachen«. In seinem Buch gibt Pompeo zu, dass Washington die extremistische Opposition um Juan Guaidó mit einer Milliarde US-Dollar finanzierte. Der venezolanische Außenminister Yván Gil erklärte dazu am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter: »Während das Imperium den Tod in unserem Land plante, wurde es hier von Gruppen unterstützt, die das Heimatland ausverkauften (…) heute gestehen die Aggressoren.«
Quelle: junge Welt v.31.01.2023/ Juan Carlos Hernandez/ZUMA Wire/imago
Nachbarschaftshilfe zur Versorgung der Bedürftigsten im Stadtbezirk Miguel Peña von Valencia (17.10.2020)

Verstoß gegen Menschenrechte
Jedes fünfte Kind arm? Jedes vierte? Egal, Panzer sind wichtiger
29 Jan. 2023 12:49 Uhr
Jedes Jahr gibt es neue Zahlen zur Armut, die den alten gleichen, und immer wieder gibt es Berichte der Bertelsmann-Stiftung dazu. Aber es ändert sich nichts, zumindest nicht zum Guten. Wenn es nächstes Jahr noch einen solchen Bericht geben sollte, sind noch mehr Kinder arm.
Von Dagmar Henn
Die Bertelsmann-Stiftung ist dieses Jahr etwas zu früh dran, um das Thema "Kinderarmut" in die Presse zu bringen. Das Gehege für Sozialthemen in der deutschen Medienlandschaft erstreckt sich nämlich zweimal im Jahr über jeweils vier Wochen – vor Ostern und vor Weihnachten. Den Rest des Jahres wird eigentlich konsequent so getan, als wäre da nichts. Und, wenn man strikt nach Nachrichtenqualität geht: Dass über 40 Prozent der Kinder von Alleinerziehenden (samt der Mütter) in Armut leben, ist nichts Neues. Die Einführung von Hartz IV führte zu einem Sprung nach oben; aber schon davor lag die als "Armutsrisiko" beschönigte Armut Alleinerziehender bei 35,4 Prozent. Und auch das ist konstant: Über die Hälfte aller in Armut lebender Kinder sind Kinder Alleinerziehender. Wir reden also von einem Zustand, der Gesellschaft und Politik seit langem bekannt ist, an dem sich aber nichts zum Besseren ändert.
Gleiches gilt für die regionale Verteilung. Es sind die ehemaligen Industriestandorte, an denen die Armut besonders groß ist; in Deutschland nicht anders als in Großbritannien. Im Ruhrgebiet führt Gelsenkirchen, die einstige Zechenhochburg, mit 41,7 Prozent, gefolgt von Essen, Dortmund, Hagen, Herne und Duisburg mit jeweils knapp über 30 Prozent Kindern und Jugendlichen, die von Hartz IV leben müssen. Auch Bremen und Bremerhaven liegen in dieser Größenordnung. Und so ist es ebenfalls seit Jahren, seit Jahrzehnten.
Die Begriffswahl "Kinderarmut" entstand übrigens in den 2000ern nach der Einführung von Hartz IV, als die erste Überprüfung des Regelsatzes anhand einer neuen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe stattfand. Da stellte sich nämlich heraus, dass der Regelsatz, also die monatlich zu zahlende Leistung, deutlich erhöht werden müsste, wenn man, wie es das Gesetz ursprünglich vorsah, den Verbrauch der unteren 20 Prozent der Bevölkerung zum Maßstab nähme. Um das zu umgehen, wurde schwupps der Maßstab auf die untersten 15 Prozent reduziert, und zusätzlich wurden reihenweise Ausgaben für unnötig erklärt und damit gestrichen, wie Alkohol, Tabak, Wirtshausbesuche etc. Gestützt wurde das durch eine entsprechende publizistische Kampagne, die der Bevölkerung einreden sollte, Eltern, die Hartz IV bezögen, würden zusätzliches Geld ohnehin nur versaufen.
Die nächste Runde Verunglimpfung gab es dann, als bekannt wurde, dass sich arme Kinder keine Musikschule und keine Sportvereine leisten können, und dann die später als Flintenuschi bekannt gewordene, inzwischen als Präsidentin der EU-Kommission amtierende Ursula von der Leyen ein bürokratisches Monstrum namens Bildungs- und Teilhabepaket gebar, erneut mit der Begründung, die Eltern würden zusätzliches Geld ohnehin nur versaufen (wobei man sich angesichts der Karriere von Flintenuschi durchaus fragen kann, ob das nicht selbst dann bei den Eltern noch besser aufgehoben wäre als bei drei Dutzend Beratergesellschaften).
Nachdem arme Eltern derart als grundsätzlich unverantwortlich gebrandmarkt waren, was natürlich nur ging, indem man die Alleinerziehenden, die die weit überwiegende Mehrheit dieser armen Eltern darstellen, aus der Wahrnehmung verschwinden ließ, weil "versaufen" und alleinerziehend doch keine so überzeugende Kombination sind, und damit endgültig feststand, dass arme Eltern arm sind, weil sie es nicht besser verdient haben, ermöglicht der Begriff "Kinderarmut" zumindest, noch gelegentlich über diese Armut zu sprechen.
Die Bertelsmann-Stiftung folgt diesem Muster, an dessen Etablierung sie nicht unschuldig war, auch brav.
"Kinder- und Jugendarmut ist in der Regel immer auch Familienarmut und muss daher im Zusammenhang mit der Situation der Familie betrachtet werden. Kinder und Jugendliche können nichts dafür, wenn sie in armen Verhältnissen aufwachsen. Sie trifft keine Schuld."
Subtil, aber bösartig. Nur die Kinder und Jugendlichen trifft keine Schuld. Den Rest der Familie, überwiegend die Mütter, dann eben doch, oder? Die Väter spielen übrigens gar keine Rolle, und die Gesellschaft erst recht nicht. Dabei weist schon die regionale Verteilung darauf hin, dass es der ökonomische Zustand der Region ist, der die entscheidende Rolle spielt. Auch wenn, das muss an dieser Stelle auch gesagt werden, die "Armutsgefährdung" im Süden der Republik bei Weitem nicht so niedrig ist, wie der bundesweite Armutsbericht und auch diese Bertelsmann-Studie es verzeichnen.
Auch die Preise sind nämlich nicht überall gleich. Vor vielen Jahren gab es eine Studie mit einem Vergleich der Lebenshaltungskosten innerhalb Bayerns. Dabei ergab sich, dass selbst ohne Berücksichtigung der Mieten das Leben in Landshut um ganze 15 Prozent günstiger war als in München. Und eine ortsspezifische Armutsgrenze für München, streng nach dem europäischen Kriterium von 60 Prozent des gewichteten Medianeinkommens, ergab plötzlich eine Armutsquote von mehr als 20 Prozent.
Aber das ist egal. Jedes Jahr von Neuem. Das wäre anders, würden die Zahlen zu Armut, Wohnungslosigkeit, zu jedem Aspekt des sozialen Elends einmal im Monat auf der Vorderseite des Lokalteils veröffentlicht, als Gradmesser der politischen Leistung. Jedes fünfte Kind lebt in Armut, deutschlandweit, noch immer. Jedes Jahr, wenn die entsprechenden Berichte erscheinen, wird kurz einmal getönt, ja, da müsse man tätig werden. Und im nächsten Jahr kommen dieselben Zahlen wieder.
Überhaupt, der ganze Bericht erzählt eine Geschichte von gestern. Die zugrundeliegenden Zahlen sind von 2021. Zwischen diesen Zahlen und heute liegt ein Jahr mit hoher Inflation, die gerade für die Armen eben mehr als die offiziellen zehn Prozent betragen hat, weil Nahrungsmittel und Energie einen besonders großen Anteil der Ausgaben ausmachen. Allein diese Entwicklung dürfte den Anteil armer Kinder auf mindestens ein Viertel erhöht haben, was dann für Orte wie Gelsenkirchen hieße, dass die Hälfte der Kinder arm ist.
Ein Viertel der Kinder, die von Hartz IV leben müssen, hat keinen Computer. Die Studie erwähnt das, ohne ins Gedächtnis zu rufen, dass gerade erst im letzten Jahr dieser fehlende Computer hieß, den in die Distanz verlegten Schulunterricht komplett zu verpassen. Noch so ein Signal, wie gleichgültig die Gesellschaft der Armut gegenüber ist – schon die erste Überlegung, Unterricht über das Internet abzuhalten, hätte damit verbunden sein müssen, wie man Rechner und Anschlüsse für die Kinder sicherstellt, die keinen haben. Aber ein Computer pro Kind ist nach wie vor nicht Teil des Bedarfs.
67,6 Prozent der Familien, die von Grundsicherung leben, fahren nicht einmal für eine Woche in den Urlaub, stellt die Studie fest. Tatsächlich bräuchten die meisten mehr als eine Woche; drei Wochen seien die Voraussetzung zur Erholung, wird allgemein gesagt. Interessanterweise ist im Kinder- und Jugendhilfegesetz sogar Familienurlaub vorgesehen, aber an keinem Ort wurde dieser Anspruch bisher umgesetzt. Es wäre möglich.
Überhaupt wäre vieles möglich, so man denn wollte. Garantiert hätten die Kinder und die Alleinerziehenden eine Lobby wie das Kiewer Regime, mit Fürsprechern in jeder Redaktion und einem Haufen Internettrolle, in drei Wochen wäre das Ding gewuppt. Ein, zwei Kitschreden der Sorte Annalena "da hungern Kinder" dazu, noch eine Handvoll Talkrunden, in denen sämtliche Gäste in unterschiedlichen Tonlagen beteuern, welch wichtige Herausforderung es doch für das Land wäre, dass alle Kinder gut heranwachsen, welch bedeutende europäische Werte doch Menschenwürde, Bildung und Kultur seien, die man unbedingt gegen die materielle Not verteidigen müsse – fertig.
Ja, wenn man Armut mit Panzern bekämpfen könnte. Leider ist das Wort "Kinderarmut" aber noch in einem ganz anderen Sinne passend für Deutschland. Das Land ist arm an Kindern. Was unmittelbar mit der Armut von Kindern verknüpft ist, auch wenn immer so getan wird, als wäre das eher ein Produkt einer modernen Gesellschaft. Die Geburtenrate der DDR war wesentlich höher, und sie sank sofort ins Bodenlose, als die soziale Sicherheit schwand. Migranten übrigens haben genau in der ersten Generation mehr Kinder als Deutsche. Sobald klar ist, dass die ausgedehnten Familiennetzwerke als soziale Unterstützung ausfallen, die staatliche aber eher darauf ausgerichtet ist, von der Kinderaufzucht abzuhalten, fällt auch da die Geburtenrate.
Der ganze Umgang mit Armut in Deutschland richtet sich nicht am Interesse der Bevölkerung aus, zu der eben auch der arme Teil gehört, sondern an dem der Kapitaleigner; bei Hartz IV ging es schlicht darum, die Löhne zu drücken, was ja auch gelang, und die diversen Migrationswellen dienen dem selben Zweck, mit dem zynischen Hintergedanken, dass es billiger ist, das Menschenmaterial fertig zu importieren. Zuletzt gab es eine Reihe von Punkten, an denen das Probleme machte, weil sich die Strecke vom Analphabeten zum Metallfacharbeiter eben doch über ein Jahrzehnt hinzieht; aber wenn die deutsche Industriegesellschaft einmal geschreddert ist – um einen Holzpflug zu ziehen, muss man nicht lesen können.
Man kann den diesjährigen Durchlauf des Themas "Kinderarmut" durchaus als Abschiedsvorstellung betrachten. Die aktuelle Bundesregierung tut ihr Bestes, das Thema Armut gleichzeitig aus seinem Nischendasein zu befreien, indem die Gruppe der Armen zielgerichtet ausgeweitet wird, und es gleichzeitig im schwarzen Loch der Berichterstattung zu versenken. Denn wer wird noch über Kinder berichten, denen die Geburtstage von Freunden entgehen, weil sie keine Geschenke kaufen können, wenn die Ampel es endlich geschafft hat, Europa in Brand zu setzen? Beim jetzigen Tempo jedenfalls findet die Weihnachtsrunde Sozialthemen bereits nicht mehr statt.
Und wenn man den Grad der Unmenschlichkeit betrachtet, des Antihumanismus, der sich in dem Kriegsgeschrei, dem erbarmungslosen Verheizen der Ukrainer, dem blanken Rassismus gen Russland und der Zerstörung des deutschen Wohlstands gleichermaßen ausdrückt, muss man feststellen, dass die Kaltschnäuzigkeit, mit der bald 20 Jahre lang derartige Berichte über arme Kinder zu den Akten gelegt und vergessen wurden, Vorahnung wie Vorbereitung waren.
Denn Menschlichkeit ist instinktiv; Kinder kennen Mitgefühl und haben einen Sinn für Gerechtigkeit, ohne sie gelehrt zu bekommen. Es ist die Unmenschlichkeit, die eingeübt werden muss. Die Gleichgültigkeit gegenüber der Armut und die Bereitschaft, zur Erhaltung eines globalen Raubregimes in den Krieg zu ziehen, sind Schritte auf ein und demselben Weg in den Abgrund. Die Karriere der Ursula von der Leyen von der Erfinderin des Bildungs- und Teilhabepakets zu Flintenuschi zur obersten europäischen Kriegstreiberin besitzt eine tiefe innere Logik.
Quelle: rtde.v.29.01.2023/Symbolbild; Bamberg, 18.01.2023

Verstoß gegen die Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 27.01.2023, Seite 1 / Inland
VERELENDUNG
Kinder- und Jugendarmut auf Rekordhoch
Neue Studie: 20,8 Prozent der Heranwachsenden in Armut, bei jungen Erwachsenen sogar 25,5 Prozent
Von Alexander Reich
In der reichen BRD leben 2,88 Millionen Kinder und Jugendliche in Armut. Mehr als jeder fünfte Heranwachsende ist betroffen. Bei den jungen Erwachsenen (18 bis unter 25 Jahre) sind es 1,55 Millionen. Hier liegt der Anteil mit 25,5 Prozent von allen Altersgruppen am höchsten, heißt es in einer Studie, die die Bertelsmann-Stiftung am Donnerstag vorstellte.
Die Armutsschwelle liegt bei 60 Prozent des mittleren Haushaltseinkommens. Bei Paarfamilien mit zwei Kindern sind das 2.410 Euro im Monat, Transferleistungen eingeschlossen, bei Alleinerziehenden mit einem Kind 1.492 Euro. In der Studie ist euphemistisch von »Armutsgefährdung« die Rede.
Junge Erwachsene in Ostdeutschland sind deutlich häufiger betroffen als Gleichaltrige im Westen (32,5 Prozent bzw. 24,2 Prozent). Im Osten liegt der Anteil junger Frauen dabei 6,2 Prozent über dem der jungen Männer, im Westen sind es nur 2,9 Prozent. Aber auch im Westen sind die regionalen Unterschiede riesig. In der bayerischen Kreisstadt Roth liegt die Kinderarmutsquote bei 2,7 Prozent, in Gelsenkirchen bei 41,7 Prozent.
Besonders hoch liegen die Anteile mit 41,6 Prozent bei Alleinerziehenden, am schlimmsten ist es in Mecklenburg-Vorpommern (50 Prozent) und Bremen (54 Prozent). Die Zahl der Kinder von Alleinerziehenden, die Transferleistungen beziehen, ist im Juni 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 11,5 Prozent gestiegen. Auch bei der Zahl aller Heranwachsenden in Bedarfsgemeinschaften gab es den ersten deutlichen Anstieg seit fünf Jahren, heißt es in der Studie. Zurückgeführt wird das auf ukrainische Kriegsflüchtlinge. Im übrigen erhält jeder fünfte dieser Jugendlichen aus finanziellen Gründen kein Taschengeld. In der Vergleichsgruppe sind es nur 1,1 Prozent.
Auch die Abhängigkeit des Lernerfolgs »vom sozioökonomischen Status« hat sich laut Studie »nochmal erhöht«: »Die soziale Schere geht weiter auseinander.« In einer Reaktion forderte der Sozialverband VdK am Donnerstag einen »Neustart im Kampf gegen Kinderarmut«. Der Paritätische erklärte die Studienergebnisse zum »Resultat jahrzehntelanger politischer Unterlassungen«.
Quelle: junge welt vom 27.01.2023/ picture alliance / dpa-Zentralbild
»Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles.«

Info über Verstoß gegen Menschenrechte in Argentinien
Milagro Sala feiert sieben Jahre Haft und fordert ihre Freilassung
Menschenrechtsorganisationen haben den Präsidenten aufgefordert, Sala zu begnadigen, was der Präsident wegen angeblicher Inkompetenz in dem Fall bestritten hat.
Die Referentin der Organisation der indigenen Völker von Argetina Tupac Amaru, die Führerin Milagro Sala, ratifizierte diesen Montag anlässlich eines neuen Jahrestages ihrer Verhaftung, dass es sich um eine willkürliche Inhaftierung handelt und Teil dessen, was sie ein "Labor der Lawfare" nannte.
Sala steht weiterhin unter Hausarrest, erhält Zeichen der Unterstützung und Solidarität von Organisationen und Persönlichkeiten, die die sogenannte Verfolgungsaktion der Provinzregierung von Jujuy unter der Leitung von Gerardo Morales anprangern.
Die indigene Führerin beschwert sich über das, was sie die Untätigkeit von Präsident Alberto Fernández nennt, und ging so weit zu sagen, dass "es wie Judas aussieht", in Bezug auf das letzte Treffen, das sie Mitte letzten Jahres hatten, als der Präsident sie anlässlich eines Krankenhausaufenthalts wegen gesundheitlicher Probleme besuchte.
Im Gespräch mit einem lokalen Radiosender sagt Sala, dass er das Gefühl hat, dass es ihm "schlecht geht. Ich fühle mich allein, dass sie mich vergessen haben. Früher haben alle Fotos mit politischen Gefangenen gemacht, heute ist es, als würden sie uns ausweichen. Irgendwann fühlte es sich so an, als ob sie vielleicht nicht glauben, dass du für das, was dir vorgeworfen wird, zur Rechenschaft gezogen werden willst. Sie geben dir Schuldgefühle."
Menschenrechtsorganisationen haben gefordert, dass Präsident Fernández Sala begnadigt, was der Präsident mit dem Argument abgelehnt hat, dass es sich um eine gerichtliche Resolution der Provinz handelt, die er nicht rückgängig machen kann.
Ende vergangener Woche berichtete sein Hausarzt Jorge Rachid, Sala zeige ein Bild von "einer tiefen Thrombose in der linken unteren Extremität, die bereits zuvor operiert worden war".
Nach Angaben des Arztes wird sie im öffentlichen Krankenhaus von Jujuy jedes Mal misshandelt und gewalttätig, wenn sie behandelt wurde, so dass sie gebeten wurde, in ein Zentrum in Buenos Aires verlegt zu werden, aber laut Rachid bestreitet die Provinzregierung von Gerardo Morales die Möglichkeit.
Sala befand sich zu Beginn seiner Haft im Frauengefängnis von Alto Comedero, aber seit 2017 verbüßt er seine Strafe mit Hausarrest, nachdem der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte ein Urteil in dieser Hinsicht erlassen hatte und das vom Obersten Gerichtshof angeordnet wurde.
Quelle: teleSUR v.16.01.2023

Menschenrecht ist in Frieden zu leben und in eine menschenwürdige Unterkunft !!!
Aus: Ausgabe vom 13.01.2023, Seite 1 / Titel
ARMUT IN DER BRD
Hätte, hätte, Panzerkette
Größtes Defizit seit 20 Jahren: 700.000 Wohnungen fehlen. Bündnis fordert »Sondervermögen« für sozialen Wohnungsbau
Von Susanne Knütter
Für Aufrüstung gibt es ein milliardenschweres »Sondervermögen«, nicht jedoch für den sozialen Wohnungsbau. Das zu ändern forderte das Bündnis »Soziales Wohnen« auf seiner Jahrespressekonferenz am Donnerstag in Berlin. Die Summe, die das Bündnis, an dem sich neben dem Mieterbund und der Gewerkschaft IG BAU auch Sozialverbände und Branchenvertretungen der Bauwirtschaft beteiligen, verlangt, ist allerdings deutlich geringer. 50 Milliarden Euro solle der Staat für den Neubau von 380.000 Sozialwohnungen bis zum Ende der Legislaturperiode bereitstellen. Damit könnte die Bundesregierung dem selbstgesteckten und bisher weit verfehlten Ziel von 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr gerecht werden.
Wie groß der Bedarf an Wohnungen insgesamt ist, legte das Verbändebündnis anhand zweier Studien dar. Im Jahr 2022 baute sich mit über 700.000 fehlenden Wohnungen das größte Defizit seit mehr als zwanzig Jahren auf. Kamen im Jahr 1987 in Westdeutschland auf 100 Mieterhaushalte 25 Sozialwohnungen, ist die Zahl aktuell auf fünf zurückgegangen, wie Matthias Günther, Leiter des Pestel-Instituts in Hannover, erläuterte. Dabei hätten derzeit offiziell elf Millionen Mieterhaushalte einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein und somit auf eine Sozialwohnung. Aber nur für jeden Zehnten davon gibt es aktuell eine. Und der Bedarf werde noch einmal deutlich ansteigen. Infolge des Kriegs in der Ukraine habe 2022 die Zahl der Geflüchteten hierzulande einen Rekord erreicht. 2022 lebten rund 1,5 Millionen Menschen zusätzlich in Deutschland. »Wer in die BRD flüchtet und längere Zeit bleibt, ist auf den sozialen Wohnungsmarkt angewiesen«, so Günther.
Damit wird deutlich: Es fehlt in erster Linie an bezahlbarem Wohnraum. Aber wie die Wohnungswirtschaft diese Situation ausnutzt, um immer höhere Profite aus ihren Mietern herauszupressen, war nicht das Thema dieser Pressekonferenz. Die Lösung sehen die am Bündnis beteiligten Organisationen einmal mehr in dem Instrument »Bauen, Bauen, Bauen«. Und dafür brauche es einen »Juckreiz«, damit Verbände und Unternehmen in den sozialen Wohnungsbau einsteigen, wie der Vizevorsitzende der IG BAU, Harald Schaum, die »nötigen« finanziellen »Anreize« bezeichnete. Dazu gehöre etwa auch ein Steuerpaket für den sozialen Wohnungsbau. Allein durch die Reduzierung der Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent wäre eine durchschnittliche Sozialwohnung von 60 Quadratmetern Wohnfläche um mehr als 20.000 Euro günstiger zu bauen. Damit einhergehen könnte – nebenbei bemerkt – eine längerfristige Sozialbindung für die so errichteten Wohnungen. Ein weiterer Anreiz wären schnellere und unbürokratischere Genehmigungsverfahren.
Ein Aspekt, der den Forderungen des Bündnisses in den Augen der Bundesregierung Nachdruck verleihen könnte, ist der Mangel an Arbeitskräften. Künftig sei der deutsche Arbeitsmarkt auf 300.000 bis 500.000 Menschen angewiesen, die pro Jahr zuwanderten. Ohne sie würde etwa der Sozial- und Gesundheitsbereich zusammenbrechen, erklärte Janina Bessenich, Geschäftsführerin des Caritas-Fachverbandes Behindertenhilfe und Psychiatrie. Aber schlechte Bezahlung und teure Wohnungen sind eher keine Anreize, um nach Deutschland zu kommen. Es sei denn, die Not andernorts ist noch größer. Vielleicht gehört das zum Kalkül der Bundesregierung bei ihrem außenpolitischen Kurs.
Quelle: junge Welt v.13.01.2023/ picture alliance / Daniel Kubirski
Nach der Wahl wurden die Prioritäten etwas deutlicher: Das angekündigte Budget für Sozialwohnungen wanderte in die Aufrüstung
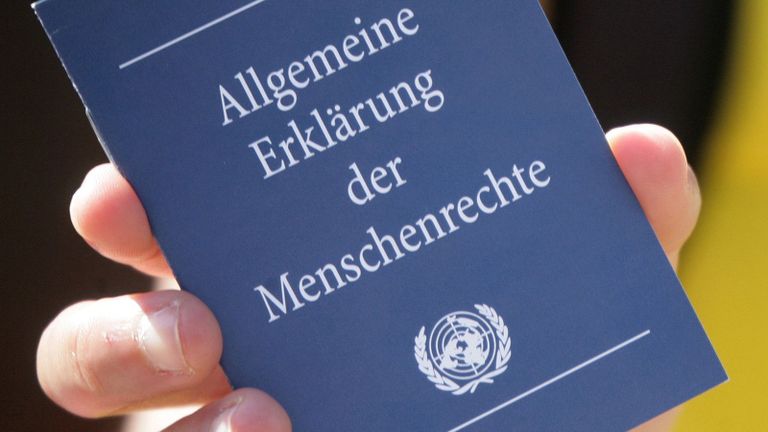
Menschenrechte in der BRD - das ist die Realität
Jeder dritte Vollzeitbeschäftigte wird Rente unter 1.200 Euro erhalten
Die gesetzliche Altersvorsorge könne den Lebensstandard vieler Rentner nicht mehr sichern, kritisiert Dietmar Bartsch. Der Chef der Linksfraktion fordert eine Reform.
Aktualisiert am 12. Januar 2023, 11:48 Uhr
Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag © Michael Kappeler/dpa
Mehr als ein Drittel der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland wird nach Zahlen der Bundesregierung im Alter eine gesetzliche Nettorente von unter 1.200 Euro erhalten. Das berichtet die Augsburger Allgemeine unter Berufung auf eine Anfrage der Linken. Der Vorsitzende der Linksfraktion, Dietmar Bartsch, nannte die Zahlen alarmierend. "Wir brauchen eine große Rentenreform in Deutschland", sagte er der Zeitung.
Laut Bundesregierung würden 36 Prozent der künftigen Rentnerinnen und Rentner selbst nach 45 Arbeitsjahren maximal 1.200 Euro netto aus der gesetzlichen Altersvorsorge erhalten. Dies trifft dem Bericht zufolge auch auf das wohlhabendere Süddeutschland zu: In Bayern landen 33 Prozent und in Baden-Württemberg 29 Prozent der künftigen Bezieher trotz Vollzeitarbeit unter der genannten Grenze.
Nach den Zahlen aus Daten der Bundesagentur für Arbeit ist das Problem niedriger Rentenansprüche in Ostdeutschland am größten. In Sachsen wird demnach über die Hälfte der künftigen Rentnerinnen und Rentner mit maximal 1.200 Euro aus der gesetzlichen Versicherung nach Hause gehen, in Thüringen gar 57 Prozent.
Bartsch fordert Reform nach Vorbild Österreichs
"Wir brauchen eine Rentenkasse wie in Österreich, wo die durchschnittliche Rente 800 Euro höher ist als bei uns", forderte Bartsch. "Das ist möglich, weil dort nicht nur Arbeitnehmer und Arbeitgeber einzahlen, sondern alle Bürger mit Erwerbseinkommen – auch Abgeordnete, Beamte, Selbstständige und Manager. Was Österreich kann, muss auch Deutschland können."
Bartsch verwies darauf, dass das Problem sämtliche Bundesländer betreffe: "Derzeit müsste ein Vollzeitbeschäftigter 3.034 Euro brutto im Monat 45 Jahre durchgehend verdienen, um rechnerisch auf 1.200 Euro Nettorente zu kommen", sagte der Fraktionschef der Linken. "Das Verhältnis stimmt nicht." Lohn- und Rentenniveau seien vielfach zu gering.
Die gesetzliche Rente sichere häufig nicht mehr den Lebensstandard, sagte Bartsch weiter. "Gerade angesichts der galoppierenden Inflation sind deutliche Lohnsteigerungen und eine schrittweise Anhebung des Rentenniveaus auf 53 Prozent geboten."
QuellE. Zeit-online 12. Jan.2023 / Bild GeFiS-Archiv

Verletzung von Menschenrechten in der BRD
Aus: Ausgabe vom 09.01.2023, Seite 1 / Inland
MOBILISIERUNG GEGEN POLIZEIGEWALT
Gedenken an Oury Jalloh und weitere Opfer rassistischer Polizeigewalt
Dessau. Das war Mord. Mit dieser Aussage zogen rund 1.600 Demonstranten am Sonnabend durch Dessau. Gefordert wurde Gerechtigkeit für den dort am 7. Januar 2005 in einer Arrestzelle der Polizei verbrannten Oury Jalloh. Denn seit 18 Jahren wird die Aufklärung der Todesumstände von staatlicher Seite durch Lügen und Vertuschung verhindert. Die Demonstranten warfen Hunderte Feuerzeuge in den Briefkasten der Staatsanwaltschaft. Mit einem Feuerzeug habe der an Händen und Füßen gefesselte Jalloh sich und die Matratze in seiner Zelle selbst angezündet, so lautete die durch forensische Gutachten und Brandversuche widerlegte Behauptung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Dank der von der Initiative Oury Jalloh – Break the Silence in Auftrag gegebenen Untersuchungen steht fest, dass der Guineer schwer körperlich misshandelt wurde, ehe er verbrannte. Bislang wurde nur ein Polizist wegen unterlassener Hilfeleistung und fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt. Nach Ausschöpfung aller Rechtsmittel in Sachsen-Anhalt liegt der Fall seit drei Jahren dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe vor.
Auf der Dessauer Demonstration wurde auch an andere Opfer von rassistischer Polizeigewalt und Neonaziangriffen erinnert – so an den im vergangenen Jahr in Dortmund von Polizisten erschossenen 16jährigen Mouhamed Lamine Dramé. (jW)
Quelle: junge Welt v.09.01.2023

USA verletzen Flüchtlingsrechte
UN verurteilt US-Vorgehen wegen Verletzung von Flüchtlingsrechten
Die jüngsten Grenzmaßnahmen, die von der Biden-Regierung gefördert wurden, "entsprechen nicht den Normen des Flüchtlingsrechts", so UNHCR.
Der Sprecher des UN-Hochkommissars für Flüchtlinge, Boris Cheshirkov, sagte am Freitag, dass neue US-Einwanderungsmaßnahmen die Rechte der Flüchtlinge verletzen, indem sie internationale Standards nicht erfüllen.
Auf einer Pressekonferenz in Genf sagte der Sprecher, dass UNHCR zwar die Öffnung neuer und sicherer Wege für einige Länder in die USA begrüße, diese Regeln "dürfen diejenigen, die zur Flucht gezwungen sind, nicht daran hindern, ihr grundlegendes Menschenrecht auf Sicherheit auszuüben".
Nach Ansicht der UN-Agentur entsprechen die jüngsten Grenzmaßnahmen, die von der Biden-Regierung gefördert werden, "nicht den Normen des Flüchtlingsrechts", da sie Migranten die Möglichkeit verweigern würden, Asyl in den Vereinigten Staaten zu beantragen, wenn sie ohne Erlaubnis aus Mexiko kommen.
Laut offiziellen Quellen analysiert UNHCR die neuen Maßnahmen und die Folgen ihrer Anwendung, die die Einreise "einer beispiellosen Anzahl von Menschen" aus den vier lateinamerikanischen Nationen in die Vereinigten Staaten ermöglichen werden.
Ebenso hat die Agentur auf ihrer Besorgnis über die Kontinuität von Titel 42 bestanden, der umstrittenen Regel, die die sofortige Ausweisung von Migranten aus gesundheitlichen Gründen erlaubt, nachdem ihre Verlängerung vom Obersten Gerichtshof des nördlichen Landes gebilligt wurde.
"Was wir wiederholen, ist, dass dies weder im Einklang mit den Normen des Flüchtlingsrechts steht, noch um eine Verbindung zwischen den angekündigten sicheren und legalen Wegen herzustellen", schloss Cheshirkov.
Quelle: teleSUR v.07.01.2023 (Bild, © UNHCR/Nicolo Filippo Rosso Asylsuchende kommen an der Südgrenze der Vereinigten Staaten an; Laut UNHCR würde die neue US-Maßnahme Migranten die Möglichkeit verweigern, Asyl zu beantragen, wenn sie ohne Erlaubnis aus Mexiko in die Vereinigten Staaten einreisen. | Foto: EFE.)

Info über Peru
„Wir sehen schwere Menschenrechtsverletzungen“
(Lima, 19. Dezember 2022, Exitosa Noticias).- Mar Pérez, Anwältin der peruanischen Nationalen Menschenrechtskoordination (CNDDHH) erklärte gegenüber dem Nachrichtenportal Exitosa Noticias, dass die hohe Zahl an Toten und Verletzten bei den jüngsten landesweiten Protesten auf „schwere Menschenrechtsverletzungen“ zurückzuführen seien. Die Anwältin kritisierte, dass die Regierung die Streitkräfte eingesetzt hat, um bei der Wiederherstellung der Ordnung mitzuwirken. Sie wies darauf hin, dass die Armee nicht dafür ausgebildet sei, Menschenansammlungen zu zerstreuen, sondern dass „sie darauf trainiert ist, militärische Ziele zu eliminieren“.
„Wir haben es mit schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen zu tun, die nicht als individuelle Exzesse bezeichnet werden können. Indem die Regierung die Beteiligung der Streitkräfte an der Kontrolle der inneren Ordnung genehmigt hat, trägt sie die Verantwortung“, erklärte sie.
„Man darf nicht schießen, um einen Flughafen zu verteidigen“
Mar Pérez erinnerte daran, dass die Ordnungskräfte nach den internationalen Menschenrechtsnormen nur dann schießen dürfen, wenn es um die Rettung von Menschenleben geht. „Man darf nicht schießen, um eine Straße freizumachen, um eine Menschenmenge zu zerstreuen, nicht einmal, um Infrastruktur, etwa einen Flughafen, zu verteidigen“, sagte sie. Die Anwältin der CNDDHH vertrat die Auffassung, dass die Polizei die Kontrolle hätte übernehmen müssen, um den Flughafen von Ayacucho zu schützen. Bei schweren Auseinandersetzungen auf dem Flughafengelände gab es mindestens sieben Tote. „Es gibt Geschosse, mit denen man Menschenmengen zerstreuen kann, ohne Menschen zu töten“, so Pérez. Zwar dürften Sicherheitskräfte Gewalt gegen Personen anwenden, die Vandalismus begehen. Dies bedeute jedoch nicht, dass wahllos auf eine ganze Menschenmenge geschossen werden dürfe. „Wenn Polizei und die Armee mitten in einer Stadt Kriegswaffen einsetzen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es zu unschuldigen Opfern kommt. Das ist in einem Rechtsstaat nicht hinnehmbar“, sagte sie.
Quelle: Nachrichtenpool Lateinamerika Dez.2022/ Bei schweren Auseinandersetzungen in verschiedenen Regionen Perus gab es mehrere Tote und Schwerverletzte. Foto: alai.info

Verstoß gegen Menschenrechte in der BRD
Aus: Ausgabe vom 24.12.2022, Seite 8 / Inland
OBDACHLOSIGKEIT IN DER BRD
»Dafür, dass der Winter erst angefangen hat, sind das viele«
Mindestens sechs Wohnungslose sind in der BRD zuletzt infolge niedriger Temperaturen gestorben. Ein Gespräch mit Werena Rosenke
Interview: Kristian Stemmler
Werena Rosenke ist Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W)
Der Winter hat sehr kalt angefangen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe meldet bereits die ersten Kältetoten unter obdachlosen Menschen. Wie viele sind es hierzulande, und wie werden die Fälle erfasst?
Es sind bisher sechs Fälle – dafür, dass der Winter erst angefangen hat, sind das sehr viele. Seit etwa 30 Jahren führen wir ein entsprechendes Monitoring der Presseberichterstattung durch und durchforsten auch die Lokalteile von Zeitungen bundesweit. Bei der Zahl, die wir nennen, handelt es sich um eine Mindestzahl von Toten. Wir erfassen nur die Fälle, die in der Presse erscheinen.
Formal wird unterschieden, ob die obdachlosen Menschen wegen oder mit der Kälte gestorben sind. Wie bewerten Sie das?
Die Unterscheidung ist eher akademisch. Ob jemand an oder mit Unterkühlung stirbt, ist erst einmal egal. Oft haben Menschen auf der Straße Vorerkrankungen, die sie für Kältegrade weniger resilient machen. Im übrigen kann man auch bei Plustemperaturen einen Kältetod sterben, wenn etwa keine vernünftige Kleidung vorhanden ist. Es ist auch schon jemand im September an Unterkühlung gestorben.
Die Gefahr durch das Coronavirus ist auch unter Wohnungslosen nicht mehr das dominierende Thema. Dafür kursieren jetzt Atemwegserkrankungen.
Wie im Rest der Bevölkerung auch haben viele von ihnen die Grippe oder andere Erkältungskrankheiten. Der Unterschied besteht aber darin, dass sich wohnungslose Menschen nicht in die eigenen vier Wände zurückziehen können, um das ein paar Tage lang auszukurieren.
Die Kommunen und Wohlfahrtsverbände halten im Winter besondere Angebote bereit. Welche sind das?
Es werden beispielsweise Kältebusse eingesetzt oder Aufenthaltsstätten für wohnungslose Menschen angeboten. Zudem achten Streetworker besonders auf Menschen, die sich ganztags im Freien aufhalten.
Haben sich die Angebote in den vergangenen Jahren verbessert?
Das hängt davon ab, welchen Zeitraum Sie in den Blick nehmen. Wenn man sich die letzten 20 Jahre ansieht, muss man sagen: Das Angebot hat sich verbessert. So gab es damals etwa keine Kältebusse. Wenn man sich aber die letzten vier, fünf Jahre ansieht, hat es keine wesentlichen Verbesserungen gegeben. In den beiden Coronawintern hatte man vorübergehend 24/7-Einrichtungen aufgemacht – also solche, die rund um die Uhr geöffnet sind. Davon ist vieles wieder zurückgefahren worden.
Sie fordern, dass die Angebote, die in der Coronazeit aufgemacht wurden, weiter Bestand haben sollen.
So ist es. Notübernachtungsstellen und Tagesaufenthalten mit ausreichend Platz für wohnungslose Menschen müssen Tag und Nacht geöffnet sein. Bei Bedarf müssen leerstehende Hotels angemietet oder leerstehende öffentliche Gebäude für die Unterbringung genutzt werden. Zudem fordern wir die Aussetzung von Zwangsräumungen im Winter. Es ist unbedingt notwendig, zusätzliche Räumlichkeiten zu akquirieren – schon deshalb, weil durch die Unterbringung von Geflüchteten, vor allem aus der Ukraine, die Kapazitäten am Limit sind.
Man hört immer wieder, dass obdachlose Menschen Unterbringungsangebote nicht annehmen, weil sie fürchten, dort beklaut zu werden, oder sie in Mehrbettzimmern schlafen müssen. Können Sie das bestätigen?
Ja. Es gibt zum Beispiel Unterkünfte, die vom hygienischen Standard nicht zumutbar sind. Manche Einrichtungen sind zudem nicht gut erreichbar, weil sie irgendwo am Stadtrand sind. Darum fordern wir, lieber kleinere Einheiten zu schaffen, die dafür zentral liegen. Ich finde es befremdlich, wenn gesagt wird: Wir haben ja noch Kapazitäten. Das mag sein, aber man kann bei der Unterbringung nicht nur auf die Quantität schauen, sondern muss sich auch den Zustand der Unterkünfte anschauen.
Was kann man tun, wenn man in kalten Nächten obdachlose Menschen hilflos auf der Straße findet?
Wenn man den Eindruck hat, die Situation könnte für den Betroffenen gefährlich werden, sollte man die speziellen Kältenotrufe anrufen, soweit es die vor Ort gibt. Ansonsten muss man die Notrufnummer 112 wählen.
Quelle: junge Welt v.24.12.2022/ Frank Molter/dpa
Ein Mann sitzt in einen Schlafsack gehüllt in der Kieler Innenstadt
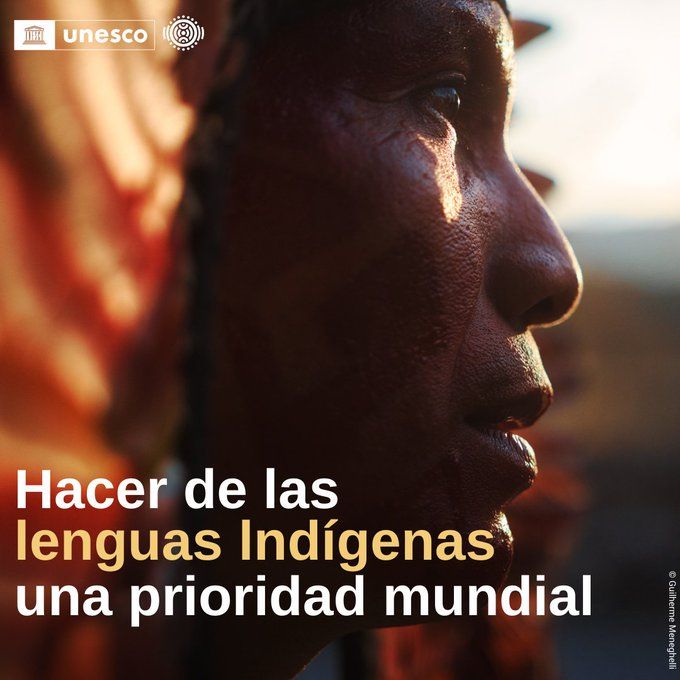
UNO - schützt Rechte der indigenen Bevölkerung
UNO verabschiedet Resolution zu den Rechten indigener Völker
Zum ersten Mal wird das Selbstbestimmungsrecht indigener Völker in ihren Lebensweisen und Traditionen offiziell anerkannt.
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) hat am Montag im Konsens eine von Bolivien vorgelegte Resolution verabschiedet, die das Engagement der Staaten zum Schutz der individuellen und kollektiven Rechte indigener Völker erneuert, berichtete das Außenministerium des Landes am Montag.
Nach Angaben des bolivianischen Außenministeriums war das Dokument mit dem Titel "Rechte indigener Völker" das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit Ecuador und wurde von 47 Ländern gesponsert.
Die UNO nahm die Stellungnahme im Konsens an, hebt das Außenministerium hervor, wo zum ersten Mal auf das Selbstbestimmungsrecht hingewiesen wird, das indigene Völker in freiwilliger Isolation oder Erstkontakt haben, und in diesem Rahmen "haben diese Völker das Recht, nach ihren Traditionen zu leben".
Darüber hinaus wird die offizielle Verwendung des Begriffs "indigene Völker" mit Großbuchstaben in allen Dokumenten der Vereinten Nationen genehmigt.
Die Resolution berücksichtigt auch internationale Initiativen wie das Iberoamerikanische Institut für indigene Sprachen, um die Wiederbelebung mündlicher und schriftlicher Kommunikationspraktiken indigener Völker zu erreichen.
In Verbindung mit dieser Veranstaltung hat die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) am 16. Dezember die Internationale Dekade indigener Sprachen 2022-2032 ins Leben gerufen, eine hochrangige Veranstaltung.
In diesem Zusammenhang erkannte Bolivien die Anstrengungen an, die unternommen wurden, um indigene Sprachen wiederzuerlangen, wiederzubeleben und zu entwickeln.
Die Quellen deuten darauf hin, dass solche Maßnahmen der Vereinten Nationen Teil der internationalen Verpflichtung sind, die Ziele der nachhaltigen Entwicklung zu erreichen, die auf indigene Völker angewendet werden.
Quelle. teleSUR v.20.12.2022

Verbrechen gegen die Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 21.12.2022, Seite 7 / Ausland
EUROPA KOLONIALISMUS
Entschuldigung ohne Entschädigung
Niederlande erkennen eigene Verbrechen der Sklaverei an. Kritik aus ehemaligen Kolonien
Von Gerrit Hoekman
Ministerpräsident Mark Rutte hat am Montag im Namen der niederländischen Regierung um Entschuldigung für die Sklaverei in den ehemaligen Kolonien in Südamerika und der Karibik gebeten. »Wir, die wir im Hier und Jetzt leben, können Sklaverei nur in aller Deutlichkeit als Verbrechen gegen die Menschheit anerkennen und verurteilen«, stellte der Regierungschef in einer Rede im Nationalarchiv in Den Haag fest.
Mehr als 600.000 afrikanische Frauen, Männer und Kinder wurden in den 230 Jahren bis 1814 von niederländischen Sklavenhändlern auf den amerikanischen Kontinent verschleppt. Etwa 75.000 von ihnen sollen bereits auf der Überfahrt gestorben sein. Wer das Ziel erreichte, musste auf Plantagen in Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten und Suriname bis zum Umfallen für die Kolonialherren schuften.
Das Zentrum des niederländischen Sklavenhandels war die Provinz Zeeland. Alleine aus Vlissingen machten sich 453 Schiffe auf den Weg – doppelt so viele wie aus Amsterdam und Rotterdam zusammen. Nachzulesen ist das in dem Datenbankprojekt slavevoyages.com.
Anderthalb Jahrhunderte weigerten sich die Niederlande beharrlich, ihre Schuld anzuerkennen. Dabei spielten zunächst fehlende Einsicht und später die Angst vor Schadensersatzansprüchen eine wichtige Rolle. Große Freude über seine späte Bitte um Verzeihung durfte Rutte in den ehemaligen Kolonien nicht erwarten. »Besser spät als nie«, war der nüchterne Tenor der meisten Menschen, die NPO Radio 1 am Dienstag auf den Karibikinseln befragte.
Besonders in Suriname auf dem Festland, wohin gut 200.000 Menschen verschleppt wurden, gibt es Kritik. Rutte habe ohne Frage schöne Worte gewählt. Aber: »Es fehlten die Demut und die Feierlichkeit, mit denen ein solch aufgeladener historischer Moment begangen werden muss«, kommentierte die Nachrichtenseite Star Nieuws aus Suriname. Weil die niederländische Regierung die betroffenen Länder vorher nicht konsultiert hatte, habe sich die frühere Kolonialmacht »mit der Art und Weise, wie die Anerkennung der kriminellen Vergangenheit stattgefunden hat, als ›überlegen‹ hingestellt. Beratung, Dialog, gemeinsames Entscheiden und Handeln, das war nicht der Fall«.
Von Schadenersatz wollte Rutte ohnehin nichts wissen, die Regierung kündigte nur an, einen Fonds zur »Aufklärung« in Höhe von 200 Millionen Euro einzurichten. Auf Curaçao wird von dem Geld beispielsweise ein Denkmal für Tula gebaut, den legendären Anführer des Sklavenaufstands von 1795.
Die niederländische Regierung hatte hochrangige Repräsentanten in die ehemaligen Kolonien entsandt. Finanzministerin Sigrid Kaag reiste nach Suriname, Gesundheitsminister Ernst Kuipers nach Sint Maarten. Staatssekretär Maarten van Ooijen war auf Sint Eustatius. Er hoffe, »dass wir an einer Zukunft arbeiten können, die sich durch Anerkennung und Verständnis für die jeweiligen Hintergründe auszeichnet«, sagte van Ooijen laut der Tageszeitung NRC am Montag. Dass die Versklavten für die Motive der Sklavenhalter Verständnis aufbringen, dürfte allerdings etwas viel verlangt sein.
Quelle: junge Welt v.21.12.2022/ ROBIN VAN LONKHUIJSEN
Keine Entschädigung: Niederlande werden von ehemaligen Kolonien kritisiert (Den Haag, 19.12.2022)
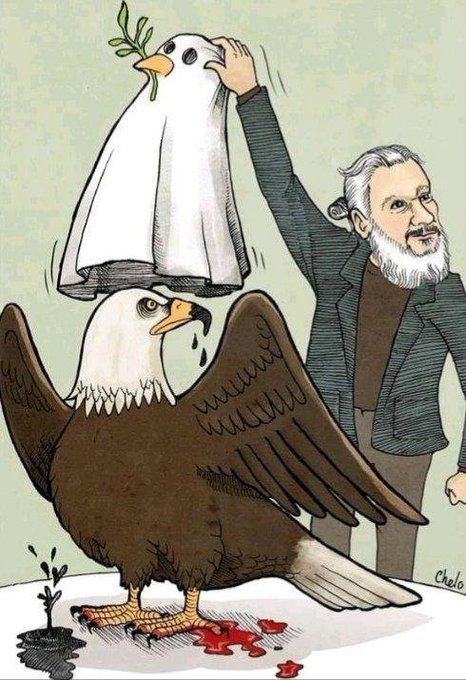
18.12.
2022
Verstoß gegen die Pressefreiheit
Boliviens Präsident drückt Unterstützung für Assanges Freiheit aus
Bei dem Treffen sprach der Präsident von den schwerwiegenden Folgen für die Pressefreiheit, wenn Assange an die USA ausgeliefert wird.
Der Präsident von Bolivien, Luis Arce, traf sich diesen Samstag mit einer Delegation von WikiLeaks in La Paz, in dem er seine volle Unterstützung für die Freiheit und die Rücknahme der Anklagen des Gründers dieser Informationsplattform, Julian Assange, zum Ausdruck brachte.
Bei dem Treffen, an dem auch die bolivianische Ministerpräsidentin María Nela Prada teilnahm, sagte Arce dem WikiLeaks-Chefredakteur Kristinn Hrafnsson und dem Redakteur Joseph Farrell, "dass er Assange voll unterstützt", sagte das Outlet auf seinem offiziellen Twitter-Account.
Der isländische Hrafnsson seinerseits veröffentlichte im selben sozialen Netzwerk, dass der bolivianische Präsident "seine Stimme denen hinzufügt, die für die Freiheit von Assange kämpfen und die Rücknahme der Anklagen der Vereinigten Staaten (USA) gegen ihn fordert".
"In einem privaten Treffen diskutierte der Präsident heute die schwerwiegenden Au Das Staatsoberhaupt des südamerikanischen Landes sagte seinerseits zu dem Zitat: "Wir sind uns einig, dass eine der Grundlagen der Demokratie darin besteht, das Recht, die Wahrheit zu sagen, nicht zu verurteilen, wie es leider mit dem Journalisten Julian Assange geschieht. Wir hoffen, dass seine ungerechte Verfolgung bald enden wird. "Auswirkungen auf die Pressefreiheit, wenn Julian an die USA ausgeliefert wird."
Am 17. Juni genehmigte die Innenministerin des Vereinigten Königreichs, Priti Patel, die Auslieferung von Assange an die Vereinigten Staaten, wo er zu 175 Jahren Gefängnis verurteilt werden könnte.
Washington fordert Assanges Auslieferung aus dem Vereinigten Königreich, wo der australische Journalist seit 2019 inhaftiert ist, um ihn wegen 17 mutmaßlicher Verbrechen unter Verstoß gegen das Spionagegesetz von 1917 und eines des Eindringens in Computer vor Gericht zu stellen.
Die Vorwürfe beziehen sich auf den Zugang zu und die Veröffentlichung von Militärberichten über den Irak, Afghanistan und die illegale Basis in Guantánamo sowie diplomatische Berichte, die Kriegsverbrechen und andere Missbräuche von US-Beamten und Behörden aufdecken.
Quelle: teleSUR v.18.12.2022




Info über Peru
- Verstoß gegen Meinungsfreiheit und Gewährung rechtlichen Beistand
Sie verurteilen, dass die peruanische Polizei beabsichtigt, inhaftierte Bauern als Terroristen zu beschuldigen.
Eine wachsende Zahl von Menschen versammelt sich in der Nähe des Bauernbundes aus Solidarität mit den Gefangenen.
Insgesamt 26 Menschen, hauptsächlich Bauern, befanden sich zu Beginn des Samstagabends noch im Hauptquartier des peruanischen Bauernbundes in Lima (Hauptstadt), das in den Morgenstunden von der peruanischen Polizei an einem weiteren Tag der Repression gegen Volksmobilisierungen durchsucht wurde.
Obwohl Polizeibeamte das Gelände umzingelt halten, konzentrierten sich im Laufe der Stunden vermehrt Demonstranten in der Nähe des Bundes, um die Inhaftierten zu unterstützen und ihre Freilassung zu fordern.
Die Gemeindemitglieder forderten, dass die Uniformierten die Schikanen gegen die Bauern einstellen und sie nicht als Terroristen behandeln, da sie in die peruanische Hauptstadt gekommen sind, um friedlich den Rücktritt von Präsidentin Dina Boluarte, die Schließung des Kongresses, die Abhaltung von Wahlen und die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung zu fordern.
Am Samstagmorgen durchsuchte die Polizei ohne Gerichtsbeschluss das Gebäude und verhaftete Bauern aus indigenen Gemeinschaften, Quechua, die dort die Nacht verbrachten.
Die Bauern waren aus der Region Apurimac (Mitte-Süd) nach Lima gereist, um sich den Protesten anzuschließen.
Die Agenten behandelten sie nicht nur, als wären sie Terroristen, sondern hinderten Anwälte, die versuchten, den Bauern Rechtsbeistand zu leisten, daran, das Gelände der Konföderation zu betreten. Außerdem verhinderten sie stundenlang, dass Lebensmittel bereitgestellt wurden.
https://twitter.com/i/status/1604155526815924226
Für die Razzia benutzte die Polizei die Dircote (Direktion gegen Terrorismus). Über soziale Netzwerke und digitale Medien wurde berichtet, dass Dircote-Agenten versuchten, Macheten und scharfe Gegenstände zu platzieren, um sie als Anstifter von Gewalt und Terroristen darzustellen und so Proteste zu kriminalisieren.
Der Anwalt der Nationalen Menschenrechtskommission (CNDHH), Mar Pérez, gab bekannt, dass die Agenten Macheten platziert haben, die noch die Etiketten behalten und es ihnen ermöglichen, zu wissen, dass sie vor Stunden auf Märkten in Lima gekauft wurden.
An diesem Tag durchsuchte die Polizei auch das Hauptquartier der politischen Partei Nuevo Perú, das an das Gelände des Bauernbundes angrenzt.
Quelle: teleSUR v.18.12.2022

Historische Betrachtung über Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 17.12.2022, Seite 3 (Beilage) / Wochenendbeilage
Die offizielle Ideologie des Westens
Verdrängung und Bagatellisierung des Genozids an den Indigenen Nordamerikas und der Versklavung der Schwarzen ist der Ursprungsmythos der »ältesten Demokratie«. Eine Analyse von Domenico Losurdo
Domenico Losurdo: Die Sprache des Imperiums. Ein historisch-philosophischer Leitfaden. Papyrossa-Verlag, Köln 2011, Seiten 304–311
Wir danken dem Verlag für die freundliche Genehmigung zum Abdruck
Mit Bezug auf diejenigen, die, mehr oder weniger explizit, das Grauen von Auschwitz und der »Endlösung«, d. h. des systematischen Versuchs, ein ganzes Volk, Frauen und Kinder inbegriffen, auszurotten, abstreiten möchten, spricht man oft von »Negationismus«. Ausgehend von der Gleichstellung von Nazismus und Kommunismus, dem zentralen Dogma des historischen Revisionismus, das von der herrschenden Ideologie wohlwollend und mit Begeisterung aufgenommen wurde, wird dieser Begriff manchmal benutzt, um diejenigen anzuklagen, die sich weigern, die Geschichte der kommunistischen Bewegung zu kriminalisieren; denn diese Bewegung hat sich gegen den »Holocaust« des Ersten Weltkriegs aufgelehnt – den Ausdruck findet man gelegentlich in der damaligen Publizistik – und hat, um die heute von nicht wenigen Historikern benutzte Sprache zu verwenden, die »Holocausts« verurteilt und bekämpft, die die koloniale Expansion und Herrschaft kennzeichnen. Nur ganz selten ist die Publizistik als »negationistisch« abgestempelt worden, die sich bemüht, die kolonialen »Holocausts« zu bestreiten oder zu verdrängen (wenn nicht geradewegs zu rechtfertigen).
Dennoch zeigt sich in diesem letzten Fall der »Negationismus« mit besonderer Deutlichkeit. Zunächst wird in den Vereinigten Staaten zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhundert der Genozid an den Indianern oft und ausdrücklich theoretisch begründet. Wir kennen die maßgeblichen Politiker und Ideologen, nach denen das Schicksal der »dekadenten Rassen« besiegelt ist; für sie zeichnet sich unaufhaltsam die »vollständige Endlösung« ab. (…)
Wenn wir der Verdrängung beziehungsweise Verklärung des von den Rothäuten erlittenen Genozids die Verdrängung und Bagatellisierung der jahrhundertelangen Sklaverei der Schwarzen hinzufügen, so können wir wohl sagen, dass »Negationismus« die offizielle Ideologie ist, was die kolonialen Opfer des Westens betrifft. Der »Negationismus« der von den Indianern und Afroamerikanern erlittenen Tragödie (ist) ein wesentlicher Bestandteil des Ursprungsmythos der Vereinigten Staaten, die sich als »die älteste Demokratie der Welt« nur dann selbst verherrlichen können, wenn sie das Schicksal für irrelevant halten, das sie der Masse derjenigen vorbehalten haben, die jahrhundertelang vom Herrenvolk ausgeschlossen, unterdrückt oder ausgerottet worden sind. (…)
Der herrschenden Ideologie zufolge charakterisiert die Behauptung der selbständigen Würde des Individuums und die sich daraus ergebende Ablehnung des Organizismus beziehungsweise Essentialismus die Geschichte des Westens und definiert seine Vortrefflichkeit und Überlegenheit im Vergleich zu den anderen Kulturen. Doch diese Selbstverherrlichung geht zwanglos über die makroskopische Tatsache hinweg, dass jahrhundertelang in der nordamerikanischen Republik und in den europäischen Kolonien das Schicksal eines Individuums von Anfang bis Ende durch seine Rassenzugehörigkeit bestimmt war, die eine unüberwindbare Barriere zwischen der weißen Herrenrasse und den farbigen Kolonialvölkern errichtete. (…)
Diese Tendenz zeigt sich ab und zu auch bei (Hannah) Arendt (1906–1975, deutsch-US-amerikanische Philosophin, Autorin von »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft«, 1951, jW), selbst wenn sie dem Grauen des Imperialismus den zweiten Teil ihres wichtigsten Buches gewidmet hat. Im dritten Teil, der sich mit dem Totalitarismus im eigentlichen Sinn beschäftigt, wird behauptet, die philosophische Voraussetzung dieses politischen Regimes sei der für den Kommunismus und den Nazismus typische Glaube an unabwendbare Gesetze des historischen Prozesses, denen man die moralischen Normen und Skrupel opfern dürfe und müsse. Die hier ins Auge gefasste Auffassung kennzeichnet zutiefst die koloniale Expansion des Westens und besonders seines Führungslandes, das davon überzeugt ist, dass sein Triumphmarsch von einem »Manifest Destiny – einer offenkundigen Bestimmung«, von einer von der Vorsehung bestimmten Mission, von einem göttlichen Plan angespornt wird, dem Widerstand zu leisten, gotteslästerlich und weltfremder Idealismus wäre. Doch wird diese Geschichtsphilosophie/-theologie, die die Tragödie der nach und nach vom Westen überrollten Völker besiegelt hat, völlig ignoriert. In einem späteren Buch (»Über die Revolution«, 1963) stellt Arendt die gute nordamerikanische, im Namen der Freiheit durchgeführten Revolution positiv der bösen Französischen Revolution entgegen: Es ist offensichtlich, dass bei diesem Schwarz-Weiß-Vergleich die Deportation und die Dezimation der Rothäute sowie die Sklaverei der Schwarzen, von der ersten mächtig vorangetrieben und von der zweiten abgeschafft, keine Rolle mehr spielen.
Quelle: junge Welt v.17.12.2022/ JOHN ANGELILLO/imago images/UPI Photo
Der weiße Mann hoch zu Ross, ein Indigener und ein Afrikaner dürfen flankieren: Bronzestatue des ehemaligen Präsidenten Theodore Roosevelt am Amerikanischen Museum für Naturgeschichte in New York City

Menschrechte der indigenen Bevölkerung
Kolumbianische Arhuaco-Indianer fordern Anerkennung von Cabildo
Sie weisen darauf hin, dass der Staat ihre Probleme, wie Zugang zu Gesundheit, Bildung und anderem, nicht gelöst hat.
Organisierte Gruppen kolumbianischer Arhuaco-Indianer sind an diesem Mittwoch auf der gestohlenen Brücke von Valledupar stationiert, die die Hauptstadt des Departements Cesar mit ihrem Pendant in La Guajira verbindet.
Laut seinem Sprecher Norey Quigua Izquierdo "mobilisiert das Volk von Arhuaco, weil die Regierung sich mehr als sieben Monate nach der Wahl unseres Cabildo-Gouverneurs weigert, die entsprechende Registrierung auszustellen, als hätten wir in Kolumbien einen Präsidenten gewählt und hätten nicht die Erklärung des Nationalen Wahlrates."
Angesichts dieser Situation forderten die indigenen Völker ein dringendes Treffen mit dem Innenminister oder mit Präsident Gustavo Petro, da diese Situation sie daran gehindert hat, verschiedene staatliche Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.
In diesem Sinne prangerte Quigua an, dass "das Volk von Arhuaco verletzt wird, weil Grundrechte des Volkes verletzt werden, wie Zugang zu Gesundheit, Bildung, wir haben viele junge Menschen, die, weil sie keinen Gouverneursrat haben, keinen Zugang zu höherer Bildung hatten, nicht in der Lage waren, dem Gesundheitssystem beizutreten und andere, die nicht in der Lage waren, ihre militärische Situation zu definieren. "
Um die Wahl des Gouverneurs des Arhuaco-Volkes, Zarwawiko Torres, zu würdigen, führen die Demonstranten Blockaden in einem der Haupteingänge der Hauptstadt Cesar durch, der mit der Straße verbunden ist, die zur Gemeinde San Juan und anderen Gebieten von La Guajira führt.
Die Ankunft der Demonstranten erfolgte ab dem Nachmittag dieses Dienstags, die mehrere Stunden von den Höhen der Sierra Nevada de Santa Marta zurücklegten.
Die Arhuaca-Gemeinden waren mit internen Konflikten über die Wahl des Cabildo und des Gouverneurs konfrontiert, einschließlich der Entscheidung, diesen Protest abzuhalten.
Quelle: teleSUR v.14.12.2022

Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 14.12.2022, Seite 6 / Ausland
MENSCHENRECHTE EU
Wie gegen die Mafia
Italien: Anarchist protestiert mit Hungerstreik gegen seine extremen Isolationshaftbedingungen
Von Fabio Angelelli
Am 8. Dezember erschien auf der Webseite Indymedia das Bekennerschreiben für den eine Woche zuvor verübten Brandanschlag auf das Auto des ersten italienischen Botschaftsrats in Athen: »Genosse Cospito, egal, wie sehr sie versuchen, Dich zu begraben, wir werden Dich nie vergessen«, hieß es da. Gemeint war der italienische Anarchist Alfredo Cospito, der sich seit dem 20. Oktober im Gefängnis von Bancali (Sardinien) im Hungerstreik befindet, um gegen seine Isolationshaftbedingungen zu kämpfen.
Dem Anschlag in Athen war eine Reihe von Aktionen zur Solidarität vorangegangen. Cospitos Hungerstreik löste in ganz Europa eine Mobilisierungskampagne aus. Allein in Berlin gab es im vergangenen Monat eine Verkehrsblockade, eine Demonstration vor der italienischen Botschaft sowie Störaktionen an der Universität und am Institut für italienische Kultur, um das Ende seiner Isolationshaft zu fordern.
Cospito steht unter dem »41-bis«-Gefängnisregime, das die härtesten Haftbedingungen im italienischen Strafvollzugsgesetz vorsieht. Es wird vor allem gegen Mafiabosse verhängt, um sie von der Kommunikation nach außen abzuschneiden. Inhaftierte dürfen weder lesen noch schreiben oder Briefe empfangen; Familienbesuche werden per Video überwacht und auf eine Stunde pro Monat eingeschränkt; Hofgang ist nur auf wenigen Quadratmetern möglich mit hohen Wänden und einem Drahtgitter über dem Kopf. Eine »grausame, unmenschliche und erniedrigende« Behandlung, so definierte bereits 2003 Amnesty International diese Form der Isolationshaft.
In Italien ist Cospito der erste Anarchist unter dieser Gefängnisregime. Er wurde 2012 verhaftet und zunächst in einer Hochsicherheitsabteilung eingesperrt, weil er in dem Jahr den Manager eines Atomkonzerns ins Bein geschossen haben soll. Zur Aktion bekannte sich die Informelle Anarchistische Föderation (Federazione Anarchica Informale, FAI), ein Zusammenschluss von horizontal organisierten, miteinander nicht in Verbindung stehenden insurrektionalistischen Aktionsgruppen. 2016 wurde Cospito außerdem ohne nennenswerte Beweise beschuldigt, 2006 zusammen mit seiner Partnerin Anna Beniamino (die sich derzeit ebenfalls im Hungerstreik befindet) einen Anschlag auf eine Carabinieri-Kaserne verübt zu haben: Sie hätten zwei leichte Sprengsätze in Müllcontainern plaziert und nachts gezündet. Niemand wurde verletzt. Staatsanwaltschaft und Gerichte der ersten und zweiten Instanz gingen jedoch hart vor, sprachen von einem »Massaker gegen die öffentliche Sicherheit« und verurteilten ihn zu 20 Jahren Gefängnis. Zur Begründung erklärten sie, die FAI – per Definition informell und nicht hierarchisch – sei eine hierarchische kriminelle Vereinigung, die von Cospito geleitet würde.
Aus dem Hochsicherheitstrakt schrieb er weiterhin öffentliche Beiträge, Briefe, Artikel und arbeitete an zwei Büchern über die Geschichte der Anarchie. Im April 2022 kam dann der Erlass des Justizministeriums, mit dem er in die Isolationshaft geschickt wurde. Offiziell, um zu verhindern, dass er als vermeintlicher Kopf der FAI mit ihren Mitgliedern kommuniziert. Im Juli befand der Oberste Gerichtshof dann, der Bombenanschlag von 2006 sei nach Artikel 285 vom Strafgesetzbuch als »Massaker gegen den Staat« einzustufen. Dieser Artikel war nicht einmal bei den Bombenanschlägen der Mafia, die in den 1990er Jahren mit kiloweise TNT Dutzende von Opfern forderten, angewandt worden.
Dass dies nun im Fall Cospitos geschieht, scheint ein eindeutiges Zeichen zu sein. In einem öffentlichen Appell, der im Oktober von zwanzig Anwälten verfasst und von vielen weiteren unterzeichnet wurde, hieß es, das Urteil sei im Zusammenhang mit der allgemeinen Verschärfung der Repression gegen die anarchistische Bewegung in Italien zu verstehen. Die italienische Justiz würde ein »Feindrecht« auf als gefährlich eingestufte Personen anwenden.
So auch bei Cospito. Denn laut Urteil des Obersten Gerichtshofs soll nun seine Strafe neu berechnet werden. Zu prüfen wäre noch, ob mildernde Umstände bestehen. Sollte das der Fall sein, wird Cospito zu 30 Jahren verurteilt. Falls nicht, erwartet ihn lebenslanger Freiheitsentzug ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung – eine Strafe, die auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als unmenschlich betrachtet wird. Cospito kündigte derweil bei seiner letzten Anhörung am 5. Dezember an, er wolle mit seinem Hungerstreik »bis zu seinem letzten Atemzug« weitermachen.
Quelle: junge Welt v. 14.12.2022/ Matteo Nardone/Pacific Press Agency/imago
Soliproteste in Rom für Cospito

USA verstoßen gegen Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 18.11.2022, Seite 6 / Ausland
FREE LEONARD PELTIER!
Gekommen, um zu befreien
USA: Marsch für Gerechtigkeit für indigenen politischen Gefangenen Leonard Peltier erreicht Washington
Von Jürgen Heiser
Besteht die Möglichkeit, dass der indigene politische Gefangene Leonard Peltier doch in absehbarer Zeit freigelassen wird? Diese Frage treibt die Mitglieder des American Indian Movement (AIM) um, die nach einer Meldung des US-Nachrichtenportals Native News Online seit Wochenbeginn »in Washington, D. C. zu einer Reihe von Gesprächen mit Vertretern des US-Justizministeriums zusammentreffen, um Peltiers Begnadigung zu erreichen«.
Ausgangspunkt ist der »Leonard Peltier’s Walk to Justice«, der am vergangenen Sonntag die Hauptstadt Washington erreichte und mit einer Kundgebung am historischen Lincoln Memorial seinen Abschluss fand. Am Ende waren es gut 2.000 Aktivistinnen und Aktivisten, die den mehr als 1.100 Meilen langen und durch acht US-Bundesstaaten führenden »Marsch für Gerechtigkeit« zu einem beeindruckenden Erfolg für die Solidaritätsbewegung mit dem seit fast 47 Jahren inhaftierten AIM-Veteranen machten. Mit einem Meer von Transparenten, Stammesinsignien und »Free Leonard Peltier« skandierend absolvierten die Teilnehmer am Sonntag die letzte Meile ihres Marsches vom Washington Monument zum Lincoln Memorial.
Aufgerufen zu dem auf 15 Wochen angelegten Solidaritätsmarsch hatte der Große Rat des AIM. Der Auftakt fand am 31. August in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota statt, um die Forderung nach Freilassung des AIM-Aktivisten Peltier in den Tagen nach den US-Zwischenwahlen bis an den Regierungssitz von US-Präsident Joseph Biden zu tragen.
Der »Walk to Justice« begann in Minneapolis, weil AIM in der »Stadt des Wassers«, wie sie in der Dakota-Sprache heißt, 1968 von 250 Indigenen gegründet worden war. Die Idee für den Marsch hatte schon vor Jahren die AIM-Aktivistin Rachel Thunder gehabt. Ihre »lebhaften Träume« seien der Ursprung gewesen, so Thunder auf der Abschlusskundgebung. Darin habe sie Peltier in seiner Gefängniszelle gesehen, wie er sich Sorgen machte, ob er je freikäme. »Sorge dich nicht, Leonard, AIM kommt, um dich zu befreien«, rief Thunder am Sonntag, an ihn adressiert. »Wir sind gerade 1.103 Meilen für unseren Ältesten Leonard Peltier gelaufen«, so die Organisatorin. »Wir sind diese Meilen für unser Volk marschiert, für Gerechtigkeit für unser Volk«, betonte sie. »Erst wenn Leonard frei ist, sind wir alle frei!«
Peltier war 1977 wegen Beihilfe zum Mord an zwei FBI-Agenten im Pine Ridge Reservat zu »zwei aufeinanderfolgenden lebenslangen Haftstrafen« verurteilt worden, was die Freilassung des heute 78jährigen noch zu Lebzeiten ausschließen sollte. Er ist heute im Bundesgefängnis in Coleman (Florida) inhaftiert. Amnesty International betrachtet Peltier schon lange als politischen Gefangenen und stellte wie andere Rechtsbeobachter fest, dass seine Verurteilung von Manipulationen seitens der Staatsanwaltschaft geprägt war.
»Leonard Peltier ist der am längsten inhaftierte indigene politische Gefangene der Vereinigten Staaten«, sagte der Schriftsteller und Aktivist Nick Estes, Mitbegründer der indigenen Widerstandsgruppe »The Red Nation«, auf der Kundgebung. »Er hat Covid überlebt, er ist bei schlechter Gesundheit, und er verdient es, bei seinem Volk zu sein«, so Estes, der bereits im Mai eine umfassende Untersuchung des US-Kongresses über den Tod indigener Aktivisten im Pine Ridge Reservat verlangt hatte, wo im Juni 1975 die Schießerei stattfand, die später zu Peltiers Verhaftung führte.
Bei der Kundgebung verwies Estes darauf, dass »Juristen, die Peltier ins Gefängnis gebracht haben, heute hier mit uns marschieren und fordern, dass der Kongress und Präsident Biden etwas unternehmen«. Gemeint war James Reynolds, einer der ehemaligen US-Bezirksstaatsanwälte, die Peltier verurteilt hatten. Auch er sprach auf der Kundgebung. Er halte es für seine »Pflicht als ehemaliger Staatsanwalt, dafür zu sorgen, dass Leonard Gerechtigkeit widerfährt«, erklärte Reynolds vor der Menge. »Denn an diesem Punkt ist genug genug. Gerechtigkeit bedeutet an diesem Punkt Mitgefühl für Leonard.«
Der US-Präsident müsse Peltier Gnade gewähren«, forderte auch Kevin H. Sharp, früherer US-Bezirksrichter und einer der Anwälte, die Peltier derzeit vertreten. »Unterschreiben Sie das Stück Papier. Es muss ein Ende haben, Mr. President!«
Quelle: junge Welt v.18.11.2022/Bild Holger Zimmer
»Erst wenn Leonard frei ist, sind wir alle frei!«: Demo am Sonntag in Washington

Verstoß gegen Menschenrechte durch die USA
us: Ausgabe vom 17.10.2022, Seite 6 / Ausland
FREE LEONARD PELTIER!
20 Meilen pro Tag
American Indian Movement marschiert durch USA und fordert Freilassung von Leonard Peltier
Von Jürgen Heiser
In den USA sieht sich Präsident Joseph Biden zunehmend mit der Forderung nach Freilassung des indigenen Bürgerrechtlers und politischen Gefangenen Leonard Peltier konfrontiert. Die Europatour der Native Americans (siehe jW vom 14. Oktober) hat derzeit in den USA im »Leonard Peltier’s Walk to Justice« ihre kämpferische Entsprechung. Am 31. August 2022 hatte das American Indian Movement (AIM) mit einer Auftaktkundgebung im Cedar Field Park in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota den auf 15 Wochen angelegten Solidaritätsmarsch für den AIM-Aktivisten Peltier gestartet. Ziel des 1.100 Meilen langen Marsches durch acht US-Bundesstaaten ist die Hauptstadt Washington, D. C. Der bis dahin durch viele Unterstützer angewachsene Protestzug soll nach letzten Informationen am 9. November, einen Tag nach den US-Zwischenwahlen, das politische Zentrum Washingtons erreichen.
Frank Paro, der Vorsitzende des Großen Rates des AIM, erklärte in der afroamerikanischen Zeitung Los Angeles Sentinel (LAS) am 11. August den Zweck des Marsches: Es gehe darum, »das Bewusstsein für den Fall von Leonard Peltier zu schärfen, der 1977 zu Unrecht verurteilt wurde«. Peltiers Anwälte hätten Präsident Biden wiederholt gebeten, ihren Mandanten zu begnadigen, »damit er nicht im Gefängnis für ein Verbrechen stirbt, das er nicht begangen hat«.
Nach rund 500 Meilen, also knapp der Hälfte der Gesamtstrecke, waren die Marschierenden am 10. Oktober, dem »Indigenous Peoples’ Day«, in Ohio eingetroffen. Rachel Thunder vom Organisationsteam erklärte gegenüber dem Onlineportal Native News Online, der Marsch und die Gebete für Peltier seien bislang »bewegend, schwer und heilsam« gewesen. Sie seien »jeden Tag ab fünf Uhr morgens auf den Beinen, um mindestens 20 Meilen pro Tag zu schaffen«. AIM fordere Gerechtigkeit für Peltier »und Gerechtigkeit für unser Volk, die Ureinwohner von Turtle Island«.
Peltier ist am 12. September im 46. Jahr seiner Haft 78 Jahre alt geworden. Weltweit wird der inzwischen durch die Haft schwer erkrankte Bürgerrechtler als politischer Gefangener anerkannt, der nur deshalb immer noch hinter Gittern ausharren muss, weil die US-Justiz nicht nur die Beweise für seine Unschuld unterdrückt, sondern rechtswidrig seine Freilassung zur Bewährung verhindert. Auch vom präsidialen Gnadenrecht wurde bislang kein Gebrauch gemacht. So beugte sich der frühere US-Präsident William Clinton im Januar 2001 dem Druck vor dem Weißen Haus aufmarschierter Agenten der US-Bundespolizei FBI und schreckte nach ursprünglich positiven Anzeichen letztlich vor der Begnadigung Peltiers als eine seiner letzten Amtshandlungen zurück.
Auch Expräsident Barack Obama überging Peltier, obwohl der pensionierte US-Staatsanwalt James Reynolds, der eine Schlüsselrolle im Gerichtsverfahren gegen den Bürgerrechtler gespielt hatte, Obama um die Begnadigung gebeten hatte. Peltier sei »zu Unrecht für die Ermordung von zwei FBI-Agenten verurteilt worden«, weshalb seine Begnadigung »unter Berücksichtigung der Gesamtheit aller damit verbundenen Aspekte im besten Interesse der Gerechtigkeit« sei, so Reynolds im Bittbrief an Obama im Januar 2017.
Diese Tatsachen soll der »Marsch für Gerechtigkeit« nun auf Kundgebungen in Erinnerung rufen, um schließlich in Washington die Regierung Biden direkt mit der Forderung nach Freilassung Peltiers zu konfrontieren. Auch das Nationale Komitee der Demokratischen Partei macht Druck: Seit Peltiers Geburtstag liegt öffentlich eine einstimmig verabschiedete Resolution des Entschließungsausschusses vor: Der Präsident möge »seine Befugnisse nutzen, um die Freilassung von Personen zu erreichen, die übermäßig lange Haftstrafen verbüßen«. Für einen solchen Akt der Milde sei Peltier ein »idealer Kandidat«. Es gebe dafür »überwältigende öffentliche Unterstützung angesichts der verfassungsrechtlichen Probleme, die seinem Strafverfahren zugrunde liegen, seiner Situation als älterer Häftling sowie der Tatsache, dass er ein indigener Amerikaner ist, die häufiger unter medizinischer Ungleichbehandlung leiden«, so die Resolution.
Quelle: junge Welt v.17.10.2022/ Adolphe Pierre-Louis/ZUMA Wire/imago images
Solidarität versiegt nicht: Protest vor dem Bundesbezirksgericht in Albuquerque (7.2.2022)

Verstoß gegen Menschenrechte
„Willkommen in Guantanamo!“ (II)
Amnesty International wirft Lettland bei der Flüchtlingsabwehr an der EU-Außengrenze Folter, Verschwindenlassen und Rassismus vor. Die EU deckt das lettische Vorgehen.
13
OKT
2022
RIGA (Eigener Bericht) – Amnesty International erhebt zum wiederholten Mal schwere Vorwürfe wegen der brutalen Abwehr von Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen – diesmal gegenüber Lettland. Wie die Menschenrechtsorganisation in einer soeben veröffentlichten Untersuchung berichtet, werden dort Flüchtlinge nicht nur völkerrechtswidrig pauschal zurückgeschoben – oft von vermummten, nicht gekennzeichneten „Kommandos“ unter Anwendung von brutaler Gewalt. Viele werden zudem in Zelten ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt interniert und dort mit Schlägen, Tritten und Elektroschockern malträtiert, die etwa auch gegen Genitalien eingesetzt werden – klare Folter, konstatiert Amnesty. Das lettische Vorgehen ähnelt damit demjenigen der litauischen und der polnischen Behörden stark, die Flüchtlinge mit nahezu identischen Methoden behandeln. Dabei gilt das alles lediglich für Flüchtlinge von außerhalb Europas, nicht jedoch für weiße Europäer aus der Ukraine, die in Lettland – wie auch in Litauen oder in Polen – angemessen empfangen werden. Mit Blick darauf stuft Amnesty die Repression der lettischen Grenzbehörden gegen nichtweiße Flüchtlinge aus außereuropäischen Staaten explizit als rassistisch ein.
Hilfe für weiße Europäer
In ihrem neu vorgelegten Bericht über den Umgang mit Flüchtlingen in Lettland zieht die Menschenrechtsorganisation Amnesty International einen recht naheliegenden Vergleich, der in Europa von offiziellen Stellen gerne beschwiegen wird, in den außereuropäischen Herkunftsländern von Flüchtlingen aber längst ins Allgemeinbewusstsein eingedrungen ist: den Vergleich mit der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine. Diese seien in der lettischen Hauptstadt Riga „mit warmem Essen, Kleidung und Unterkunft begrüßt worden, in geordnete Registrierungsverfahren geleitet oder in die Lage versetzt worden, sicher in andere Länder Europas weiterzureisen“, hält Amnesty fest.[1] Dies entspricht ganz dem Vorgehen anderer europäischer Staaten innerhalb und außerhalb der EU. Es belegt, dass auch in Europa eine angemessene Behandlung von Flüchtlingen nicht nur grundsätzlich möglich, sondern auch binnen kürzester Frist praktisch realisierbar ist. Lettland mit seinen kaum zwei Millionen Einwohnern habe es vermocht, innerhalb weniger Monate über 35.000 Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen (Stand: 26. Juli 2022) und einer noch deutlich höheren Zahl den Transit in Richtung EU zu ermöglichen, konstatiert Amnesty. Die Unterstützung für ukrainische Flüchtlinge sei in einem am 3. März 2022 beschlossenen Gesetz sogar explizit vorgeschrieben worden.
Abwehr nichtweißer Nichteuropäer
In krassem Kontrast dazu steht die brutale Abwehr von Flüchtlingen etwa aus Syrien oder dem Irak, die seit dem Sommer 2021 über Belarus in die EU einzureisen versuchten – nach Polen, Litauen oder eben auch Lettland. Amnesty nennt dazu Zahlen. Demnach sahen sich die lettischen Behörden in der Lage, zwischen August 2021 und dem 25. Mai 2022 exakt 156 Flüchtlinge von außerhalb Europas ins Land zu lassen – aus „humanitären Gründen“. 508 Flüchtlinge wurden zwischen August 2021 und April 2022 wegen – tatsächlichen oder angeblichen – illegalen Grenzübertritts festgenommen und interniert. Schon am 10. August 2021 hatte Riga den Notstand ausgerufen – aufgrund eines angeblich überwältigenden Andrangs von Flüchtlingen an der lettisch-belarussischen Grenze. Nach genauen Angaben befragt, gaben die lettischen Behörden an, von August 2021 bis zum 25. Mai 2022 habe man 6.676 Personen an der Grenze abweisen müssen; das wären wenig mehr als 20 pro Tag – ungewöhnlich wenig, um einen angeblichen Notstand zu begründen. Detaillierte Recherchen ergaben allerdings, dass die Behörden jeden Einreiseversuch mitzählten – auch diejenigen von Personen, die zum Teil mehr als zwanzigmal vergeblich ins Land zu gelangen suchten. Die tatsächliche Zahl der abgewiesenen Personen wird laut Amnesty auf vermutlich nicht mehr als 250 geschätzt.
Im Schnee, von Wölfen bedroht
Der Notstand an der Grenze, den Riga am 10. August dieses Jahres zum vierten Mal verlängert hat – er gilt nun vorerst bis zum 10. November –, ist insofern von Bedeutung, als er es den Grenzbehörden erlaubt, Einreisewillige pauschal über die Grenze zurückzuschieben und ihnen das Stellen eines Asylantrags zu verweigern; beides bricht offen das Völkerrecht. Tatsächlich drängen lettische Grenzbeamte und andere Repressionskräfte Flüchtlinge mit großer Konsequenz und regelmäßig auch mit brutaler Gewalt über die Grenze nach Belarus zurück. Dabei kommen auch bewaffnete Sondereinheiten zum Einsatz, die vollständig vermummt und in schwarzer Kleidung auftreten und deren genauer Status unklar ist. Sie sind offenkundig Teil der staatlichen Repressionsbehörden und unterstehen den Grenzbehörden, sind aber nicht weiter identifizierbar und werden allgemein „Kommandos“ genannt. Nach Angaben von Amnesty werden sie für die meisten Gewalttaten gegen Flüchtlinge an der Grenze verantwortlich gemacht. Sie sorgen zudem mit dafür, dass abgewiesene Flüchtlinge ohne die nötige Versorgung mit Nahrungsmitteln und Medikamenten weitestgehend schutzlos in den Wäldern im Grenzgebiet dahinvegetieren müssen – bei jeglichem Wetter inklusive Regen, Kälte und Schnee, trotz wiederkehrender Bedrohung durch Wölfe und Bären.
Folter, Verschwindenlassen
Eine lettische Besonderheit scheint zu sein, dass Flüchtlinge immer wieder nicht in feste Gebäude, sondern in Zelte im Grenzgebiet gepfercht werden, in denen sie von bewaffnetem Personal festgehalten werden, das ihnen regelmäßig ihre Mobiltelefone wegnimmt; dadurch verlieren sie jeglichen Kontakt zur Außenwelt. Die Zelte entsprechen nicht den dürftigsten sanitären Standards; Toiletten sind nicht vorhanden und werden durch simple Löcher im Boden neben den Zelten ersetzt. Flüchtlinge, die eine gewisse Zeit in den Zelten verbringen mussten, berichten von vollkommen unzureichender Nahrung und brutaler Gewalt. Demnach setzt das Wachpersonal – oft wohl die anonymen, vermummten „Kommandos“ – immer wieder Elektroschocker ein, die auf unterschiedlichste Körperteile gerichtet werden, darunter Genitalien. Auch von Schlägen und Tritten sowie allerlei Formen erniedrigender Gewalt ist die Rede. Amnesty stuft die Gewalttaten zumindest teilweise als offene Folter ein. Zudem urteilt die Menschenrechtsorganisation, wer Menschen in Zelte an unbekannten Orten festhalte und ihnen jegliche Möglichkeit raube, Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen, mache sich eventuell eines Verstoßes gegen die Verbote geheimer Internierung und erzwungenen Verschwindenlassens schuldig.
Tote an der Grenze
Die Zustände an der Außengrenze Lettlands entsprechen im Wesentlichen denjenigen an den Außengrenzen Litauens und Polens, an denen ebenfalls, scheinbar legitimiert durch die Ausrufung eines Notstandes, Flüchtlinge pauschal und unter Einsatz von Gewalt abgewiesen werden. Im Fall Litauens ist dokumentiert, dass Grenzbeamte Flüchtlinge in einen Grenzfluss trieben, in dem sie unter Lebensgefahr brusthohes Wasser durchqueren mussten.[2] Die litauischen Internierungslager für Flüchtlinge sind von Amnesty als „hochgradig militarisiert“ beschrieben worden; die Lebensbedingungen in ihnen kommen, urteilt die Organisation, „nach internationalem wie auch nach EU-Recht Folter und anderen Formen von Misshandlung gleich“. Proteste gegen die katastrophalen Verhältnisse wurden mit Tränengas niedergeschlagen.[3] Ähnlich ist die Lage in Polen, wo zeitweise bis zu 24 Flüchtlinge in acht Quadratmeter große Räume gepfercht wurden; einige, darunter Personen, die vor Folter in ihren Herkunftsstaaten geflohen waren, wurden mit dem Ruf „Willkommen in Guantanamo!“ begrüßt.[4] Nach Angaben einer polnischen Anwältin, die für die Helsinki Foundation for Human Rights in Warschau tätig ist, sind inzwischen nachweislich mindestens 20 Flüchtlinge im polnisch-belarussischen Grenzgebiet zu Tode gekommen, mutmaßlich sogar erheblich mehr.[5] Warm empfangen werden auch in Litauen und in Polen ausschließlich weiße Europäer aus der Ukraine.
Menschenrechte als Kampfinstrument
Wie üblich werden Folter, Verschwindenlassen und offener Rassismus an der Außengrenze der EU auch im Fall Lettlands von Brüssel gedeckt. Auf die Wahrung von Menschenrechten dringt die Union lediglich gegenüber Staaten, die sie dadurch aus politischen Motiven unter Druck setzen will.
[1] Zitate hier und im Folgenden: Amnesty International: Latvia: Return home or never leave the woods. Refugees and migrants arbitrarily detained, beaten and coerced into „voluntary” returns. London, October 2022.
[2] Amnesty International: Lithuania: Forced out or locked up. Refugees and migrants abused and abandoned. London, 27.06.2022.
[3] S. dazu „Willkommen in Guantanamo!”
[4] Amnesty International: Poland: Cruelty not compassion, at Europe’s other borders. London, 11.04.2022.
[5] Poland’s border wall hasn’t stopped the flow of migrants from Belarus. infomigrants.net 22.09.2022.
Quelle: GERMAN-FOREIGN-POLICY.com v.13.10.2022
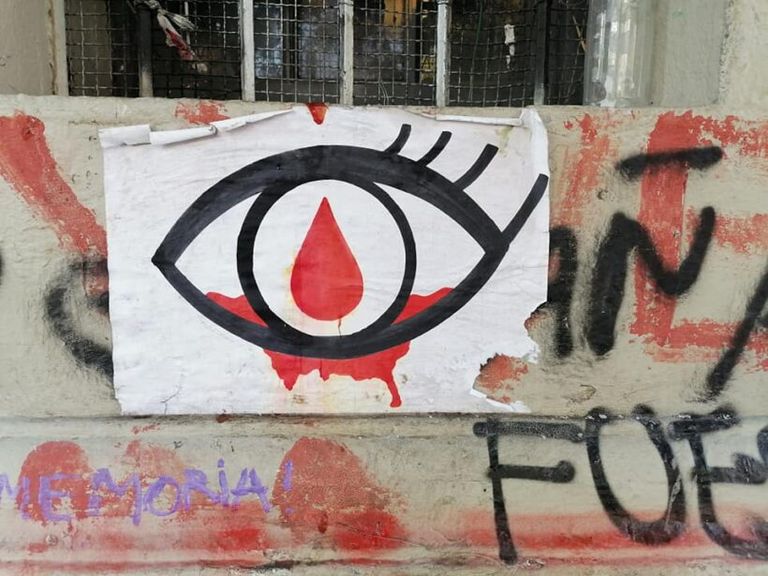
Info über Chile
Opfer von Menschenrechtsverletzungen erhalten Versehrtenrente
(Santiago de Chile, 26. September 2022, pressenza/poonal).- Wie der Staatssekretär des Innenministeriums Manuel Monsalve heute bekanntgab, sollen alle Chileninnen und Chilenen, die im Zuge des Estallido Social Menschenrechtsverletzungen erlitten haben, künftig eine Versehrtenrente erhalten. Der Anspruch wird zuvor vom Menschenrechtsinstitut INDH (Instituto de Derechos Humanos) geprüft. Seit Juni 2022 hat das Innenministerium die Rente bisher in 296 Fällen bewilligt. Das Antragsverfahren ist jedoch langwierig und wird zentral in Santiago durchgeführt. Monsalve versicherte heute, dass alle Menschen, die eine Anspruchsberechtigung nachweisen können, die Renten erhalten werden. Entsprechend der Schwere der Beeinträchtigung liegt die Unterstützungsleistung zwischen 250.000 und 500.000 chilenischen Pesos (etwa 270 bis 530 Euro).
Die Pensión de Gracia
Die Pensión de Gracia ist eine Leistung, die die Lebensqualität von Menschen verbessern soll, die in einer sozial schwachen Situation leben. Sie kann je nach Fall für einen bestimmten Zeitraum oder auf Lebenszeit gewährt werden und wird an Personen gezahlt, die die folgenden Voraussetzungen erfüllen:
– Sie haben sich über ihre persönlichen Pflichten hinaus um das Wohl des Landes verdient gemacht.
– Sie hatten einen Unfall oder sind durch außergewöhnliche Umstände von einer Katastrophe betroffen, die die Gewährung einer Rente rechtfertigen.
– Sie sind aufgrund von Krankheit, Invalidität, Alter o.ä. nicht in der Lage, Lohnarbeit in ausreichendem Umfang zu verrichten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
– Sie sind von anderen besonderen und ordnungsgemäß begründeten Situationen betroffen, die die Gewährung dieser Leistung rechtfertigen.
Quelle: Nachrichtenpool Lateinamerika; Ausgabe September 2022

Info über Venezuela
Venezuela lehnt Bericht über unabhängige Menschenrechtsmission ab.
In einer Erklärung beschreibt die venezolanische Regierung den Bericht der internationalen Mission als Pamphlet.
Die Regierung Venezuelas wies die Anschuldigungen ohne Rechtsgrundlage der sogenannten Internationalen Erkundungsmission "in einer neuen Broschüre zurück, die am 26. September 2022 vor dem Menschenrechtsrat der Organisation der Vereinten Nationen vorgestellt wurde".
In einer Erklärung lehnt Venezuela die politisierte Verwendung der Menschenrechtsfrage als Angriffsmanöver gegen den venezolanischen Staat ab, "als Werkzeug, um die Souveränität jener Staaten zu untergraben, die sich nicht den von einigen Mächten gewünschten Plänen hegemonialer Kontrolle unterwerfen".
"Bei dieser Gelegenheit, durch einen neuen Pseudobericht, ohne die geringste methodische Unterstützung oder direkten Kontakt mit der Realität des Landes, ist beabsichtigt, weiterhin venezolanische Institutionen anzugreifen, als Teil der kriminellen Strategie des Regimewechsels, die von der Regierung der Vereinigten Staaten mit der Komplizenschaft ihrer Satellitenregierungen in der Welt gefördert wird."
Dieser Mechanismus, die Internationale Erkundungsmission, wurde 2019 auf der Grundlage einer fragwürdigen Resolution geschaffen, die von einer kleinen Gruppe von Regierungen mit schweren internen Situationen von Menschenrechtsverletzungen gefördert wurde, erinnert der Text.
Venezuela ist ein demokratischer und sozialer Rechts- und Rechtsstaat, der die Förderung, Achtung und den Schutz der Menschenrechte als übergeordneten Wert seines Rechtssystems und des Handelns seiner Institutionen in voller Übereinstimmung mit seinen internationalen Verpflichtungen in diesem Bereich annimmt.
In der Erklärung bekräftigt Venezuela seine absolute Ignoranz gegenüber dieser Art von parallelen, barbarischen und interventionistischen Mechanismen, die durch seine Verlautbarungen aúpa und ermutigen die extremistischsten Sektoren, in die massive Verletzung der Menschenrechte der Venezolaner und die Destabilisierung des Landes zurückzufallen.
Ebenso warnt die venezolanische Regierung die Befürworter dieser Initiative, dass sie die entsprechenden politischen und diplomatischen Maßnahmen auf bilateraler und multilateraler Ebene gegen jeden Versuch ergreifen wird, das Mandat dieses Aggressionsmechanismus gegen legitime venezolanische Institutionen weiter zu verlängern.
Dies stellt einen klaren Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen, die einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung und das Paket zum Aufbau von Institutionen des Menschenrechtsrats sowie gegen andere einschlägige Instrumente dar.
Die Regierung Venezuelas bestätigt, dass sie weiterhin mit dem Menschenrechtsrat zusammenarbeiten wird, immer auf der Grundlage der strikten Einhaltung der Grundsätze der Objektivität, der Nichtselektivität, der Unparteilichkeit, der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, der Achtung des Multilateralismus und des konstruktiven Dialogs.
Quelle: teleSUR v.26.09.2022

Anzeige wegen Kriegsverbrechen
Aus: Ausgabe vom 13.09.2022, Seite 8 / Inland
UMGANG MIT MENSCHENRECHTEN
»Die Imagekomponente des Angriffs war wichtiger«
Verein Jüdische Stimme zeigt israelische Minister wegen Kriegsverbrechen an. Ein Gespräch mit Wieland Hoban
Interview: Annuschka Eckhardt
Der Verein Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost erstattete am Sonnabend Strafanzeige gegen den israelischen Premierminister Jair Lapid und den Verteidigungsminister Benjamin Gantz wegen Kriegsverbrechen. Warum haben Sie diese Anzeige eingereicht?
Es gibt international, und besonders in Deutschland, eine scheinbar unbegrenzte Akzeptanz in der Politik gegenüber den unzähligen Verstößen Israels gegen das Völkerrecht und die grundlegenden Menschenrechte der Palästinenser. Die erneute Bombardierung des Gazastreifens im August richtete sich offiziell gegen hochrangige Mitglieder des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ), einer militanten Gruppe, die im Gegensatz zur Hamas nicht die Rolle eines politischen Akteurs anstrebt. Es wurden dabei 38 Zivilisten von der israelischen Armee getötet, über die Hälfte davon Frauen und Kinder, und weitere 300 verletzt, teils auf schwerste Weise. Das ist zwar zahlenmäßig weniger als bei vorherigen Operationen, stellt aber einen besonders offensichtlichen Fall eines willkürlichen Militärschlags dar, der als Selbstverteidigung verkauft wurde.
Wie bewerten Sie die Rolle der Bundesrepublik in diesem Fall?
Gerade war Lapid in Deutschland zu Besuch und wurde als enger Freund empfangen, nicht als Kriegsverbrecher. Natürlich ist er nicht der einzige solche Gast, aber kein Land wird so in Schutz genommen wie Israel, und in Deutschland wird israelische Propaganda einfach nachgeplappert. Bei keinem anderen Land wird dies als »Staatsräson« bezeichnet. Berichte von Menschenrechtsorganisationen, etwa Amnesty International und Human Rights Watch, sowie B’Tselem oder Jesch Din in Israel, die Israel Apartheid vorwerfen, werden als einseitig bis antisemitisch abgetan; die deutsche Amnesty-Sektion hat sogar versucht, sich vom Bericht der eigenen Mutterorganisation zu distanzieren. Aufgrund dieser Gesamtlage wollten wir ein Zeichen gegen diese jahrzehntelange Straflosigkeit setzen. Und während Lapid nur für den jüngsten Angriff verantwortlich ist, war Gantz bereits 2014 an einer viel größeren Offensive in Gaza beteiligt, bei der etwa 1.500 Zivilisten getötet wurden.
Lapid behauptete, sein Volk verteidigt zu haben, Gantz beschrieb die Angriffe als »Präventivschlag«. Welche Gründe sehen Sie hinter diesem Militärschlag?
Wie oft bei solchen Handlungen ging es zum Teil darum, Stärke zu zeigen. Es gibt Anfang November in Israel Wahlen, und Militarismus kommt bei der Wählerschaft gut an. Lapid gilt als moderat, und er muss zeigen, dass er ein Mann der Tat ist, damit die rechten Politiker ihn nicht als Weichei darstellen können. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der ehemalige Premierminister Netanjahu ein Comeback wagt, und gerade er wird immer noch für seine Brutalität geliebt. Verteidigungsminister Gantz wiederum hat mit einem Verweis auf Teheran zum Ausdruck gebracht, dass er auch gegen den Iran auszuteilen bereit ist, gerade angesichts dessen Atomverhandlungen mit dem Westen und wohl auch aufgrund der iranischen Unterstützung für PIJ. Meiner Meinung nach war die Imagekomponente des Angriffs aber wichtiger. Das militärische Ziel wurde erreicht, und da palästinensisches Leben in der israelischen Politik nichts wert ist, konnte die Operation als präzise und erfolgreich verkauft werden. Lapid hat die zivilen Verluste zwar kurz als tragisch bedauert, aber lediglich als unvermeidlichen Nebeneffekt einer absolut notwendigen Selbstverteidigung, und deswegen nicht die Verantwortung Israels.
Was verspricht sich die Jüdische Stimme von dieser Strafanzeige?
Natürlich werden die beiden nicht eingesperrt. Aber die Öffentlichkeit muss erneut darauf aufmerksam machen, dass hier wirklich nachweisbare Verbrechen begangen werden. In Deutschland regt man sich über verbale Entgleisungen des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas auf, während es hier um tote Zivilisten geht. Und vielleicht fühlt sich die Elite in Israel sogar ein bisschen unwohl, schließlich achtet man dort sehr auf das Image des Landes, und das Prinzip der universellen Gerichtsbarkeit hat schon manche israelische Politiker von Auslandsreisen abgehalten.
Quelle: junge Welt v.13.09.2022/ Stringer/dpa
Benjamin Gantz (links) und Jair Lapid (Jerusalem, 22.6.2022)
Wieland Hoban ist Vorstandsvorsitzender des Vereins Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost

Verstoß gegen die Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 13.09.2022, Seite 1 / Kapital & Arbeit
EXTREME AUSBEUTUNG
50 Millionen in moderner Sklaverei
Bericht: Anzahl der Menschen weltweit in Zwangsarbeit oder Zwangsehe stark gestiegen
Von Susanne Knütter
Weltweit leben 50 Millionen Menschen in »moderner Sklaverei«. Davon befanden sich 28 Millionen im Jahr 2021 in einem Zwangsarbeitsverhältnis, und 22 Millionen lebten in erzwungenen Ehen, in denen sie vor allem als Hausbedienstete ausgenutzt werden. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Internationale Arbeitsorganisation (ILO), die Organisation für Migration (IOM) und die Walk-Free-Stiftung, die sich gegen Sklaverei engagiert, am Montag in Genf vorlegten. Die Zahl der Menschen in extremen Ausbeutungsverhältnissen ist demnach in den vergangenen fünf Jahren erheblich gestiegen. Im Jahr 2021 befanden sich zehn Millionen Menschen mehr in moderner Sklaverei, verglichen mit den globalen Schätzungen von 2016. Frauen und Kinder sind weiterhin besonders stark gefährdet.
Moderne Sklaverei kommt in fast allen Ländern der Welt vor. Mehr als die Hälfte aller Fälle von Zwangsarbeit und ein Viertel aller Zwangsverheiratungen finden sich in Ländern mit mittleren oder hohen Einkommen. Die meisten Fälle von Zwangsarbeit (86 Prozent) sind im privaten Sektor zu verzeichnen. 23 Prozent davon macht die kommerzielle sexuelle Ausbeutung aus. Fast vier von fünf der von kommerzieller sexueller Zwangsausbeutung Betroffenen sind Frauen oder Mädchen.
Für 14 Prozent der Zwangsarbeiter (3,9 Millionen) ist die Arbeit staatlich verordnet. Mehr als die Hälfte der Betroffenen wird in Gefängnissen für private Interessen ausgebeutet. Die Wahrscheinlichkeit für Arbeitsmigranten, in Zwangsarbeit zu landen, ist dreimal so hoch wie für erwachsene Lohnabhängige ohne Migrationshintergrund. Vor dem Hintergrund betonte António Vitorino, Generaldirektor der IOM, am Montag: Dieser Bericht unterstreiche die »Dringlichkeit, sicherzustellen«, dass die gesamte Migration »sicher, geordnet und regulär« verläuft. Der Bericht fordert entsprechend die Verbesserung und Durchsetzung von Gesetzen und Arbeitsinspektionen, strengere Maßnahmen zur Bekämpfung von Menschenhandel in Unternehmen und Lieferketten, die Ausweitung des Sozialschutzes und die Stärkung des Rechtsschutzes.
Quelle: junge Welt v.13.09.2022/ Molly Crane-Newman/IMAGO/ZUMA Wire
Jeder achte Zwangsarbeiter ist ein Kind. Die Mehrheit von ihnen wird sexuell ausgebeutet
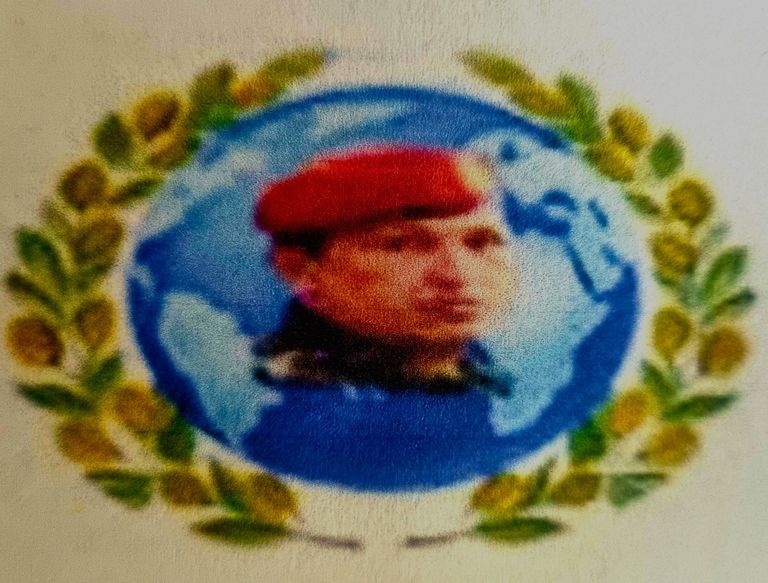
Aktivitäten und Organisationen zur Umsetzung der Menschenrechte
HUGO CHAVEZ INTERNATIONALE STIFTUNG
FÜR FRIEDEN, FREUNDSCHAFT UND SOLIDARITÄT
HCIF-PFS
E-Mail-Adresse: hugochavezfoundation@gmail.com
Öffentliche Pressemitteilung8. September 2022
ERKLÄRUNG ZUM 15.JAHRESTAG DER EASTABLISHMENT DER HUGO CHAVEZ INTERNATIONAL FOUNDATION FOR PEACE, FRIENDSHIP AND SOLIDARITY
AUSSAGE:
Herzliche Grüße an euch alle! Willkommen zu unserem Jubiläum!
Ich erinnere mich noch an den Tag, als ich diese edle Reise auf afrikanischem Boden mit nur einer Handvoll Menschen und ohne Ressourcen begann. Von dort bis heute haben wir eine lange und raue Reise zurückgelegt. Aber wie die verstorbene revolutionäre Ikone Kubas, Fidel Castro, einmal sagte: "Macht Wege, wenn es keinen Weg gibt", so haben wir heute den revolutionären Führer des 20. Jahrhunderts aller Zeiten bestätigt. Wir haben all die Jahre nur gelebt, indem wir Wege geschaffen haben, wenn es schwierig ist, Platz zu machen. Wir standen Schulter an Schulter, mit dem Test der Zeit, und jetzt sind wir stolz auf die Leistungen, die wir bisher gemäß unseren Zielen erzielt haben.
Heute vor fünfzehn Jahren haben wir mit vielen Träumen, Hoffnung und immensem Eifer begonnen und heute feiern wir ein weiteres Jahr der Geburt. Nichts hat sich geändert, außer der Tatsache, dass wir unsere Träume wahr gemacht haben und jetzt neu sind. Das diesjährige Jubiläum gibt uns die Möglichkeit, uns an Erinnerungen zu erinnern und sie wieder zurückzugewinnen.
Wir heißen Sie herzlich willkommen und möchten ihnen allen Respekt zollen, die diesen besonderen Tag mit uns teilen. Es ist richtig zu sagen, dass es keinen Unterschied macht, wohin du in deinem Leben gehst, aber der wichtigste Faktor ist, mit wem du zusammen bist. Es ist uns eine Freude, dass wir heute viele Interessengruppen eingeladen haben, mit uns dieses historische Wahrzeichen zu feiern.
Wir haben diese Organisation, die Hugo Chavez International Foundation for Peace, Friendship and Solidarity (HCIF-PFS), mit Afrikanern aus Sierra Leone, Ghana, Mali, Togo, Liberia, Guinea und Kamerun gegründet und sind heute in 185 Ländern weltweit bekannt. Dank unserer Mitgliedschaft im britischen Global Waste Cleaning Network (GWCN) und dem Segen unseres Allmächtigen. Dies geschah nicht als Überraschung, sondern als Dividende des Engagements für Umwelt, Menschenrechte, demokratische verantwortungsvolle Staatsführung, Forschung und Interessenvertretung.
Das Global Waste Cleaning Network (GWCN) ist eine weltweite Organisation, die sich der Erhaltung und Erhaltung gesunder Ozeane, Küsten, Länder und der Atmosphäre für Mensch und Natur widmet. Durch Forschungs- und Naturschutzprojekte, Aufräumaktionen, Umweltbildung und die Beteiligung an einer Reihe wichtiger internationaler Gremien unternimmt GWCN konkrete Schritte für ein gesünderes Leben.
Zu diesem Zweck ist GWCN bestrebt, die Umwelt zum Wohle der Menschheit zu schützen, zu erhalten und zu verbessern, und zwar durch: den Aufbau eines internationalen Netzwerks aktiver Umweltorganisationen und -spezialisten, die Sensibilisierung für die negativen Auswirkungen von Abfällen auf die Umwelt, die Förderung guter Abfallbewirtschaftungspraktiken und den Beitrag zur Förderung der Forschung in der Abfallwirtschaft.
In all den Jahren, die vergangen sind, haben wir all diese Erfolge und Misserfolge, Feiern und Krisen, alles erlebt. Aber das einzige, was wir nie getan haben, war, die "Niederlage" zu akzeptieren und uns von den Possen der Kritiker mitreißen zu lassen. Dies ist unser Glaube und unser Vertrauen in jeden geprüften Freiwilligen der Hugo Chavez International Foundation for Peace, Friendship and Solidarity, und unser Engagement für die zugrunde liegenden Werte der Stiftung sind die Prinzipien, die uns an den Ort gebracht haben, an dem wir uns befinden. Ich muss allen Freiwilligen gegenüber ehrlich sein, dass diese Reise ohne euch heute nicht so erfolgreich gewesen wäre. Meine Freiwilligen sind immer meine Stärke und mein Rückgrat für die Stiftung.
An diesem glückverheißenden Tag verspreche ich allen Freiwilligen, freundlich und hilfsbereit zu sein, wie es in den letzten 15 Jahren geschehen ist. Ich übersetze mich immer gegen unsere Freiwilligen und erinnere sie daran, dass eine Sache, die sie mir schulden, Vertrauen ist. Dies liegt daran, dass Vertrauen ein Klebstoff ist, der die Beziehungen zusammenhält, und ich weiß, dass ich mein Versprechen erfüllt habe, mit meinen Freiwilligen und Begünstigten transparent zu sein. Und damit verspreche ich, mit all meinen Versprechen und Gelübden voranzukommen.
Für eine erfolgreiche Institution ist es wichtig, dass man anderen vertraut und vertrauenswürdig ist. Ich habe einige zuverlässige, vertrauenswürdige und vorhersehbare Freiwillige in der Stiftung. Diese Freiwilligen können die Stiftung bei jeder Versammlung oder Plattform überall im globalen Dorf vertreten. Ich habe ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse und Bestrebungen meiner Freiwilligen und die Bedürfnisse unserer Begünstigten, und ich engagiere mich für die Erreichung der Ziele der Stiftung.
Zu diesem historischen Anlaß möchte ich alle Freiwilligen der Stiftung grüßen, unsere Öko-Krieger-Helden und Heldinnen, Menschenrechtsverteidiger und Friedensbotschafter, die nicht mehr unter uns sind, einer von früher unter uns und der Welt als Leuchtfeuer der Hoffnung für die machtlosen, verarmten und armen Menschen, die enormstolz gewesen wären, zu sehen, was diese Stiftung ist geworden. El-Commandante Hugo Chavez, unser Mentor und unser Freund-"Sie werden immer in unseren Herzen leben und eine Inspiration für diejenigen sein, die Sie kannten, besonders für diejenigen, die in den frühen Jahren der Bolivarischen Sozialistischen Revolution an Ihrer Seite für ein würdiges Heimatland Venezuela gearbeitet haben.
Die Internationale Hugo Chavez Stiftung für Frieden, Freundschaft und Solidarität
ist eine freiwillige, selbstverwaltete, wohltätige, gewaltfreie, friedliche, nicht-religiöse, unparteiische in der Politik, nicht gemeinschaftsbasierte und eine autorisierte gemeinnützige Nichtregierungsorganisation mit legalem Status. Es wurde am 8. September 2007 in Bamako, Republik Mali, nach umfangreichen Konsultationen und längeren Überlegungen gegründet.
Die Stiftung ist eine enorme Ehre und ein Ausdruck der Liebe für Kommandant Hugo Chavez und bereit, das Erbe des verstorbenen venezolanischen Führers zu verteidigen und zu bewahren. Das Vermächtnis des Kommandanten Hugo Chavez drückt die Freiheit und Würde der Menschheit aus. Die Stiftung wird von Afrika initiiert, von Afrika verwaltet und von Afrika finanziert.
Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich sagen, dass der vor uns liegende Weg herausfordernd sein wird, weil die Unvorhersehbarkeit weiterhin herrschen wird, aber ich werde Sie weiterhin dazu inspirieren, alle Ihre Fähigkeiten zu stärken, um besser zu verstehen.
Ich muss mich noch einmal bei meinen Freiwilligen bedanken, besonders bei denen von mir, für die immense Säule der Unterstützung, die sie sind. Danke, dass du hinter mir stehst und mir hilfst, alle Hindernisse zu bekämpfen, dick und dünn, kämpfend und kämpfend. Ich habe keine Worte, um meine Dankbarkeit für Ihre unermüdliche Unterstützung auszudrücken. Ihr Beitrag ist für mich mehr als nur ein Diamant.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bitte genießen Sie die Feier des 15-jährigen Bestehens unserer Stiftung.
Gelesen von:
(Häuptling) Alimamy Bakarr Sankoh
Internationaler Exekutivdirektor (IED) und Interimspräsident des EZB-Rats
Die Internationale Hugo Chavez Stiftung für Frieden, Freundschaft und Solidarität
HCIF-PFS

Menschenrechte in Zeiten des kolonialen Erbes ?
Die britische Monarchin und ihre "Beziehung" zu Afrika - BBC-Huldigung erhält kritische Kommentare
9 Sep. 2022 22:15 Uhr
Der britische Sender BBC hat die Kommentarfunktion unter einem Tweet deaktiviert, in dem die "langjährigen Beziehungen" von Königin Elisabeth II. zu Afrika gewürdigt wurden. Kommentatoren bezeichneten die Hommage als "Rebranding des Kolonialismus".
Quelle: AFP © ANNA ZIEMINSKI / AFP
Nach dem Tod der britischen Monarchin überschlugen sich Meldungen über ihren Beitrag für eine gerechte Welt. Der afrikanische Zweig der BBC veröffentlichte auf Twitter am Donnerstag die Huldigung ihrer "langjährigen Beziehungen" zu Afrika mit einem viereinhalbminütigen Video, das die Beziehungen von Königin Elisabeth zu Afrika und seinen Staatsoberhäuptern würdigte. Einige Menschen nahmen jedoch Anstoß an dem Beitrag und erklärten, die BBC versuche, dem britischen Kolonialismus ein anderes Image zu verpassen, indem sie die britische Herrschaft über Afrika, die bis ins späte 20. Jahrhundert andauerte, beschönige. 1980 erlangte Simbabwe als letztes afrikanisches Land die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich.
Viele gaben Beispiele dafür, wie afrikanische Freiheitskämpfer im Laufe der Jahre durch ihre britischen Unterdrücker gelitten hätten. Einige Nutzer verwiesen auf den antikolonialen Mau-Mau-Aufstand in Kenia Anfang der 1950er Jahre, wo die lokalen Kikuyu durch die Expansion der weißen Siedler ihrer Lebensgrundlage beraubt wurden und die britische Regierung jahrelang um politische Rechte baten. Dies wurde ihnen jedoch verwehrt, woraufhin es zu Protesten kam und die Briten Militär entsandten. 1,5 Millionen Kenianer wurden in britischen Lagern und stark patrouillierten Dörfern gefangengehalten, wo sie verhungerten und teils gefoltert wurden. Laut BBC gab es dabei mindestens 11.000 Tote.
Ein Twitter-Nutzer erinnerte an diesen Teil der britischen Geschichte, der in diesen Tagen mit zahlreichen Meldungen zum Ableben der Monarchin wenig beleuchtet wurde.
"Sie wurde Königin, während sie in Kenia auf Tournee war. Afrikaner wurden in ihrem eigenen Land ausgegrenzt, versklavt, gefoltert und getötet", so der Kommentar, der die BBC für die einseitige Darstellung kritisierte: "Das ist es, was die BBC als eine langfristige Beziehung betrachtet."
Ein anderer Nutzer hatte ebenfalls die Art von Beziehung näher definiert:
"Wir hatten nie eine Beziehung zu Elisabeth, es war Imperialismus und Kolonialismus, das heißt, sie wurde uns aufgezwungen. KOLONIALE Beziehung."
Einige versuchten jedoch, den Beitrag zu verteidigen. So schrieb eine Person, dass die Menschen den Tod der Königin nun als Mittel nutzen, um alles zu kritisieren, was Großbritannien in den letzten 70 Jahren getan hat.
Als die negativen Äußerungen nicht aufhörten, verbot das Social-Media-Team der BBC Africa alle neuen Kommentare und erlaubt nun nur noch denjenigen, die vom Sender selbst markiert wurden, zu diesem Thema beizutragen.
Königin Elisabeth II. ist am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral in Schottland verstorben.
Quelle: rtd. /Bild Die britische Königin Elisabeth II. und die nationale Gesangs- und Tanzgruppe, nachdem sie eine Handels- und Investitionsausstellung im Polana-Hotel in Maputo eröffnet hat. Maputo, Mosambik, 15. November 1999.

08.09.
2022
Menschenrecht auf Bildung
Wie versteht Paulo Freire befreiende Bildung?
Anlässlich des Weltalphabetisierungstages und des hundertsten Jahrestages von Freire nähern wir uns seinem Hauptbeitrag.
Ist es möglich, die Gesellschaft zu verändern, wenn die Art und Weise, wie Menschen erzogen werden, nicht verändert wird? Ist es möglich, Bildung zur Unterdrückung in Erziehung zur Befreiung umzuwandeln? Was ist befreiende Bildung? Insbesondere der Vorschlag des brasilianischen Pädagogen Paulo Freire (1921-1997).
Um die Idee der befreienden Bildung zu verstehen, wird es zunächst notwendig, das Konzept zu verstehen, das sie überwinden will: die Bankbildung.
In seinem Buch "Pädagogik der Unterdrückten" kritisiert Paulo Freire den Geist der Bankkonzeption, für die Bildung der Akt des Einlagerns, des Transfers, der Vermittlung von Werten und Wissen ist.
Durch die Reflexion der unterdrückerischen Gesellschaft erhält und stimuliert die Bankausbildung die Dichotomie zwischen Pädagogen und Lernenden, zwischen demjenigen, der weiß, und demjenigen, der es nicht weiß, zwischen demjenigen, der Wissen erzählt oder überträgt, und demjenigen, der es auswendig lernt, zwischen denen, die Macht, Autorität und diejenigen, die sich ihr unterwerfen.
In dieser Vorstellung von Bildung dreht sich alles um den Lehrer, er ist der Hauptprotagonist. Bildung ist eminent vertikal, der Erzieher setzt die Regeln durch und baut eine Unterdrücker-unterdrückte Beziehung auf.
Freires Hauptergebnis ist, dass diese Art von Beziehung über die pädagogische Ebene selbst hinausgeht, so dass es möglich ist, diese Analyse auf den Rest der Gesellschaft auszudehnen, um die Struktur der Herrschaft zu erklären.
Angesichts der Bankbildung, deren Zweck die soziale Domestizierung ist, schlägt Paulo Freire eine befreiende Bildung vor, die mit der Überwindung (nicht der Umkehrung) des Widerspruchs zwischen Pädagoge und Lernendem beginnt.
Aus dieser Perspektive sind Pädagoge und Lernender miteinander verbundene Subjekte, die sich in ihren jeweiligen Rollen erkennen, zusammen lernen sie, gemeinsam suchen und bauen sie Wissen in dem Maße auf, in dem sie sich verpflichtet fühlen, dies mit Freiheit und Fähigkeit zur Kritik zu tun.
Laut Freire beinhaltet Bildung aus dieser Perspektive den Akt des Wissens und nicht die bloße Übertragung von Daten. Auf diese Weise teilen Lehrer und Schüler den gleichen Status, der in einem pädagogischen Dialog, der durch die Horizontalität ihrer Beziehungen gekennzeichnet ist, zusammengebaut wurde.
Die Befreiung der Bildung wird weder als unpolitisch noch als unideologisch angesehen: Sie hat einen klaren Zweck, der die Enthüllung und den Abbau der Herrschaftsstrukturen ist, nicht nur der pädagogischen, sondern auch der sozialen.
Die befreiende Bildung fördert den Dialog durch das Wort als das Grundlegende, um den kognitiven Akt auszuführen, weckt Kreativität und reflektierende Kritik im Lernenden, stärkt den historischen Charakter des Menschen, fördert den Wandel und den Kampf um Emanzipation.
Frei Betto, ein brasilianischer Theologe, der Freires Werk fortsetzte, sagte über die Befreiung der Bildung und ihre Konkretisierung in der Volksbildung: "Es ist die Methode des Sozialismus und der Sozialismus der politische Name der Liebe."
Quelle: teleSUR v.08.09.2022
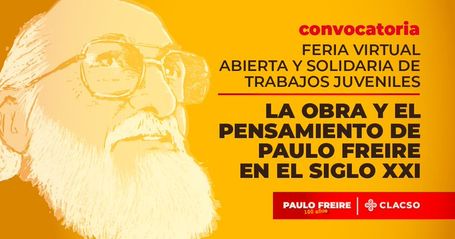
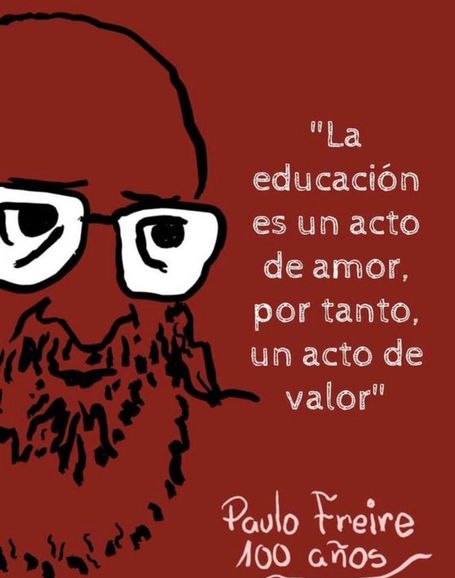
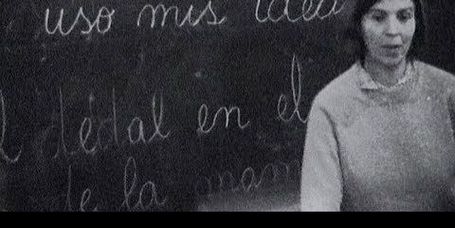

Info über Brasilien
Indigene Brasilianer mobilisieren zur Verteidigung des Amazonas
Bisher hat das Land in diesem Jahr 20 Prozent mehr Waldbrände erlitten als 2021.
Indigene Brasilianer verschiedener Ethnien mobilisierten in Sao Paulo und anderen Städten des Landes, um gegen die Abholzung und Zerstörung des Amazonas und anderer Biome dieses Landes zu protestieren.
Am Tag des Amazonas und der internationalen indigenen Frauen trafen sie sich in Sao Paulo im Augusta Park, wo die einheimische Führerin Sonia Guajajara sagte, sie werde Politiker für die Abgrenzung von Territorien beschuldigen; Lösungen gegen illegalen Bergbau, der Quecksilberverschmutzung verursacht; und Entwaldung.
Dem fügte er hinzu, dass "wir stehen zu sagen, dass wir nicht zurückgehen werden, wir werden die Politik bevölkern, den Nationalkongress bevölkern" als Teil einer Bewegung, in der Frauen aus indigenen Gemeinschaften einen Kreis mit Pflanzen und Materialien aus dem Dschungel bildeten, die die Phrasen bildeten: Amazonien ist indigene Frau. Indigene Frau ist Amazonien.
In Manaus, der Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas (Nordwesten), demonstrierten einheimische Führer und Vertreter sozialer Minderheiten auch gegen die Bedrohungen, denen die Regierung von Jair Bolsonaro ihre Völker ausgesetzt war.
Mehrere Beschwerden verschiedener Organisationen behaupten, dass die Bolsonaro-Regierung "die Bundesumweltschutzbehörden, das brasilianische Institut für Umwelt und erneuerbare natürliche Ressourcen und das Chico Mendes-Institut für den Schutz der biologischen Vielfalt geschwächt hat, wodurch indigene Länder noch anfälliger für eine Invasion geworden sind".
Dies wurde bei mehr als einer Gelegenheit vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen von der Articulation of the Indigenous Peoples of Brazil unter dem Vorwurf der Vernichtungspolitik gegen indigene Gemeinschaften angeprangert.
Hinzu kommt die Zunahme von Morden, verschiedenen Drohungen, Morddrohungen und versuchten Verbrechen gegen indigene Völker in den letzten Jahren, eine Bevölkerung, die nach Schätzungen der letzten Volkszählung 900.000 Brasilianer übersteigt.
Vom ersten Januar bis zum 4. September 2022 registrierte der Amazonas 58.000 Brände, 20 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2021.
Andere Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Amazonasregion in 37 Jahren das Zehnfache der Oberfläche des Bundesstaates Rio de Janeiro verloren hat; während es die höchste Entwaldung seit 15 Jahren registriert.
Derzeit erstreckt sich eine durch Waldbrände verursachte Rauchwolke durch Nordbrasilien und die Nachbarländer, die nach Angaben des Nationalen Instituts für Weltraumforschung (INPE) eine Fläche von fünf Millionen Quadratkilometern umfasst.
Quelle: teleSUR v.06.09.2022

Verstoß gegen die Menschenrechte
China: USA für Menschenrechtsverletzungen im Nahen Osten verantwortlich
9 Aug. 2022 21:08 Uhr
Die Chinesische Gesellschaft für Menschenrechtsstudien warf Washington in einem Bericht ernsthafte Menschenrechtsverletzungen im Nahen Osten vor. Insbesondere die Praxis des Regime-Changes prangerte die chinesische Organisation an.
In einem Bericht wirft die Chinesische Gesellschaft für Menschenrechtsstudien den Vereinigten Staaten vor, sie hätten US-amerikanische Werte im Nahen Osten gewaltsam gefördert, indem sie auf Regimewechsel drängten, die "amerikanische Demokratie" gewaltsam verpflanzten und die Souveränität und die Menschenrechte anderer verletzten, wie die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Die Gesellschaft veröffentlichte den Bericht am Dienstag.
In dem Bericht mit dem Titel "USA begehen ernste Menschenrechtsverletzungen im Nahen Osten und anderswo" heißt es, dass die Vereinigten Staaten versuchen, die Länder im Nahen Osten umzuwandeln und schwache, abhängige Regierungen zu etablieren, um ihre globale Hegemonie zu fördern.
Das Hauptziel Washingtons sei die Aufrechterhaltung der militärischen, wirtschaftlichen und konzeptionellen Hegemonie der USA, "was in der Folge die unabhängigen Entwicklungspfade der regionalen Länder verändert und die Souveränität der entsprechenden Länder im Nahen Osten sowie das Recht der Menschen auf Entwicklung und Gesundheit ernsthaft untergraben hat", heißt es in dem Bericht.
Die Vereinigten Staaten unterstützten seit Langem die Infiltration mit Nichtregierungsorganisationen und anderen Stellvertretern im Nahen Osten und hätten die Entwicklungswege der Länder des Nahen Ostens wiederholt durch "farbige Revolutionen" gewaltsam verändert, wird im Bericht weiter festgestellt.
Dem Bericht zufolge habe die von den USA erzwungene "Transformation" Afghanistans, des Irak, Syriens, Libyens und vieler anderer Länder die politische Ordnung gestört und den sozialen und nationalen Zusammenhalt in diesen Ländern zerstört.
Die von den USA erzwungenen "institutionellen Exporte" mit einem starken hegemonialen Unterton hätten "die Bemühungen der regionalen Länder, ihre Entwicklungswege unabhängig zu erkunden, gelähmt und eine Reihe von katastrophalen Folgen verursacht", so der Bericht.
https://www.podbean.com/ew/pb-zsr3m-1292cf9
Quelle: rtd.de v.09.08.2022

Verstoß gegen die Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 08.08.2022, Seite 8 / Ansichten
Doppelte Standards
Israel bombardiert erneut Gaza
Von Arnold Schölzel
Im Mai 2021 wurden nach elf Tagen Raketenbeschuss aus Gaza Richtung Israel und israelischer Bombardierung der mehr als zwei Millionen Einwohner des größten Freiluftgefängnisses der Welt mehr als 260 Tote gezählt – 13 auf israelischer Seite. Der UN-Menschenrechtsrat setzte am 27. Mai 2021 eine unabhängige, unbefristete Untersuchungskommission ein, die unter Vorsitz der südafrikanischen Richterin Navanethem »Navi« Pillay die tieferen Ursachen des Konflikts und konkrete Verbrechen untersuchen soll. Der Kommission wurde die Einreise nach Israel verwehrt, Ägypten weigerte sich, Zugang nach Gaza zu verschaffen. Sie ging ihrer Aufgabe dennoch akribisch nach.
Am 14. Juni hielt Pillay auf einer Pressekonferenz in Genf zum ersten Kommissionsbericht fest: Hauptursache waren und sind die andauernde Besatzung Palästinas, das mangelnde Interesse Verbündeter Israels für Rechte von Palästinensern sowie doppelte Standards. Gemeint ist: Eine Untersuchungskommission für Verbrechen im Ukraine-Krieg kam im Handumdrehen und ohne Hindernisse zustande. Aber 22 UN-Mitgliedstaaten verweigerten dem Pillay-Bericht die Zustimmung – maßgeblich dabei die USA und die Bundesrepublik. In Wahrung regelbasierter Außenpolitik.
Doppelte Standards bei Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen gröbsten Ausmaßes, also etwa bei Folter und extralegaler Tötung, gelten insbesondere in der NATO-Wertegemeinschaft nicht nur für Israel, sondern auch für Marokko und dessen Besatzungsregime in der Westsahara, erst recht für die Kriege des NATO-Mitglieds Türkei in Syrien und dem Irak und selbstverständlich für alle Kriege von USA und EU-Staaten. Kein Mitgliedstaat der Vereinten Nationen hat allerdings bisher seit Jahrzehnten so wie Israel die UN-Mechanismen untergraben. Morde mit Drohnen nach dem Vorbild der USA wie jüngst in Kabul sind nun ebenso eine »Regel« wie die Inkaufnahme von toten und verletzten Zivilisten durch Luftangriffe auf Gaza. Hintergrund waren dafür 2021 wie auch jetzt anstehende Parlamentswahlen in Israel.
Flankiert wird das Besatzungsregime durch sorgfältig orchestrierte Kampagnen gegen angebliche Antisemiten in EU-Staaten und Nordamerika. Gegenwärtig wird zum Beispiel eine gegen ein Mitglied der Pillay-Kommission, den indischen Juristen Miloon Kothari, inszeniert. Er hatte im Interview mit dem Internetportal Mondoweiss am 25. Juli erklärt, er halte die Bezeichnung »Apartheid«, die der UN-Sonderberichterstatter Michael Lynk im März für die Zustände in den von Israel besetzten Gebieten gefunden hatte, für »nicht ausreichend«. Er frage, warum Israel »überhaupt Mitglied der Vereinten Nationen« sei. Die eigenen Verpflichtungen als UN-Mitgliedstaat respektiere es jedenfalls nicht.
Genau darin besteht das Wesen der »regelbasierten Außenpolitik« des Westens: Willkür statt Recht. Die Pillay-Kommission macht das sichtbar. Für Palästinenser ist das viel.
Quelle: junge welt v. 08.08.2022 Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS
Nach den israelischen Luftangriffen auf Gaza: Trauernde bei der Beisetzung der Getöteten (7.8.2022)

Verstoß gegen die Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 01.08.2022, Seite 3 / Schwerpunkt
VERBRECHEN DER KATHOLISCHEN KIRCHE
»Es war Völkermord«
Langer »Weg zur Versöhnung«: Papst Franziskus spricht nach Kritik in Kanada von »Genozid« an Indigenen
Von Jürgen Heiser
Hintergrund: Die Kommission
Am 15. Dezember 2015 veröffentlichte die kanadische Truth and Reconciliation Commission (TRC) ihren Abschlussbericht über die Geschichte der etwa 130 Residential Schools. Die Gründung der TRC 2008 war Folge des Drucks von Kanadas First Nations. Ein nationales Forschungszentrum der TRC sammelte Aussagen ehemaliger Schülerinnen und Schüler sowie Dokumente von Kirchen und Behörden. Im Juni 2010 hielt die TRC ihre erste Nationale Versammlung in Winnipeg ab, an der Tausende teilnahmen. Sie hörten die Berichte der Überlebenden und erfuhren, dass einige staatliche und kirchliche Institutionen dem TRC Dokumente verweigerten.
Komplett anzeigen
Am Freitag abend beendete Papst Franziskus seine Kanada-Reise und machte sich auf den Rückflug nach Rom. Aufsehen erregte seine Äußerung, das Internatssystem sogenannter Residential Schools, in dem gut 100 Jahre lang bis in die 1990er Jahre hinein Generationen indigener Kinder »umerzogen« werden sollten, sei »Völkermord« gewesen. Das habe Franziskus laut Vatican News zu Reportern auf seinem Rückflug gesagt, meldete am Sonnabend der indigene Newsblog Native News Online (NNO).
Dieses Wort sei ihm während seiner »Pilgerreise der Buße« in Kanada zunächst nicht in den Sinn gekommen, so der Papst, obwohl er das »Entführen von Kindern« und »die zwangsweise Veränderung einer ganzen Kultur verurteilt« habe. »Völkermord« sei ein klar definierter Begriff. »Sie können also berichten«, so der Papst zu den Presseleuten, »dass ich gesagt habe, dass es ein Völkermord war.« Das Einlenken des Papstes war eine Reaktion auf die zuvor häufig geäußerte Kritik, er habe versäumt, anzuerkennen, dass »die von der Kirche einst gutgeheißenen Greueltaten an den indigenen Völkern in Nord- und Südamerika einem Völkermord gleichkommen«, wie die Juristin Pamela Palmater von der Eel River Bar First Nation in New Brunswick in einem Kommentar der Zeitung Toronto Star erklärte.
Zum Abschluss seines sechstägigen Besuchs bei den indigenen First Nations, Métis und Inuit war Franziskus am Freitag in Iqaluit, der Hauptstadt des Territoriums Nunavut am Nordpolarmeer eingetroffen. Nach Begegnungen in den Provinzen Alberta und Québec traf er zum dritten Mal Überlebende der Internatsschulen und bat das Volk der Inuit um Vergebung für »das Böse, das von nicht wenigen Katholiken« begangen wurde. Er sei »mit dem Wunsch gekommen, gemeinsam einen Weg der Heilung und Versöhnung zu gehen«, so das Kölner Domradio.
Nicht Idee des Vatikan
Auf dem Flughafen von Iqaluit hatte Generalgouverneurin Mary Simon das katholische Kirchenoberhaupt empfangen. Simon, Angehörige der Inuit, ist die erste Indigene in diesem Amt. Sie vertritt in der »föderalen parlamentarischen Monarchie« Kanada die britische Queen Elizabeth II., die offizielle Herrscherin des Landes. Deshalb sprach Franziskus auch nur für zehn Minuten mit Regierungschef Justin Trudeau in Québec, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, nachdem »seine Heiligkeit« dort am Mittwoch eine Rede vor Vertretern von Regierung, Behörden und diplomatischem Korps sowie 50 Überlebenden der Internate gehalten hatte. Letztere konnten jedoch nicht direkt mit dem Papst sprechen, wie Kenneth Deer von der Mohawk Nation gegenüber NNO berichtete. Und das, obwohl Generalgouverneurin Simon hervorgehoben hatte, es sei »dem Mut und der Widerstandsfähigkeit« der Überlebenden zu danken, »dass der Weg für die Bitte um Vergebung der Kirche auf indigenem Land in Kanada geebnet« wurde.
Die päpstliche Reise war keine Idee des Vatikanstaates. Vielmehr war es der 94 Punkte umfassende Handlungskatalog, der 2015 im Abschlussbericht der Wahrheits- und Versöhnungskommission veröffentlicht wurde, der die Katholiken zu dem Schritt drängte. Nach Vorarbeit der kanadischen Bischofskonferenz und Gesprächen am 1. April in Rom mit Delegierten der First Nations und Überlebenden der Internate hatte sich nun auch der Papst endlich auf den Weg gemacht.
Die von ihm besuchten indigenen Gemeinden machten ihm jedoch schon bald klar, dass seine Kirche auf ihrem »Weg zur Versöhnung« noch eine sehr lange Strecke vor sich hat. Vor allem weil Franziskus durch seine Äußerungen zu Beginn seiner »Büßerreise« den Eindruck vermittelte, dass nicht die Kirche, sondern der kanadische Staat hauptverantwortlich war für den Terror der Internate.
Versteinerte Gesichter
Das deutete Franziskus jedenfalls am vergangenen Montag in seiner ersten Rede an, die er in Maskwacis in der Provinz Alberta hielt, dem Ort der berüchtigten Ermineskin Residential School. Vor Tausenden Indigenen aus ganz Kanada bedauerte der Papst »zutiefst, dass viele Christen die Kolonialmentalität der Mächte unterstützten, die die indigenen Völker unterdrückt haben«. Er bitte »insbesondere um Vergebung für die Gleichgültigkeit vieler Glieder der Kirche«, die an der von den damaligen Regierungen geförderten »kulturellen Vernichtung und Zwangsassimilation in den Internaten mitgewirkt« hätten. Er bitte »demütig um Vergebung für das Böse, das so viele Christen an den indigenen Völkern begangen haben«.
Laut Agenturberichten waren während der Rede des Papstes im Rund der Zuhörenden viele versteinerte Gesichter zu sehen. Ältere Indigene brachen angesichts ihrer Erinnerungen an den Horror des Erlebten in Tränen aus. Es gab indes auch Beifall für die päpstlichen Worte. Überrascht habe die Menge laut NNO, dass »Häuptling Wilton Littlechild dem Papst einen traditionellen Federkopfschmuck schenkte«. Franziskus habe den Kopfschmuck jedoch nur kurz und wortlos aufgesetzt.
Viele Indigene äußerten sich dazu entrüstet im Internet. Russell Diabo von der Mohawk Nation, Herausgeber der Publikation First Nations Strategic Bulletin, verurteilte die Geste auf Twitter als »ein Spektakel aus oberflächlichen Erklärungen des Papstes und dem Aufsetzen des Federschmucks«. Sie nütze nur »der Zusammenarbeit von Kirche und Staat bei der Schaffung der Mythologie einer gemeinsamen ›Versöhnungs‹-Agenda«. Christian Big Eagle von der »Cree Warriors Society« reagierte wütend auf das Geschenk an Franziskus. Einen solchen traditionellen Federschmuck müsse man sich verdienen, schrieb er auf Twitter. Der Papst sei jedoch »Oberhaupt einer Organisation, die indigene Kinder vergewaltigt und ermordet hat«.
Quelle: junghe Welt 01.08.2022/Adam Scotti/Prime Minister's Office/Handout via REUTERS
»Horror des Erlebten«: Die Sängerin Si Pih Ko mit einem emotionalen Lied beim Papstbesuch am 25. Juli in Alberta
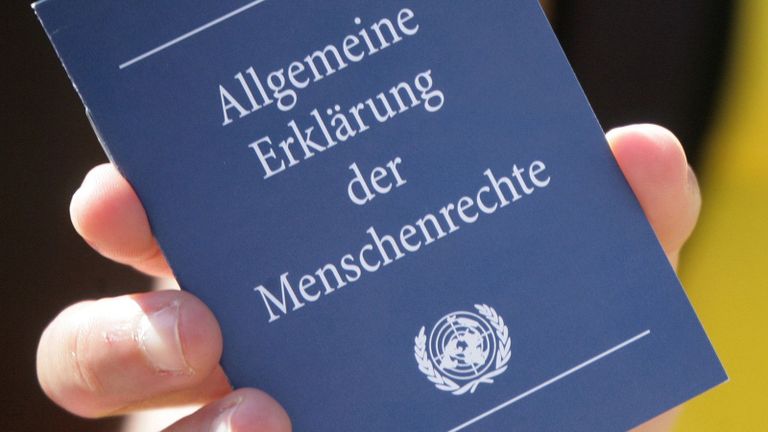
Verstoß gegen das Völkerrecht
Aus: Ausgabe vom 30.07.2022, Seite 8 / Ausland
EU-ABSCHOTTUNG
Vertuschte Verbrechen
EU-Kommission hält weiterhin Bericht über völkerrechtswidrige Methoden der Grenzagentur Frontex zurück
Von Matthias István Köhler
Die EU-Kommission weiß davon, schweigt aber, mehr noch – sie verhindert seit Monaten, dass ihre eigenen Erkenntnisse an die Öffentlichkeit gelangen: Ein interner Untersuchungsbericht des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) hält auf 129 Seiten die tatkräftige Unterstützung der sogenannten Grenzschutzagentur Frontex bei den völkerrechtswidrigen »Pushbacks« der griechischen Küstenwache fest. Das Nachrichtenmagazin Spiegel und die französische Zeitung Le Monde hatten am Donnerstag darüber berichtet und auch aus dem als geheim eingestuften Papier zitiert.
Vorwürfe bekannt
Ganz neu sind die Ermittlungsergebnisse des OLAF nicht. Die Vorwürfe gegen Frontex und auch die griechischen Grenzbeamten wegen systematischer Menschenrechtsverletzungen sind von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen und Medien teils minutiös nachrecherchiert und dokumentiert worden. Der Europäische Gerichtshof verurteilte erst am 7. Juli Griechenland für illegale »Pushbacks« im Jahr 2014, als acht Frauen und drei Kinder östlich der Dodekaninseln ertranken. Anfang Mai musste der damalige Chef der EU-Abschottungsbehörde, Fabrice Leggeri, zurücktreten – die Beweise, dass Frontex bei den illegalen Tätigkeiten involviert war und sich an deren Vertuschung aktiv beteiligte, waren erdrückend.
Die Bedeutung des OLAF-Berichts liegt darin, dass er unter anderem die Kommunikation Leggeris und seiner Truppe auswertet und weitere Details zu deren Methoden offenlegt. »Sie belogen das EU-Parlament und verschleierten, dass die Agentur einige Pushbacks sogar mit europäischem Steuergeld unterstützte«, heißt es beim Spiegel.
So verhinderte Frontex unter anderem die Aufzeichnung der Menschenrechtsverletzungen durch die griechische Küstenwache in der Ägäis. Flugzeuge der Abschottungsagentur wurden eigens dafür von Patrouillen abgezogen. Auf einer handschriftlichen Notiz vom 16. November 2020 findet sich vermerkt: »Wir haben unser FSA vor einiger Zeit zurückgezogen, um nicht Zeugen zu werden.« FSA sind die Beobachtungsflieger der Behörde. Leggeri persönlich weigerte sich, Inmaculada Arnaez, der damaligen Frontex-Menschenrechtsbeauftragten – auch so etwas gibt es –, Videos und Dokumente auszuhändigen. In der internen Kommunikation hieß es laut Spiegel, sie würde ein »Terrorregime im Stile der Roten Khmer über die Agentur« bringen.
Bloßes Gerede
In mindestens sechs Fällen wurde EU-Geld verwendet, um Einsätze mit »Pushbacks« direkt zu finanzieren. Bei Nachforschungen des Parlaments dazu schwieg die Leitung um Leggeri. »Grundrechte werden als Gimmick, als eine Art Spielerei ohne wirklichen Nutzen angesehen«, zitierte Spiegel dazu einen Frontex-Mitarbeiter aus dem OLAF-Bericht.
Vor allem aber macht der Umgang mit dem Bericht klar, dass die EU-Kommission und einige Abgeordnete längst aus eigenem Anschauungsmaterial um die gegen das Völkerrecht verstoßenden Praktiken an der EU-Außengrenze wussten – und die Erkenntnisse mit aller Gewalt unter Verschluss halten wollen. Das EU-Parlament hatte im Mai deswegen gegen die Entlastung des Frontex-Haushaltes gestimmt. Sie monierten, den Bericht nicht zu kennen und so keine informierte Entscheidung treffen zu können.
Geschehen ist in der Sache seither immer noch nichts – bis auf wohlfeile und folgenlose Kritik der EU-Kommission. Damit kann Athen umgehen, solange die Gelder für »Flüchtlingsabwehr« aus Brüssel weiter fließen. Im Juni vergangenen Jahres versicherte der griechische Migrationsminister Panagiotis Mitarachi wiederholt, seine Regierung wende »Technologie an, die internationales Recht nicht verletzt. Wir verteidigen die Grenzen der Europäischen Union, ohne Menschen in Gefahr zu bringen«.
Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sprach bei ihrem Besuch am Freitag in Athen die Angelegenheit an. Am Donnerstag hatte sie eine »systematische Aufklärung« der Vorwürfe gefordert. Das heißt, es bleibt beim Gerede – denn der OLAF-Bericht zeigt, dass diese »systematische Aufklärung« zumindest in Ansätzen vorliegt, politisch aber ignoriert wird.
Quelle: junge Welt v.30.07.2022ild Costas Baltas/REUTERS
Augen und Ohren zu: Frontex-Mitarbeiter bei der Arbeit. Während ein Rettungsboot geflüchtete Menschen Richtung Küste eskortiert, wartet das Frontex-Boot im Hintergrund (Lesbos, 28.2.2020)

Verstoß gegen die Menschenrechte in Guatemala
Guatemala Stadt – Ende Juli
Notizen eines deutschen Anwalts in Guatemala (81)
Wir nähern uns Ende Juli; diesmal muss ich die Notizen etwas früher beenden. Ohnehin ist die Entscheidung worüber schreiben, nicht leicht; in dieser Umwälzung eines rachitischen Rechtsstaates hin zu einer Diktatur der Impunidad finden Umwälzungen statt, die täglich katastrophale Nachrichten produzieren. Hier monatlich berichtend zusammenzufassen und Tendenzen zu analysieren ohne Depression zu verbreiten ist eine Herausforderung, von der ich nicht weiß, ob die Notizen ihr immer gerecht werden. Über Rückmeldungen bin ich dankbar. Heute könnte ich über ein Netz von Menschenhandel berichten, in dessen Fängen seit Monaten junge Frauen und Mädchen verschwinden. 1 Genauso könnte es um die tägliche Zerstörung von Infrastruktur gehen und den nicht endenden Raub öffentlicher Gelder; oder um Acisclo Valladares Urruela, Wirtschaftsminister unter Jimmy Morales, der sich jetzt in den USA schuldig erklärte, für seinen früheren Arbeitgeber TIGO2 zwischen 2014 und 2018 Abgeordnete und Funktionsträger in Millionenhöhe bestochen und Geld gewaschen zu haben. Oder ich könnte erneut über die zunehmenden Angriffe und Attentate auf soziale AktivistInnen und JournalistInnen schreiben oder die andauernden Versuche, endlich das ElPeriódico zu schließen. 1Aus der Diskothek ”El Embarcadero 2” in San Juan Sacatepéquez verschwanden nur im Juli 13 junge Frauen; sie ist bekannt für ihren Drogenumsatz. Betreiber der Disco ist der Bürgermeister und der Bruder seines Kollegen von Villa Nueva. Beides sind Städte in Hauptstadtnähe. 2 Telekommunikationsriese 3 Blanca Stalling, damals Richterin des obersten Gerichts, versuchte 2016 einen Kollegen zu Gunsten ihres beschuldigten Auch die Versetzungen und Rausschmisse in Staatsanwaltschaft und Gerichten gingen über den gesamten Monat weiter, genauso wie die Manipulation der Verfahren, die noch aus den goldenen Jahren 2015-17 des Kampfes gegen die Korruption stammen. Sie werden so lange manipuliert, bis wichtige Zeuginnen ausgeschlossen, StaatsanwältInnen oder RichterInnen abgelöst oder Anklageschriften umgeschrieben werden… und damit Haftverschonung, Einstellung oder Freispruch für die Beschuldigten möglich sind. Gleiches passiert, nur andersherum, in den Verfahren gegen die unabhängige Justiz. Wenn ein System systematisch zerstört wird, kommt es unweigerlichen auch zu so absurden Blüten wie die einer der Bestechung überführten und suspendierten Richterin, die jetzt Schadensersatz wegen entgangenen Verdienstes will. 3 Es ist eine verkehrte Welt, in der ich im Juli Kriminelle öffentlich triumphieren und RichterInnen hinter verschlossen Türen weinen sah. Dazu bereitet sich das System auf die Wahlen vor. Giammattei verliert, wie vorausgesagt, an Einfluss und konzentriert sich darauf, sich und seinen Leuten die Straffreiheit für die nächsten Jahre zu garantieren. Da sie auch das TSE (oberstes Wahlgericht) kontrollieren, werden Parteiauflösungsverfahren initiiert oder beendet, wie sie es brauchen. Sandra Torres und die UNE waren Teil des Paktes und unterstützten ihn im Kongress, bis diese Allianz angesichts der kommenden Wahlen (2023) brach. Die UNE soll Sohnes zu bestechen. Richter Ruano zeigte sie an; sie floh filmreif mit Pistole und Perücke, wurde aber gefasst und suspendiert. Jetzt wurde ihr Verfahren eingestellt und sie fordert ihren entgangenen Verdienst in Millionenhöhe, obwohl ihr Mandat seit 2018, wie das ihrer KollegInnen längst abgelaufen ist (versch. Notizen). jetzt aufgelöst werden genauso wie Semilla, die einzig ernstzunehmende Opposition im Kongress, die aus der Antikorruptionsbewegung 2015 entstanden ist. Andere Verbotsverfahren wie das gegen „Prosperidad Ciudadana“, wurden geschlossen; sie blieb Teil des Paktes. Demgegenüber gibt es Initiativen, die versuchen oppositionelle Kräfte zusammenzubringen. Es sollte leicht sein, sich in einer so dramatischen Situation auf die wichtigsten Eckpunkte gemeinsamer Vorschläge zu einigen; dazu könnten soziale Programme, der Kampf gegen Korruption und Straffreiheit und für Menschenrechte gehören. Einige Parteien wie SEMILLA, WINAQ und URNG scheinen auch bereit zu sein, allerdings ohne inhaltliche Vorschläge zu machen, während MLP, die Partei, die von CODECA gegründet wurde und in einigen Regionen eine starke Basis hat, hier eher alter Radikalität verhaftet bleibt und keine Anstalten macht, an solchen Überlegungen teilzunehmen. Das Land ist erzkonservativ; es gibt kaum Zugang zu Bildung und kritischem Denken, die Menschen sind in einem Netz von fundamentalistischen Kirchen verfangen und dazu in dem des täglichen Überlebens. Wenn sich 40 schlecht ausgebildete Schulab[1]gängerInnen um die drei Jobs streiten, die der Bürgermeister im Dorf anbietet, machen 30 von ihnen bei der nächsten Wahl Wahlkampf für irgendeinen Kandidaten. Das System ist eine allgegenwärtige Krake Die Bevölkerung macht sich keine Illusionen über die Korruption, aber das ändert nichts; sie ist unveränderbarer Teil ihrer Realität. Der Staat taucht vor den Wahlen auf und verteilt T-Shirts oder einen Sack Dünger. Ansonsten existiert er nicht; Staat und Wahlen haben keine wirkliche Bedeutung. Man nimmt 4 Wenn man die Stimmen der demokratischen und linken Parteien bei der Präsidentenwahl 2019 zusammenzählt, wäre eine daran teil, ohne auch nur zu hoffen, dass das etwas verändert. Dennoch könnten progressive Vorschläge den Unterschied machen, wenn sie von der Realität der Menschen ausgehen. Giammattei wurde laut einer Umfrage von CID-Gallup im Mai von 81 % der Bevölkerung abgelehnt; heute könnte dieser Prozentsatz bei 85 oder 90% liegen. Linke oder demokratischen Strömungen haben es in diesem Land nach den fatalen Folgen des Krieges sicher schwer; sie könnten sich aber in diesem Vakuum bewegen, wenn sie Hand in Hand arbeiten. 4 Noch kann es 2023 anders werden, aber es spricht zurzeit nicht viel dafür. Nach diesem Rundschlag will ich kurz versuchen, die Brücke zwischen zwei konkreten Ereignissen zu schlagen. Der hier oft erwähnte Richter Gálvez, Symbol des Rechtsstaates und des Kampfes gegen die Korruption, aber auch Verteidiger der Hoffnung der Opfer des Krieges, hängt jeden Tag mehr am seidenen Faden. Nach dem obersten Gericht (CSJ) hat ihm jetzt auch das sog. Verfassungsgericht den Rücken gekehrt. Zwischen der Aufhebung seiner Immunität und seiner möglichen Verhaftung steht jetzt nur noch ein „Untersuchungsrichter“, der der CSJ die Auf[1]hebung der Immunität empfehlen soll. Die Farce nimmt ihren Lauf. Dieser „unabhängige“ Richter, ausgewählt durch dieselbe CSJ, ist Oberst[1]leutnant, war jahrelang Berater des Ministers und dann Chef der juristischen Abteilung des Verteidigungsministeriums, dazu Berater im Kongress für Sicherheitsfragen. Er empfahl schon die Aufhebung der Immunität des Richters Xitumul und war mit dem gleichen Verfahren gegen Richterin Aifán befasst. Das ist die Justiz, die wir heute haben; das Ergebnis steht längst fest, auch wenn der interamerikanische gemeinsame Kandidatin in die Stichwahl gekommen. Aber niemand wollte auf die eigene Kandidatur verzichten… Gerichtshof für Menschenrechte am 9.7. in einer Eilentscheidung anordnete, dass Guatemala den Schutz von Gálvez und seiner richterlichen Unabhängigkeit garantieren solle. Parallel dazu haben die USA ihre Engel-Liste erweitert. Ich könnte jetzt darauf eingehen, dass zum ersten Mal wichtigen Unternehmern, wie u.a. dem Zuckerbaron Moncho Campollo, das Visum entzogen wird und möglicherweise auch der Zugang zu seinen Konten in den USA. Oder ich könnte analysieren, warum 5 (fünf) RichterInnen (darunter 2 der CSJ) und Staatsanwalt Curruchiche, dieser unsägliche Chef dessen, was einmal die FECI war, aufgenommen wurde. Die entscheidende Frage ist aber, was diese Liste, die in den Notizen immer wieder Thema war, wirklich bringt. Hier haben viele auch darauf gehofft, dass sie der Vorläufer ernster Sanktionen sei und dass die USA endlich Maßnahmen ergreifen, die diese Allianz von organisiertem Verbrechen und Staat im Herzen trifft. Vielleicht kommt das noch. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass der Pakt mit seiner Unabhängigkeitsrhetorik auch ein Körnchen Wahrheit auf seiner Seite hat. Diese Mechanismen waren immer Teil der Politik der Einmischung und Knebelung durch die USA. Xiomara Castro, die neue Präsidentin von Honduras hat die aktuell erweiterte Engelliste wegen genau dieser Einmischung abgelehnt, sind doch auch Elemente der neuen Regierung auf ihr vertreten. Dagegen war die jahrelange 5 Sie behauptet, dass die USA mit dieser „sog. Engel-Liste“ die guatemaltekische Verfassung „flagrant verletzt“ und „hier vor allem das Recht auf Verteidigung, da niemand verurteilt oder von seinen Rechten ausgeschlossen werden kann“, der sich nicht vor einem Richter verteidigen konnte. Damit behauptet dieses Licht am Horizont der Rechtswissenschaften, dass GuatemaltekInnen ein verfassungsmäßig verbrieftes Recht auf Visum in den USA haben. Das ist blühender Unsinn und klingt den MigrantInnen, die ihr Leben riskieren, um in die USA zu kommen, sicher wie Hohn in den Ohren. Dann kam sie auch noch mit der Unschuldsvermutung Forderung der Opposition vor der Regierungsübernahme missachtet worden, endlich den damaligen Präsidenten und Drogenhändler Hernández aufzunehmen und zu ächten. Das geschah nie. Und doch zeigt die ebenso wirre wie absurde Stellungnahme5 von Silvia Valdés, der obersten Juristin des Landes und Präsidentin (!) der CSJ, dass ihnen die Liste weh tut… …und das freut mich, ich gebe es gerne zu. Miguel Mörth daher, als wenn die gegenüber Verwaltungshandeln bestehen würde. Sie fantasierte weiter, dass auch das Recht auf einen geordneten Prozess verletzt sei, da diese List keinerlei Legitimation habe, sondern auf unentschuldbare Weise in die Justiz eingreifen würde… was ihr besonders verwerflich erschien, da es doch um ehrenwerte RichterInnen ginge. In welche Justiz hier mit Verwaltungshandeln eingegriffen wird, ob in die der USA oder Guatemalas, blieb dazu ihr Geheimnis. Das Ganze ist juristisch völlig absurd und eher Abschreckungsmaterial für die Einführung von Studienanfängern.
Quelle. Juli 2022, Flurina Doppler
Koordinatorin | Guatemalanetz Bern
Coordinadora | Red Guatemala-Suiza
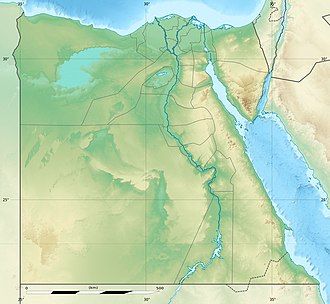
Verstoß gegen Menschenrechte
„Ein vertrauenswürdiger Partner”
Ägyptens Präsident Al Sisi besucht zum Ausbau der bilateralen Kooperation Berlin. Kritiker protestieren – wegen schwerster Menschenrechtsverbrechen der ägyptischen Behörden.
18
JUL
2022
KAIRO/BERLIN (Eigener Bericht) – Proteste von Menschenrechtsorganisationen überschatten den aktuellen Besuch des ägyptischen Präsidenten Abd al Fattah al Sisi in Berlin. Al Sisi hält sich zur Zeit in der deutschen Hauptstadt auf, um die Zusammenarbeit zwischen Ägypten und Deutschland zu intensivieren. Dabei geht es nicht nur um Milliardengeschäfte für deutsche Konzerne; kürzlich hat Siemens den größten Auftrag der Firmengeschichte in dem nordafrikanischen Land erhalten. Vor allem hat Berlin Kairo als Lieferanten von Energieträgern im Visier. So ist geplant, dass Ägypten israelisches Erdgas verflüssigt und in die EU exportiert; künftig soll es auch grünen Wasserstoff produzieren. Ägypten sei als Energielieferant „ein vertrauenswürdiger Partner“, lobte unlängst EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Pikant ist, dass der „Energiepartner“ sich schon seit vielen Jahren mit schweren Menschenrechtsverletzungen hervortut; seit sich die Militärs im Jahr 2013 in Kairo an die Macht putschten, sind laut Berichten bis zu 65.000 Menschen aus politischen Gründen inhaftiert worden. Folter ist verbreitet, zahllose Regierungsgegner sind verschwunden.
Al Sisi in Berlin
Ägyptens Präsident Abd al Fattah al Sisi ist gestern zu einem mehrtägigen Besuch in Berlin eingetroffen. Dort leitet er nicht nur gemeinsam mit Außenministerin Annalena Baerbock den Petersberger Klimadialog. Er wird heute auch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und von Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gesprächen empfangen.[1] Al Sisi ist regelmäßiger Gast in der Bundesrepublik; bereits 2015 und 2018 hielt er sich zu Verhandlungen in Berlin auf. Umgekehrt reisen deutsche Politiker immer wieder nach Kairo, um dort die Beziehungen zu intensivieren. Zuletzt hielt sich Außenministerin Baerbock in der ägyptischen Hauptstadt auf, um Schritte zum Ausbau der bilateralen Kooperation zu unternehmen. Kairo sei „ein wichtiger Ansprechpartner“, teilte Baerbock damals mit.[2]
Folter und Mord
Gegen den aktuellen Empfang für Präsident Al Sisi in Berlin protestieren Menschenrechtsorganisationen erneut. In Ägypten sind Tausende Regierungsgegner, Menschenrechtler, Journalisten und Wissenschaftler allein wegen ihrer oppositionellen Haltung inhaftiert; seit die ägyptischen Militärs sich im Juli 2013 in Kairo an die Macht putschten, sind laut Berichten bis zu 65.000 Personen aus rein politischen Gründen ins Gefängnis geworfen worden.[3] In den Haftanstalten sind unmenschliche Lebensbedingungen sowie eine völlig unzulängliche medizinische Versorgung an der Tagesordnung; Amnesty International geht davon aus, dass mindestens 56 Todesfälle in Haft teilweise oder sogar vollständig darauf zurückzuführen sind.[4] Folter ist verbreitete Praxis; zahlreiche Oppositionelle sind spurlos verschwunden. Frauen werden diskriminiert, ebenso Nichtheterosexuelle und Angehörige religiöser Minderheiten. Streiks und andere Proteste von Arbeitern werden oft brutal unterdrückt. 21 Menschenrechtsorganisationen haben Ende vergangenen Woche Außenministerin Annalena Baerbock in einem offenen Brief ausdrücklich aufgefordert, Al Sisi zur Freilassung der politischen Gefangenen zu drängen. Auch solle, heißt es in dem Schreiben, der Druck auf die ägyptische Zivilgesellschaft eingestellt werden.
Milliardengeschäfte
Beobachter gehen freilich nicht davon aus, dass Baerbock oder Kanzler Olaf Scholz jenseits von Lippenbekenntnissen wirklich Druck auf Al Sisi ausüben. Hintergrund ist, dass Berlin eine enge Kooperation mit der Regierung in Kairo sucht – ökonomisch, beim Bezug von Energieträgern sowie politisch. Ägypten ist der zweitgrößte Handelspartner Deutschlands in Afrika nach Südafrika und drittgrößter Investitionsstandort deutscher Firmen auf dem Kontinent. Aktuell sind deutsche Kfz-Zulieferer, so etwa Leoni, bemüht, beim geplanten Aufbau der ägyptischen Automobilbranche attraktive Marktanteile zu erobern.[5] Vor allem aber fallen immer wieder bemerkenswerte Großaufträge für deutsche Konzerne an. Siemens etwa konnte sich im Jahr 2015 in Ägypten den damals größten Auftrag seiner Geschichte sichern; es handelte sich um den Bau dreier Gas- und Dampfturbinenkraftwerke sowie von Windkraftanlagen für insgesamt rund acht Milliarden Euro.[6] Ende Mai teilte Siemens mit, den Rekord mit einem neuen Geschäft in Ägypten übertroffen zu haben. Dabei geht es um Bau und Ausstattung eines 2.000 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitsnetzes; der Münchner Konzern soll dafür etwa 41 Hochgeschwindigkeits- und 94 Regionalzüge plus 41 Güterlokomotiven sowie Infrastruktur liefern – für 8,1 Milliarden Euro.[7]
Erdgas und Flüchtlingsabwehr
Besitzt die Förderung profitabler Geschäfte für deutsche Konzerne Gewicht an sich, so hat die Bundesregierung es in Kairo speziell auf Erdgaslieferungen abgesehen. Mitte Juni besuchte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die ägyptische Hauptstadt, um dort eine entsprechende Absichtserklärung zu vereinbaren. Ägypten fördert Erdgas nicht nur selbst; es bezieht seit 2020 auch über eine Pipeline Erdgas aus Israel. Die EU will künftig bis zu 15 Milliarden Kubikmeter israelischen Erdgases jährlich in Ägypten verflüssigen lassen – Ägypten besitzt zwei Verflüssigungsanlagen – und es von dort importieren.[8] Ergänzend plant Brüssel, perspektivisch auch Strom und grünen Wasserstoff aus dem Land einzuführen. Kairo sei „ein vertrauenswürdiger Partner“, wie man ihn für langfristige Energiegeschäfte suche, teilte von der Leyen bei ihrem Aufenthalt in der ägyptischen Hauptstadt mit. Zur selben Zeit stellte die von ihr geführte EU-Kommission in einem internen Papier Ägypten 80 Millionen Euro für neue Maßnahmen zur Flüchtlingsabwehr in Aussicht. Allein von Januar bis Mai seien rund 3.500 Ägypter per Boot nach Italien gelangt, hieß es; dies müsse nun aufhören.[9] Berlin und Brüssel kooperieren mit Kairo in puncto Flüchtlingsabwehr bereits seit Jahren.[10]
Gegen China
Nicht zuletzt zielt die Bundesregierung mit ihrer Kooperation mit Ägypten darauf ab, in dem nordafrikanischen Land nicht noch mehr Einfluss gegenüber China zu verlieren. Chinesische Unternehmen haben in den vergangenen Jahren zweistellige Milliardensummen in Ägypten investiert und nehmen eine führende Rolle in der Suez Canal Economic Zone (SCEZ) ein, einer strategisch äußerst günstig direkt am Suezkanal gelegenen Sonderwirtschaftszone, die als „Eckstein der langfristigen Wirtschaftsstrategie der ägyptischen Regierung“ gilt.[11] Auch am Bau der neuen Hauptstadt, die die Regierung im Osten von Kairo errichtet, sind Unternehmen aus der Volksrepublik maßgeblich beteiligt. „Ägypten ist die Drehscheibe von Chinas Mittelostpolitik“, wird etwa Degang Sun, Professor für internationale Studien an der Fudan University in Shanghai, zitiert. Das Land befinde sich „an der Schnittstelle dreier Zivilisationen“, erläutert Chuchu Zhang vom Zentrum für Mitteloststudien an der Fudan University: „die arabische, die mediterrane und die afrikanische Zivilisation“.[12] Zudem ist der Suezkanal eine Wasserstraße von weit herausragender geostrategischer Bedeutung. Mit ihren Aktivitäten in Ägypten sucht die Bundesregierung dort nicht zuletzt ihren eigenen Einfluss gegen China zu behaupten.
Quelle: German-Foreigen-Policy.com vom 18.07.2022

Verstoß gegen die Menschenrechte
Melilla – mindestens 23 Menschen sterben am Grenzzaun
(Melilla, 25. Juni 2022, ANRed/El Salto).- Etwa 2.000 Migrant*innen haben am Freitagmorgen versucht, den Zaun zu überwinden, der die spanische Exklave Melilla umgibt. Marokkanische und spanische Sicherheitskräfte schlugen mit brutaler Gewalt zurück. Wie viele Menschen im Zuge der anschließenden zweistündigen Schlacht zu Tode kamen, steht noch nicht fest; bisher wurden 23 Todesfälle bestätigt. Menschenrechtsorganisationen gehen von über 40 Menschen aus, die durch Schläge und Schüsse getötet wurden, dazu kommen etliche Verletzte. Der Großteil der Migrant*innen stammt aus den Ländern südlich der Sahara. In diesem Jahr sind bisher 1.402 Einwanderer über die Exklavenstädte Ceuta und Melilla nach Spanien eingereist, das sind etwa 80 Prozent mehr als im Vorjahr.
Seit Wochen hatte sich die Lage zugespitzt
Die Tragödie des 24. Juni hatte sich bereits seit längerem angebahnt. In den letzten Wochen waren die Sicherheitskräfte im Umfeld der Stadt Nador immer wieder mit Massenverhaftungen, Razzien in Lagern und Zwangsumsiedlungen gegen Migrant*innen vorgegangen. Mit der Wiederaufnahme der Zusammenarbeit zwischen Marokko und Spanien im Kontext der Grenzsicherung wurden die koordinierten Aktionen zwischen den beiden Ländern ab März 2022 massiv intensiviert. Bei diesen Aktionen kam es im Norden (Nador, Tetouan und Tanger) sowie im Süden Marokkos (El Aaiun, Dakhla) immer wieder zu Menschenrechtsverletzungen gegen Migrant*innen. Das Drama des 24. Juni ist die Folge des stetig gestiegenen Drucks gegen die Vertriebenen.
Elend in den Lagern
Seit mehr als anderthalb Jahren haben die Migrant*innen in Nador keinen Zugang zu Medikamenten oder medizinischer Versorgung, ihre Lager wurden geplündert und niedergebrannt, ihre spärliche Nahrung vernichtet, und sogar das bisschen Trinkwasser, das ihnen in den Lagern zur Verfügung steht, wurde beschlagnahmt. Die Gewalt gegen die Flüchtenden war von nationalen, regionalen und UN-Gremien bereits bei zahlreichen Gelegenheiten verurteilt worden. Der spanische Präsident Pedro Sánchez hingegen äußerte sich nach dem brutalen Polizeieinsatz lobend über die gute Mitarbeit der marokkanischen Streitkräfte bei der Bekämpfung afrikanischer Migrant*innen. Als Reaktion auf die Ereignisse unterzeichneten mehrere Menschenrechtsorganisationen mit Schwerpunkt Migration die folgende Erklärung:
29 Tote an europäischen Grenzen: Das spanisch-marokkanische Einwanderungsabkommen tötet
„Die tragischen Ereignisse vom 24. Juni 2022 an der Grenze zwischen Nador und Melilla in Marokko sind ein blutiger Verweis auf das Scheitern der sicherheitsorientierten Migrationspolitik. 27 tote und hunderte verletzte Migrant*innen und marokkanische Polizeikräfte sind das tragische Sinnbild der Politik der Europäischen Union (EU), die auf Abschottung der Grenzen setzt. Ein Land des Südens trägt ebenfalls Schuld an der Katastrophe: Marokko. Der Tod der jungen Afrikaner an den Grenzen der „Festung Europa“ führt uns die blutigen Folgen der spanisch-marokkanischen Zusammenarbeit zum Schutz vor Einwanderung vor Augen.
- Wir sprechen den Familien der Opfer, sowohl auf Seiten der Migrant*innen als auch in den Reihen der Ordnungskräfte, unser tiefstes Beileid aus.
- Wir verurteilen, dass die verletzten Migrant*innen nicht sofort versorgt wurden, das hat die Zahl der Opfer weiter in die Höhe getrieben.
- Wir fordern eine angemessene medizinische Versorgung für alle Verletzten, die nach dieser Tragödie ins Krankenhaus eingeliefert wurden.
- Wir fordern die marokkanischen Behörden auf, die Toten in Zusammenarbeit mit den Gemeinschaften der Migrant*innen zu identifizieren und die sterblichen Überreste der Opfer an ihre Familien zurückzugeben.
- Wir fordern eine unverzügliche Untersuchung der Ereignisse durch Marokko und Spanien, und zwar durch unabhängige Kommissionen, sowie eine internationale Untersuchung, damit die Umstände dieser menschlichen Tragödie geklärt werden.
- Wir fordern ein Ende der kriminellen Politik der EU, die in Kooperation mit verschiedenen Staaten sowie internationalen und zvilgesellschaftlichen Organisationen durchgezogen wird.
- Wir fordern die diplomatischen Vertretungen der afrikanischen Länder in Marokko auf, ihre Verantwortung für den Schutz ihrer Bürger in vollem Umfang wahrzunehmen, statt sich zu Handlangern der Politik zu machen.
- Wir befinden uns in einem kritischen Moment. Das Recht auf Leben ist in Gefahr. Wir appellieren an alle Menschenrechtsorganisationen und Initiativen, die für die Rechte von Migrant*innen kämpfen, nicht tatenlos zuzusehen und Position zu beziehen.“
Aus Melilla ein Kommentar der spanischen Juristin und Politologin Irene Graiño Calaza:
Derzeit gibt es 27 tote Migranten und Hunderte von Verletzten (Stand: 25. Juni). Bilder und Videos von AMDH Nador und anderen Organisationen zeigen die enorme Brutalität, mit der die marokkanische Polizei in Zusammenarbeit mit den spanischen Streitkräften gegen die Einreise von Migrant*innen vorgeht. AMDH, Caminando Fronteras, das Kollektiv der subsaharischen Gemeinschaften in Marokko, der Verband zur Unterstützung von Migrant*innen in prekären Situationen und Attac Maroc hatten die Zustände in den Lagern seit Wochen kritisiert.
Präsident Sánchez bedankt sich für die tolle Zusammenarbeit
In der Erklärung der Verbände heißt es, die Eskalation sei eine Folge der erneuten Zusammenarbeit beider Länder bei der Grenzsicherung, wobei die Annäherung zwischen der Regierung Sánchez und dem Regime von Mohammed VI. auf Kosten der Menschen in der Westsahara geht. Die Bilder von AMDH Nador zeigen die willkürliche Gewalt der „gelungenen polizeilichen Kooperation“ und deren Folgen: Hunderte von Menschen, auf sich selbst gestellt, verletzt, schutzlos, die niemanden haben, der ihnen hilft, während die „Sicherheits“-Organe beider Staaten sich darin überbieten, es an Menschlichkeit fehlen zu lassen. Noch am Freitagabend bedankte sich der spanische Präsident Pedro Sánchez für das Vorgehen der marokkanischen Polizei in Melilla, die etliche Menschen das Leben kostete, und lobte „die außergewöhnliche Zusammenarbeit mit dem Königreich Marokko“.
Die Festung Europa spaltet Migrant*innen in „Erwünschte“ und „Kriminelle“
Wieder einmal wird die südliche Grenze zu einem Ort des Schreckens und der Entmenschlichung, einem Ort im Ausnahmezustand. Menschenrechtsverletzungen gegenüber Migrant*innen sind an der Tagesordnung. Das Szenario der Gewaltexzesse, Autoritätsmissbrauch, Straflosigkeit und Kriminalisierung werden von beiden Regierungen unter dem Label „intelligente Grenzpolitik“ subsumiert und billigend in Kauf genommen. Die Südgrenze als Einfallstor und Spiegel einer Festung Europa, die Migrant*innen in „Erwünschte“ und „Kriminelle“ spaltet. Spanien und ganz Europa betreiben eine Politik der Selektion und Exklusion von Migrant*innen mit Hilfe hierarchischer Unterdrückungsfaktoren: Herkunft, Nationalität, Geschlecht und Ethnie. Die Zurückweisung der Migrant*innen aus den Ländern des globalen Südens verläuft entlang den historischen Achsen der Unterdrückung. Die Migrationspolitik der Mitgliedstaaten der EU wird bestimmt von Rassismus und Kolonialismus. Die „Kooperation“ zwischen Spanien und Marokko bedeutet im Klartext: Marokko übernimmt für die EU die Rolle des Torwächters und kümmert sich darum, die erste Sicherheitskontrolle an der Südgrenze mit systematischer Brutalität durchzuführen. Die in den letzten Jahren eingeführten Grenzkontroll- und Sicherheitsmaßnahmen sind die tödlichste, egoistischste und unmenschlichste Facette der „Sicherheitspolitik“ des globalen Nordens, die für die Menschen aus dem Süden, Tod, Gewalt und unbeschränkte Verletzung bedeutet.
Es ist an der Zeit, dass der Norden historische Verantwortung übernimmt
Die Menschen aus dem Süden fliehen. Vor Massakern und Kriegen, vor Besatzung, den Folgen der Klimakrise, vor Ressourcenverknappung, extremer Armut und Hunger, für die der Norden direkt verantwortlich ist, weil er ihnen den Zugang verwehrt und sie damit zum Tode verurteilt. Was wir sehen, sind die Auswirkungen der Geschichte, die der Norden zu verantworten hat, auch wenn er nicht gern darüber spricht. Einer Geschichte von extremster Ressourcenplünderung, Vergewaltigung, Kolonialisierung, Extraktivismus, Missbrauch, Unterstützung von Diktaturen und Machteliten, Waffenlieferungen etc., die der Westen hinter Begriffen wie „bilaterale Kollaborations- und Kooperationsabkommen“ zu verbergen versucht. Es ist an der Zeit, dass der Norden historische Verantwortung übernimmt und Wiedergutmachung leistet an den Völkern, die systematisch ausgeplündert, unterdrückt und niedergemacht wurden. Als erster Akt der Verantwortung muss eine Migrations- und Asylpolitik umgesetzt werden, die ihren Namen verdient. Menschenrechtsverletzungen gegen Migrant*innen müssen gestoppt und sanktioniert werden. Wie wir sehen, setzt sich die Geschichte von Rassismus und Kolonialismus in den heutigen strukturellen Unterdrückungsmechanismen fort: Die Migrationspolitik arbeitet mit der Kontruktion des Andersseins, um Menschen aus einigen Ländern willkommen zu heißen, während andere brutal zurückgewiesen werden. Was das bedeutet, zeigen uns die Bilder aus Melilla. Die spanische Aufnahme- und Integrationspolitik muss auf Gleichheit, Nichtdiskriminierung, und den von Spanien eingegangenen Verpflichtungen zu Einhaltung der internationalen Menschenrechte erfolgen. Dass Menschen, die vor Gewalt fliehen, willkommen geheißen werden, darf nicht fallweise und auf der Grundlage einer ausgrenzenden Solidarität entschieden werden, sondern ist gemäß den europäischen und nationalen Rechtsvorschriften und den unterzeichneten internationalen Menschenrechtspakten eine Pflicht für Spanien und die EU. Die Festung Europa verstößt gegen ihre internationalen Menschenrechtsverpflichtungen und verletzt unter dem Vorwand der gemeinschaftlichen Grenzsicherung ihre eigenen Gesetze.
Die Opfer verdienen es, nicht vergessen zu werden
Was in Melilla passiert, ist extrem heftig. Es ist ein neuer Höhepunkt in der Geschichte der Abschottung, Kriminalisierung der Migration und Auslagerung der Grenzen, die in den letzten Jahren betrieben wurde. Migrationspolitik wird zu einer Politik des Todes; hier passt der von Achille Mbembe geprägte Begriff der Nekropolitik. Menschen, die vor einem Massaker fliehen, erwarten in der Festung Europa noch mehr Massaker, Gewalt und Tod. Es ist dringend erforderlich, die fortschreitende Gewalteskalation der Politik zu stoppen und Verantwortung zu übernehmen für das, was passiert. Wir brauchen eine sichere Migrationspolitik, die Menschen, die aus Notlagen fliehen, willkommen heißt. Angesichts der Gewalt in Melilla ist Schweigen eine unerträgliche Haltung, die Mitschuld schafft. Schluss mit der rassistischen und ausgrenzenden Migrationspolitik, die zu Tod und Unsicherheit führt! Die Bilder von AMDH Nador machen wütend. Also erheben wir die Stimme, um diese Menschenrechtsverletzungen und Ungerechtigkeiten anzuprangern und zu verurteilen. Die Opfer verdienen Anerkennung, Wiedergutmachung, Wahrheit und Gerechtigkeit, und sie verdienen es, nicht vergessen zu werden. Das Massaker an der EU-Grenze darf nicht ungesühnt bleiben.
Übersetzung: Lui Lüdicke
Quelle: Nachrichtenpool Lateinamerika Juni 2022/Bild Melilla von oben
Foto: JJ Merelo
CC BY-SA 2.0

Verstoß gegen die Menschenrechte in Ecuador
Mit Schusswaffen auf Demonstrant*innen
(Quito, 24. Juni 2022, mutantia.ch).- Militär vor dem Parlament, Misshandlungen von Festgenommenen und Polizisten, die mit Schusswaffen auf friedliche Demonstrant*innen schießen: Die staatliche Repression gegen die landesweiten Proteste in Ecuador, die seit dem 13. Juni im Gange sind, wird immer heftiger. Menschenrechtsorganisationen berichten von zahlreichen Missachtungen der Menschenrechte sowie der Gefährdung für Leib und Leben. Mindestens sechs Personen sind bei den Auseinandersetzungen bisher ums Leben gekommen.
Hinzu kommen Entführungen von Demonstrant*innen, die im Polizeifahrzeug vorübergehend festgehalten werden, und – bevor die Beamten sie irgendwo wieder auf freien Fuß setzen –, damit bedroht werden, dass man sie bei der nächsten Festnahme verschwinden lassen würde. Am Donnerstagabend (23.6.) sind mehrere Demonstrant*innen durch Pistolenschüsse von der Polizei verletzt worden. Sie saßen gerade beim Abendessen auf dem Trottoir bei der Universidad Central in Quito, als Polizisten vom Motorrad aus das Feuer eröffneten.
Festnahme des CONAIE-Präsidenten heizt Proteste an
Doch nicht nur das: Ähnlich wie beim Landesstreik im Oktober 2019, bei dem mindestens elf Personen ums Leben gekommen sind, schießt die Polizei Tränengaspatronen auch dieses Mal wieder auf die Köpfe und Körper der Menschen. In der Provinzhauptstadt Puyo im Amazonasgebiet zeigten Röntgenaufnahmen, wie sich eine dieser Patronen direkt in den Schädel eines Demonstranten gefressen hat. Der Mann war sofort tot. Bis Mittwochabend (22.6.) sind landesweit mehrere Dutzend Personen schwer verletzt worden, einzelne schweben in Lebensgefahr.
Aufgerufen zum Streik haben die Indigenen rund um Leonidas Iza, Präsident des Dachverbandes der Indigenen Nationen Ecuadors CONAIE. Dieser ist bereits am ersten Streiktag durch Militärs ohne Ausweis festgenommen worden – die Staatsanwaltschaft wurde zunächst nicht darüber informiert. Der 40-Jährige Umweltingenieur aus der Provinz Cotopaxi ist rund 24 Stunden später wieder freigelassen worden. Seine Verhaftung hat die Proteste erst so richtig angeheizt.
Zweiter landesweiter Streik in drei Jahren
Ecuador erlebt damit den zweiten Landesstreik innerhalb von drei Jahren. Grund für die Proteste sind die während der Pandemie gestiegenen Lebenshaltungskosten. Millionen von Ecuadorianer*innen haben keinen Zugang zu verlässlicher Gesundheitsversorgung oder Bildung – und inzwischen nicht einmal mehr zu Lebensmitteln. Das liegt insbesondere an den gestiegenen Treibstoffpreisen, die seit Juni 2020 ohne Subventionen auskommen. Die Regierung hat diese unter anderem auf Grund von Vereinbarungen mit dem Internationalen Währungsfonds aufgelöst.
Die Kosten für einen Liter Benzin sind um fast 50 Prozent angestiegen, was insbesondere die ärmeren Schichten stark bedrängt. Der Dachverband der Indigenen hat dem rechtskonservativen Staatspräsidenten Guillermo Lasso – einem Banker aus der Wirtschaftsmetropole Guayaquil, der seit Mai 2021 an der Macht ist – mehrmals Vorschläge für ein anderes Wirtschaftsprogramm unterbreitet. Doch nach einem Jahr Verhandlungen ohne Resultate haben die Indigenen, deren Werte von der ecuadorianischen Oberschicht nie anerkannt worden sind, die Geduld verloren, und versuchen nun durch landesweite Blockaden das Land lahmzulegen. Insbesondere die Städte, wo ein Großteil der 18 Millionen Einwohner*innen leben, sollen von der Lebensmittelversorgung abgeschnitten werden. In einzelnen Teilen des Landes sind die Regale bereits leer. Unterstützt werden die Indigenen unter anderem von Gewerkschaften, Student*innen- und Lehrer*innenorganisationen sowie von Feminist*innen und Arbeiter*innen.
Konservativer Präsident setzt auf Härte
Guillermo Lasso, der eng mit dem ultrakonservativen Opus Dei verbandelt ist, hat auf Grund der Ereignisse den Ausnahmezustand für mittlerweile sechs Provinzen ausrufen lassen. Hinzu kommt der Ausnahmezustand in Esmeraldas, Manabi und Guayas, der in Zusammenhang mit den an Einfluss gewinnenden Drogenkartellen steht. Will heißen: Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 5 Uhr sowie eingeschränkte Versammlungsfreiheit.
Lasso weiß große Teile der ecuadorianischen Wirtschaftseliten hinter sich, und kann auf die Verzweiflung jener zählen, die nach zwei Pandemie-Jahren wieder arbeiten wollen, und sich gegen den Landesstreik organisiert haben. So kam es in Quitos Vorort Tumbaco zu mehreren Schießereien zwischen Demonstrant*innen und Bürgern, die arbeiten wollen.
Übersetzung: Christian Cray
Nähere Angaben zur Situation in Ecuador finden sich auch auf der Homepage mutantia.ch (auf Spanisch).
Quelle: Nachrichtenpool Lateinamerika Juni 2022/ Bild Menschenrechtsorganisationen in Ecuador beklagen übermäßige Polizeigewalt: Polizist einer Spezialeinheit in der Altstadt von Lima.

Info über Kolumbien im Kampf um die Menschenrechte
Francia Márquez. Von der Umweltaktivistin zur Vizpräsidentin
(Bogotá, 21. Juni 2022, Ecupres).- Francia Márquez wurde 1981 in einem Dorf namens Yolombó im Department Cauca geboren. Hier haben große Bergbaufirmen das Sagen; wirtschaftliche Abhängigkeit und soziale Kämpfe bestimmen den Alltag. Einen Teil des Familieneinkommens bestritt die Mutter durch ihre Tätigkeit als Hebamme in der örtlichen Gesundheitsversorgung, Francias Vater arbeitete in den Minen, und auch sie selbst hatte ihren ersten Job als traditionelle Goldschürferin. Danach begann sie als Hausangestellte zu arbeiten und wurde mit 16 Jahren zum ersten Mal Mutter. Trotzdem schaffte sie es, sich an der Universität von Santiago de Cali einzuschreiben und ein Jurastudium zu absolvieren.
Eine Geschichte des militanten Widerstands gegen Extraktivismus
Währenddessen nahmen Umweltschäden in ihrer Heimatregion zu. Hunderte von Menschen in der Umgebung ihres Dorfs wurden zwangsumgesiedelt. Diese beiden Faktoren bezeichnete Márquez später als Auslöser für ihr politisches und soziales Engagement: Die Vergabe von Bergbautiteln an Unternehmen in aller Welt beförderte einen umweltschädlichen Extraktivismus, dazu mehrten sich Menschenrechtsverstöße. 2009 setzte Márquez sich für den Fluss Ovejas ein und forderte, das Gewässer vor der Verschmutzung durch den Bergbau zu bewahren. Viele weitere Aktionen folgten und brachten ihr öffentliche Anerkennung und verschiedene Auszeichnungen ein, darunter der Goldman-Preis, der als Umweltnobelpreis gilt. 2014 nahm sie an einem interkulturellen Runden Tisch teil, bei dem der kolumbianischen Regierung die Forderung vorgelegt wurde, den illegalen Bergbau und die Vergabe von Bergbautiteln ohne vorherige Konsultation in den Gebieten indigener Gemeinschaften zu unterbinden. Die von ihr geäußerten Korruptionsvorwürfe machten sie zur Zielscheibe paramilitärischer Attacken.
Zunehmende Bedrohung durch Paramilitärs
Als sie im selben Jahr gewaltsam von ihrem Wohnort vertrieben wurde, organisierte Márquez zusammen mit etwa 70 weiteren Afrokolumbianerinnen den „Marsch der Turbane“. Die Aktion war aus der Initiative „Schwarze Frauen für die Bewahrung des Lebens und der angestammten Gebiete“ hervorgegangen. Der Marsch setzte sich am 17. November in Bewegung und zog 600 Kilometer weit von Suárez bis in die Hauptstadt Bogotá, wo die Aktivistinnen ein energisches Vorgehen gegen den illegalen Bergbau forderten. Während der Friedensgespräche zwischen der Regierung Santos und der Führung der FARC reiste Márquez ebenfalls nach Kuba. 2015 nahm sie an einer Gemeindeversammlung im Norden von Cauca teil, die sich für den Schutz von Menschenrechtsaktivist*innen engagierte und die kolumbianischen Regierung aufforderte, gegen die ständigen Bedrohungen vorzugehen. Ihre wachsende Bekanntheit als antirassistische Aktivistin und militante Vertreterin der Landbevölkerung brachte ihr zunehmend Angriffe und Drohungen ein. 2019 verübten Paramilitärs sogar ein Attentat auf Márquez, die zu dem Zeitpunkt als Gemeinderätin im Dorf La Toma de Suárez tätig war.
Ein Symbol der Hoffnung für alle Marginalisierten
Bei der Präsidentschaftswahl schreckten Vertreter des konservativen Spektrums nicht davor zurück, Márquez‘ Eignung für das Amt der Vizepräsidentin in Frage zu stellen: Eine Frau, und noch dazu eine Afrokolumbianerin sei wohl kaum die passende Besetzung für den Posten. Wie um ihren Kritikern zu trotzen, kandidierte Márquez in den für ihre Region typischen farbenfrohen Kostümen und zog mit ihrem rhetorischen Geschick die Wähler*innen, vor allem die jungen, in ihren Bann. Márquez entwickelte sich zu einem politischen Phänomen, einem Symbol der Hoffnung für die Marginalisierten, die in der Politik traditionell an den Rand gedrängt und vergessen werden. Auch einen weiteren Kritikpunkt, der ihr während des Wahlkampfs immer wieder angetragen wurde, ihre mangelnde Erfahrung in der parteipolitischen Arena, wusste sie geschickt zu kontern: „Immer wieder wird mir vorgeworfen, ich besäße nicht die nötige Erfahrung, um Gustavo Petro zu begleiten und dieses Land zu regieren. Da frage ich mich doch: Warum hat ihre Erfahrung es uns nicht möglich gemacht, in Würde zu leben? Warum hat ihre Erfahrung uns so viele Jahre dieser Gewalt ausgesetzt, die mehr als acht Millionen Menschen das Leben gekostet hat? Warum hat ihre Erfahrung nicht allen Kolumbianern ein Leben in Frieden beschert?“
Wo immer ihr auch seid…
Einen Teil ihrer ersten Rede als neugewählte Vizepräsidentin widmete Francia den sozialen Bewegungen und Kämpfen von Minderheiten. „Wir Frauen werden das Patriarchat in unserem Land besiegen, wir werden uns für die Rechte der LGBTIQ+-Gemeinschaften einsetzen, für die Rechte unserer Mutter Erde, die Rechte des großen Hauses. Um dieses große Haus, unser großes Haus müssen wir uns kümmern, um die biologische Vielfalt, und gemeinsam werden wir den strukturellen Rassismus besiegen.“ Ihren Erfolg bei der Präsidentschaftswahl widme sie „allen sozialen Führungspersönlichkeiten, die in diesem Land ermordet wurden, den Jugendlichen, die ermordet wurden, die verschwunden sind, den Frauen, die vergewaltigt wurden, die verschwunden sind. All‘ jenen, von denen ich weiß: Ihr seid bei uns in diesem Augenblick, diesem für Kolumbien so bedeutenden historischen Moment.“
Quelle: Nachrichtenpool Lateinamerika Juni 2022/Bild Foto: Enlace Noticias Barrancabermeja
CC BY 3.0

Verstoß gegen die Menschenrechte
„Willkommen in Guantanamo!”
Amnesty International prangert Misshandlung von Flüchtlingen in Litauen sowie rassistische Diskriminierung nichtweißer gegenüber ukrainischen Flüchtlingen an, spricht von „Folter“.
27
JUN
2022
VILNIUS/WARSCHAU/BRÜSSEL (Eigener Bericht) – Litauische Grenzbeamte und Lagerwächter misshandeln regelmäßig nichtweiße Flüchtlinge und brechen dabei mit ihrem Vorgehen das Völkerrecht. Das belegt eine neue Untersuchung, die Amnesty International heute veröffentlicht. Demnach wurden Flüchtlinge bei der illegalen Zurückweisung an Litauens Grenze zu Belarus etwa in einen Fluss mit brusthohem Wasser getrieben. Andere wurden mit Stöcken und mit Elektroschockern malträtiert. Die Lebensbedingungen in Litauens Internierungszentren kommen laut Amnesty „Folter gleich“. Explizit prangert die Organisation die Diskriminierung nichtweißer gegenüber ukrainischen Flüchtlingen an, die mit offenen Armen empfangen werden. Nichtweiße Flüchtlinge hingegen sind an den Grenzen wie auch in den Lagern zusätzlich einem krassen Rassismus ausgesetzt. Ähnliche Verhältnisse hatte Amnesty bereits im April in Polen festgestellt. Amnesty schreibt der EU und insbesondere der EU-Kommission unter ihrer deutschen Präsidentin Ursula von der Leyen Mitverantwortung zu: Brüssel unterstützt die Grenzabschottung, nimmt aber Misshandlungen und Völkerrechtsbrüche an den Grenzen faktisch hin.
In den Grenzfluss getrieben
Die Völkerrechtsbrüche und die Misshandlungen, denen nichtweiße Flüchtlinge in Litauen ausgesetzt sind, beginnen quasi zur Begrüßung unmittelbar an der Grenze, wo litauische Grenzer Einreisewillige, die nicht aus der Ukraine kommen, regelmäßig zurückweisen – ohne jede Prüfung ihres Asylgesuchs und damit unter offenem Bruch des Völkerrechts. Flüchtlinge bestätigten Amnesty International, man habe ihnen ihre Handys, zuweilen auch ihr Geld abgenommen, bevor man sie – nicht selten bei Minustemperaturen – ohne Wasser und Nahrung in belarussische Wälder abgeschoben habe. Dabei seien sie mit Stöcken geschlagen, mit Elektroschockern misshandelt worden. Zuweilen wurden Flüchtlinge durch einen Fluss nach Belarus getrieben und mussten dabei brusthohes Wasser durchqueren. Mehrere Kubaner wurden Amnesty International zufolge acht Mal hin und her über die Grenze gezwungen, bevor es ihnen gelang, einen Beschluss des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte herbeizuführen. Dieser verpflichtete Vilnius zur Prüfung ihres Asylbegehrens. Sogar das hielt die litauischen Grenzschützer nicht ab, die Kubaner noch nach der Gerichtsentscheidung ein weiteres Mal über die Grenze nach Belarus abzuschieben – unter doppeltem Bruch des Völkerrechts.[1]
„Wie Folter“
Diejenigen Flüchtlinge, denen die Einreise gelingt, werden von den litauischen Behörden willkürlich unter inhumanen Bedingungen interniert. Eine Amnesty International-Delegation konnte im März zwei Internierungszentren besuchen (Medininkai, Kybartai), erhielt dabei aber nur Zugang zu ausgewählten Teilen der Einrichtungen und musste Interviews mit Flüchtlingen vorzeitig abbrechen. Laut Amnesty sind die Zentren „hochgradig militarisiert“, von Mauern, Zäunen und Stacheldraht umgeben; sie sind massiv überfüllt, Wasser und Nahrung sind von schlechter Qualität, der Zugang zu medizinischer Versorgung ist völlig unzulänglich. Die Lebensbedingungen, konstatiert Amnesty, „kommen nach internationalem wie auch nach EU-Recht Folter und anderen Formen von Misshandlung gleich“. Schon im November 2021 wurden Proteste gegen die schlimme Lage in Medininkai mit Tränengas niedergeschlagen. Zuletzt waren – Stand: 6. Juni – 2.647 Menschen in den Zentren interniert, darunter 592 Minderjährige. Hinzu kommt, dass die Asylverfahren, die den Flüchtlingen gewährt werden, international gültigen Anforderungen auch nicht im Geringsten entsprechen. Die litauischen Behörden üben zudem beträchtlichen Druck auf Internierte aus, vorgeblich freiwillig in ihre Herkunftsländer zurückzukehren.
Gewalt und Rassismus
Amnesty weist in dem Bericht ausdrücklich auf den „bemerkenswerten Unterschied“ in der Behandlung ukrainischer und nichteuropäischer Flüchtlinge hin. In Litauen seien alleine bis Mai 2022 mehr als 50.000 geflohene Ukrainer registriert worden; das zeige, dass die Frage, ob man Flüchtlinge aufnehme oder nicht, keinem Sachzwang geschuldet sei, sondern von politischen Prioritäten abhänge. Ihre Diskriminierung im Vergleich zu weißen ukrainischen Flüchtlingen wird von den nichtweißen Flüchtlingen in den Internierungszentren genau registriert; als es deshalb – und wegen der desolaten Situation in den Lagern – am 1. März in Medininkai erneut zu Protesten kam, schlugen die Repressionsbehörden diese wieder mit Gewalt nieder. Flüchtlinge berichteten, teils mit Stöcken verprügelt worden zu sein; eine Gruppe schwarzer Frauen wurde halb entkleidet mit gefesselten Händen bei großer Kälte im Freien festgehalten. Vor allem schwarze Flüchtlinge berichteten Amnesty, sie seien in den Lagern wie zuvor an der Grenze regelmäßig rassistischen Übergriffen durch litauisches Personal ausgesetzt. Ihr sei gesagt worden, sie solle doch einfach „in den Wald zum Jagen“ gehen, berichtete eine junge Frau aus einem Land in Afrika südlich der Sahara der Amnesty-Delegation; „alle Wächter“ seien „sehr rassistisch“.
„Rassismus und Heuchelei“
Die Völkerrechtsbrüche und die Misshandlung von Flüchtlingen in Litauen sind keine Einzelfälle. Bereits im April hatte Amnesty International ganz ähnliche Verhältnisse in Polen ausführlich dokumentiert. Demnach werden auch dort nach wie vor Flüchtlinge illegal unmittelbar an der Grenze zurückgewiesen, zuweilen unter vorgehaltener Waffe.[2] Polen hat ebenfalls Internierungszentren eingerichtet, in denen Flüchtlinge in überfüllten Zellen ohne angemessenen Zugang zu sanitären Einrichtungen und medizinischer Hilfe festgehalten werden. Im Internierungslager Wędrzyn mussten, als Amnesty Recherchen durchführte, bis zu 24 Männer in acht Quadratmeter großen Räumen dahinvegetieren. Viele Flüchtlinge waren unwürdiger Behandlung, etwa überflüssigen Leibesvisitationen, oder teils rassistischen Beleidigungen ausgesetzt; einige, darunter Personen, die vor Folter in ihren Herkunftsländern geflohen waren, wurden mit dem Ruf „Willkommen in Guantanamo!“ begrüßt. Amnesty weist darauf hin, dass allein im vergangenen Jahr rund 2.000 Flüchtlinge in Polen unter den erwähnten katastrophalen Bedingungen interniert wurden. Dass dies bis heute fortgesetzt wird, während Flüchtlinge aus der Ukraine mit offenen Armen empfangen werden, hat Amnesty zufolge einen „Beigeschmack von Rassismus und Heuchelei“.
Die tödlichsten Grenzen der Welt
Die Abschottung der polnischen und der litauischen Grenze zu Belarus sowie die illegalen Rückschiebungen haben Todesopfer gekostet; im Grenzgebiet sind inzwischen mehr als 20 Todesfälle unter Flüchtlingen dokumentiert.[3] Flüchtlingshelfer gehen freilich von einer hohen Dunkelziffer und einer entsprechend erheblich höheren Zahl an Todesfällen aus. Die Todesopfer an EU-Außengrenzen in anderen Regionen kommen hinzu. Am Freitag kamen beim Versuch von rund 2.000 Flüchtlingen, die drakonisch abgeschottete Grenze zwischen Marokko und der spanischen Exklave Melilla zu überwinden, mindestens 23 Flüchtlinge zu Tode. Einige verstarben, weil die Grenzbeamten sie stundenlang ohne medizinische Hilfe verletzt am Boden liegen ließen.[4] An den südlichen und südöstlichen Grenzen der EU sind in diesem Jahr laut Angaben der International Organization for Migration (IOM) mindestens 850 Flüchtlinge ums Leben gekommen. Die Gesamtzahl der an den EU-Mittelmeergrenzen verstorbenen Migranten beläuft sich der IOM zufolge seit 2014 auf mehr als 24.000; die Organisation geht ebenfalls von einer großen Dunkelziffer aus. Die EU-Außengrenzen sind demnach unverändert die tödlichsten Grenzen der Welt: Auf dem afrikanischen Kontinent kamen seit 2014 rund 11.500 Menschen zu Tode, weniger als halb so viele wie bei der Einreise in die EU; in Zentralamerika verloren im selben Zeitraum fast 6.500 Menschen ihr Leben. Rund die Hälfte aller Flüchtlingstode weltweit geht damit auf das Konto der ihre Grenzen abschottenden EU.
[1] Belege und Zitate hier und im Folgenden aus: Lithuania: Forced out or locked up. Refugees and migrants abused and abandoned. London, 27.06.2022.
[2] Poland: Cruelty not compassion, at Europe’s other borders. London, 11.04.2022.
S. auch Flüchtlingssterben im Niemandsland (III).
[3] Sertan Sanderson: Poland to end state of emergency upon completion of border wall. infomigrants.net 10.06.2022.
[4] Sturm auf spanische Exklave – Zahl der Toten steigt. zeit.de 26.06.2022.
GERMAN-FOREIGN-POLICY.com v.27.06.2022
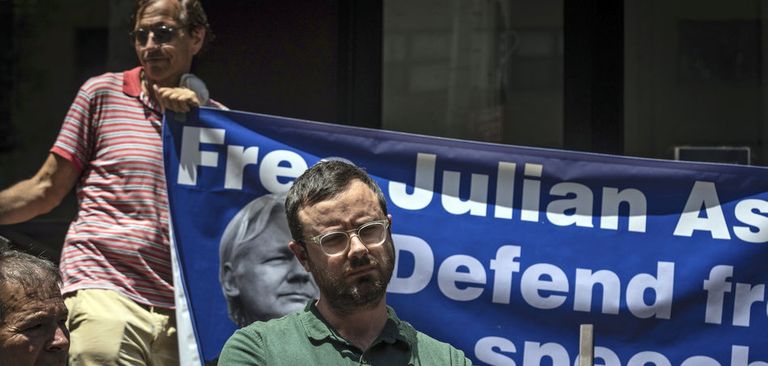
Kampf um die Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 21.06.2022, Seite 8 / Abgeschrieben
Freiheit für Assange!
In einer gemeinsamen Pressemitteilung forderten Sevim Dagdelen (Die Linke), Ulrich Lechte (FDP), Max Lucks (Bündnis 90/Die Grünen) und Frank Schwabe (SPD) – Mitglieder der fraktionsübergreifenden Abgeordneten-AG »Freiheit für Julian Assange« – am Montag, die Auslieferung von Julian Assange an die USA zu verhindern:
Journalisten sollten für ihre Arbeit nicht verfolgt und bestraft werden. Nirgendwo. Die Entscheidung der britischen Innenministerin Priti Patel, die Auslieferung des Journalisten Julian Assange an die USA zu genehmigen, ist bedauerlich und falsch. Im Interesse der Pressefreiheit wie auch aus humanitären Gründen muss Julian Assange umgehend freikommen.
Wir appellieren an Großbritannien, die Auslieferung von Julian Assange an die USA, wo ihm wegen der Enthüllung von Kriegsverbrechen 175 Jahre Gefängnis drohen, nicht zu vollstrecken. Wir rufen US-Präsident Joe Biden auf, die Klage gegen Julian Assange fallenzulassen. Wir fordern die britische Regierung auf, endlich die Pressefreiheit zu verteidigen und das Europäische Menschenrechtssystem nicht länger zu ignorieren. Nach einer jüngsten Resolution der parlamentarischen Versammlung des Europarates ist Julian Assange unverzüglich freizulassen. Wir fordern die Bundesregierung auf, bei Gesprächen mit dem Vereinigten Königreich dieser Forderung entschlossen Nachdruck zu verleihen und sich für die Freilassung von Julian Assange einzusetzen sowie bei US-Präsident Joe Biden auf ein Ende der politischen Verfolgung des Journalisten zu drängen. (…)
In einem Appell der Initiative »Frieden links« an die Delegierten des Linke-Parteitags am kommenden Wochenende in Erfurt heißt es:
Die 20er Jahre dieses Jahrhunderts entwickeln sich zum gefährlichsten Jahrzehnt der Geschichte. (…) Es geht um nicht weniger als den Fortbestand der Zivilisation. Die Atomkriegsgefahr war laut SIPRI seit dem Kalten Krieg nie größer, die amerikanischen Atomwissenschaftler haben ihre »Weltuntergangsuhr« auf 100 Sekunden vor Mitternacht vorgestellt. (…) Daraus ergibt sich die Verantwortung der Linken, auf eine Friedensordnung hinzuwirken, die Militärbündnisse wie die NATO überwindet. (…) Doppelte Standards der einseitigen Kritik nur an Russland sind ein zentrales Element der Propaganda für Hochrüstung und Eskalation durch die NATO und ihre Lobby. Die NATO-Führungsmacht USA hat durch Kündigung und Nichtverlängerung von Verträgen zur Rüstungskontrolle und Abrüstung die Lage in Europa weiter destabilisiert. Die Priorität auf schwere Waffen statt Diplomatie verschlimmert die Katastrophe. (…)
Die Rüstungskonzerne in den NATO-Staaten drängen die Politik zu einer immer weiteren Bewaffnung der Staaten, zu immer mehr und immer ausgefeilteren und gefährlicheren Arsenalen, die das Potential einer finalen Katastrophe in sich bergen. Ihre Profite und Aktienkurse erreichen seit dem Ukraine-Krieg immer neue Rekordmarken. Sie und die fossile Industrie sind Kriegsgewinnler, die auf einen langen Krieg spekulieren. (…)
Die Linkspartei des Erfurter Programms ist in dieser globalen und nationalen Situation unverzichtbar als Partner der alternativen Bewegungen für Frieden, Solidarität und Ökologie – als Alternative zum Kurs der Militarisierung der anderen Bundestagsparteien. Die inner- und außerparlamentarische Opposition ist heute so gefordert wie lange nicht.
Quelle: junge Welt 21.06.2022 Robert Bumsted/AP Photo

Menschenrechtsverletzungen von VW in Brasilien
Aus: Ausgabe vom 17.06.2022, Seite 9 / Kapital & Arbeit
MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN
»Arbeiter schlechter als Vieh behandelt«
Vorwurf der Sklaverei gegen VW: Anhörung in Brasilien zu Zuständen auf Farm zwischen 1974 und 1986
Von Norbert Suchanek, Rio de Janeiro
Der Vorwurf wiegt schwer: Seit 2019 ermittelt die brasilianische Staatsanwaltschaft gegen den VW-Konzern wegen Sklavenarbeit und Menschenrechtsverletzungen auf einer Rinderfarm in Amazonien während der Militärdiktatur. Am Dienstag kam es zur ersten außergerichtlichen Anhörung vor dem Arbeitsministerium in Brasilia. Es ging um eine mögliche Vereinbarung über Entschädigungszahlungen. Doch die geladenen Anwälte des Autokonzerns schwiegen zu den Vorwürfen. Bis zum 27. September muss sich VW nun schriftlich zu den Ermittlungen äußern.
Die zur Last gelegten Verbrechen sollen zwischen 1974 und 1986 auf der rund 140.000 Hektar großen Rinderfarm »Vale do Rio Cristalino« des Autoherstellers im Bundesstaat Pará verübt worden sein. Zur Abholzung des dicht bewaldeten Gebiets, in dem Platz für mehr als 100.000 Rinder geschaffen werden sollte, beauftragte damals »VW do Brasil«, die brasilianische Tochter des Unternehmens, »kriminelle« Arbeitsvermittler, »Gatos« genannt. Diese stellten Hunderte von Leiharbeitern an, die den Wald roden mussten. Laut Anhörungsprotokoll herrschten auf der VW-Fazenda Zustände von moderner Sklaverei, der Konzern habe davon gewusst.
Augenzeugenaussagen zufolge seien die Angestellten mit Waffengewalt auf der Farm festgehalten worden. Wer zu fliehen versuchte, wurde erschossen oder an einen Baum gefesselt, tagelang geschlagen oder anderweitig gefoltert. Die Leiharbeiter waren einem brutalen System von Schuldknechtschaft ausgeliefert, in dem sie die täglichen Lebensmittel zu hohen Preisen von den »Gatos« kaufen und ihren ganzen Lohn dafür ausgeben mussten.
»Als wir die ersten 100 Hektar gerodet hatten, hatten wir eine Menge Schulden bei den Arbeitsvermittlern«, erinnerte sich der ehemalige Arbeiter José Pereira, der zusammen mit anderen Opfern Entschädigungen von VW einfordert, im ARD-»Weltspiegel« vom 29. Mai. »Wenn jemand versuchte wegzulaufen, kamen die Wachen hinter ihm her und schossen auf ihn«. Der zuständige Staatsanwalt Rafael Garcia Rodrigues wies auch darauf hin, dass die Menschen ohne Einhaltung der Mindeststandards für Hygiene, Gesundheit und Sicherheit auf der abgelegenen Farm arbeiten mussten. Zudem soll es zu Vergewaltigungen gekommen sein.
Die Ermittlungen stützen sich auf eine Untersuchung der »Forschungsgruppe über Sklavenarbeit« der Bundesuniversität von Rio de Janeiro. Deren Koordinator, Ricardo Rezende Figueira, hatte den Konzern bereits in den 1980er Jahren wegen der sozialen Missstände und Menschenrechtsverletzungen auf der Rinderfarm angeklagt – damals vergeblich.
Gegenüber der Deutschen Welle erklärte er am Montag, dass sowohl das brasilianische wie auch das deutsche VW-Management von den Verbrechen wusste. So seien bei einem organisierten Besuch auf der Ranch im Jahr 1983 die Arbeiter versteckt worden. Rezende: »Sie behandelten die Arbeiter schlechter als das Vieh. Für die Rinder gab es gutes Futter, gute Weiden, Veterinärmedizin und wissenschaftliche Forschung. Für die Arbeiter gab es nichts.«
Der Schweizer Agronom Friedrich Brügger, der zwölf Jahre lang die Rinderfarm leitete, hält die Vorwürfe für »an den Haaren herbeigezogen« und »völligen Blödsinn«. Im »Weltspiegel« sagte er: »Wo über 1.000 Männer auf einem Raum sind, geht es nicht immer zart zu. Das liegt auf der Hand. Vor allem mitten im Urwald.«
Bei Volkswagen lösten die Äußerungen des ehemaligen Farmmanagers alles andere als Begeisterung aus. In einer Stellungnahme gegenüber der Deutschen Welle erklärte das Unternehmen: »Wir möchten darauf hinweisen, dass Herr Friedrich Brügger nicht für die Volkswagen AG spricht und dass seine Aussagen den Werten von Volkswagen widersprechen«. Volkswagen nehme die geschilderten Vorgänge auf der Fazenda Rio Cristalino sehr ernst.
Die nächste Anhörung soll am 29. September in Brasilia stattfinden. Staatsanwalt Rodrigues ist zuversichtlich und geht davon aus, dass der Autokonzern Entschädigungen für die schweren Menschenrechtsverletzungen zahlen wird.
Quelle: junge Welt v.17.6.2022 Andressa Andressa/dpa
José de Lima Ramos Pereira (Mitte), der für Arbeitsrecht zuständige Generalstaatsanwalt, und die Anwälte von Volkswagen in Brasilien bei einer Anhörung am Dienstag in Brasília
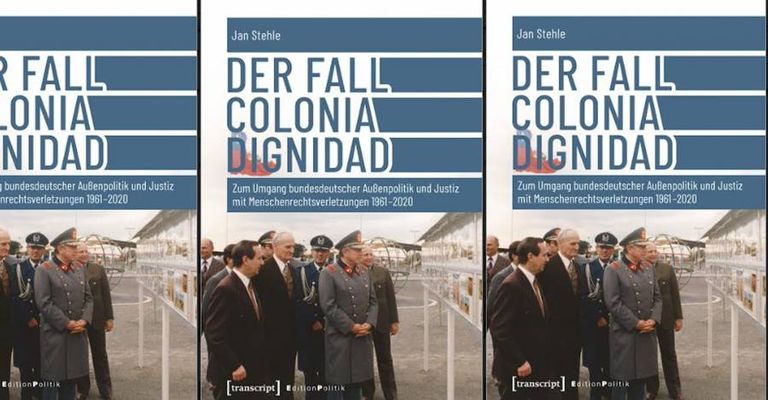
Info über Chile-Deutschland
Doktorarbeit
Rezension: 'Der Fall Colonia Dignidad - Der Umgang mit deutscher Außenpolitik und Gerechtigkeit gegenüber Menschenrechten: 1961-2020'
Dieser Text ist ein Überblick über die Doktorarbeit des Politikwissenschaftlers der Freien Universität Berlin Jan Stehle, der mehr als 10 Jahre lang in Archiven, Akten und lebenden Quellen forschte, um die Verantwortung des deutschen Staates im Falle der in Chile ansässigen Sekte zu charakterisieren. Die Rezension wurde von Ute Löhning verfasst, die an der letzten Auflage des Ende 2021 erschienenen Buches beteiligt war.
Die Colonia Dignidad war ein "Staat im Staate", in dem chilenische oder deutsche Gesetze nicht in Kraft waren, sondern die Hierarchen um den Laienprediger Paul Schäfer herrschten. Seine Herkunft, seine Strukturen in Deutschland und Chile, seine Unterstützungsnetzwerke – und die politischen und rechtlichen Verantwortlichkeiten beider Staaten – zu analysieren: Das war das Ziel des Politikwissenschaftlers Jan Stehle, als er sich diesem Thema in seiner Doktorarbeit widmete. Es war bis zu einem ziemlich fortgeschrittenen Niveau, das viele Quellen ansprach und analysierte. Im Oktober 2021 erschien diese Doktorarbeit als 640-seitiges Buch in deutscher Sprache, und Sie können das vollständige PDF herunterladen. Das Buch ist auf Deutsch, aber da es eine große Relevanz für Chile hat, ist zu erwarten, dass es später ins Spanische übersetzt wird. Diese ausführliche Überprüfung versucht, einige wichtige Informationen zusammenzufassen.
Der Politikwissenschaftler Jan Stehle forscht seit zwölf Jahren: 2021 erschien seine Doktorarbeit im transkribierten Verlag: "Der Fall Colonia Dignidad: Zum Umgang bundesdeutscher Außenpolitik und Justiz mit Menschenrechtsverletzungen 1961-2020". Damit bietet der Autor die bisher genaueste Analyse der (Mit-)Verantwortung deutscher und chilenischer Institutionen bei den Verbrechen, die in dieser Siedlung der deutschen Sekte in Chile begangen wurden.
"Die Colonia Dignidad war eine nach innen gerichtete kriminelle Gemeinschaft und eine international operierende kriminelle Organisation", ist eine der zentralen Aussagen des Politikwissenschaftlers und Ökonomen Jan Stehle. Mit seinem über 600-seitigen Buch legt er eine systematische Bestandsaufnahme und eine Bewertung der 1961 in Chile gegründeten deutschen Siedlung und der dort begangenen Verbrechen vor, die weder das Auswärtige Amt noch die deutsche Justiz durchführen wollten oder konnten.
Bei der Analyse der Quellen zeigt sich, wo und wann deutsche (und chilenische) Behörden hätten eingreifen und Menschenrechtsverletzungen stoppen können, dies aber nicht taten. Auf der Suche nach einer "historischen Wahrheit" hat der Autor ein Nachschlagewerk geschaffen, auf dem nun weitere Forschungen aufbauen können. Denn die Aufklärung der Geschichte dieser Siedlung und der darin begangenen Verbrechen ist noch lange nicht abgeschlossen.
In einer gründlichen Untersuchung und präzisen Analyse hat Stehle alle verfügbaren Quellen deutscher Behörden ausgewertet – und auch von vielen chilenischen. Er musste große Anstrengungen unternehmen, um Zugang zu den Akten des Politischen Archivs des Auswärtigen Amtes zu erhalten, indem er Klagen nach dem Bundesarchivgesetz und dem Informationsfreiheitsgesetz einreichte. Die Akten des externen Nachrichtendienstes (BND) sind für ihn derzeit noch gesperrt.
Der Autor hat auch mehrere einzelne Archive analysiert und unzählige Interviews mit Zeitzeugen geführt. Daher ist das Buch mit einer Vielzahl von Zitaten, Referenzen und Originaldokumenten angereichert. Um mit der großen Menge an Daten und Dokumenten umgehen zu können, strukturiert Stehle seine Arbeit sehr übersichtlich nach chronologischen und inhaltlichen Kriterien. So können Sie einzelne Kapitel lesen, nach bestimmten Informationen suchen oder das Buch als Nachschlagewerk verwenden. Besonders informativ ist das Kapitel zur rechtlichen und politischen Klärung. Doch zunächst gibt der Autor einen Überblick über die Entwicklung der Colonia Dignidad und die Menschenrechtsverletzungen, die dort begangen wurden.
Interne und externe Straftaten
Der Politikwissenschaftler und Ökonom beschreibt zwei komplementäre Gesichter der Colonia Dignidad: die innere Struktur einer "pseudoreligiösen kriminellen Gemeinschaft", die fast ein halbes Jahrhundert lang "interne Verbrechen" gegen ihre eigenen Mitglieder begangen hat. Zu diesem Zweck analysiert sie zahlreiche Fälle von sexualisierter Gewalt und Zwangsaneignungen, Freiheitsentzug und Zwangsarbeit gegen Mitglieder der Gruppe. Zweitens untersucht es die Struktur einer "kriminellen Organisation", die "externe Verbrechen" begangen hat, die sich gegen Menschen außerhalb der Siedlung richten. Dazu gehören betrügerische Adoptionen und Sexualverbrechen an chilenischen Kindern aus der ländlichen Gegend um Colonia Dignidad sowie Waffenhandel und -produktion, Folter und Ermordung politischer Gefangener während der chilenischen Diktatur (von 1973 bis 1990).
Um die Kontinuität der Strukturen und Verbindungen zu verdeutlichen, die die Entwicklung und Beharrlichkeit der Siedlung ermöglichten, führt er den Begriff "Colonia Dignidad System" ein. Dies bezieht sich auf und analysiert nicht nur die Hierarchie der Gruppe, sondern auch die Rechtspersönlichkeiten und Wirtschaftsstrukturen der jeweiligen Branchen sowie die Unterstützungsnetzwerke in Deutschland und Chile. Stehle nennt "aufklärerische" Akteure, die oft allein bekämpft wurden: darunter Menschen, die aus der Colonia Dignidad geflohen waren, Opfer- und Angehörigengruppen, Menschenrechtsorganisationen, Aktivisten, Anwälte und Journalisten. Sein Engagement war für jeden Schritt der Klärung entscheidend. Es gab nur sehr wenige Menschen in staatlichen Institutionen, die diese Bemühungen unterstützten.
Historische Phasen
Fünf historische Phasen prägen die Geschichte der Colonia Dignidad laut Stehle:
Es beschreibt ausführlich die Entstehungsgeschichte in der Nachkriegs-Bundesrepublik Deutschland. Paul Schäfer arbeitete damals als Jugenderzieher in evangelisch-lutherischen Heimen. Dort wurde er mehrfach gefeuert, weil er bereits Kinder sexueller Gewalt ausgesetzt hatte. Darüber hinaus bereiste er als charismatischer Laienprediger Gemeinden unabhängiger evangelikaler Kirchen und versammelte viele Menschen – oft desorientiert oder vom Krieg traumatisiert – um sich.
Gemeinsam mit den Baptistenpredigern Hugo Baar und Hermann Schmidt gründete Schäfer 1956 den Verein "Private Sociale Mission" und 1960 ein Kinderheim im nordrhein-westfälischen Heide. Als Beleg für die frühe Unterstützung durch deutsche und chilenische Institutionen erwähnt Stehle, dass ein Vertreter des Bundesministeriums für Familie und Jugend sowie der chilenische Botschafter in Deutschland, Arturo Maschke, an der Einweihungsfeier des Heims teilnahmen und die anschließende Überführung der Gruppe nach Chile unterstützten.
Der Autor beschreibt auch ausführlich die Auswanderung der Gruppe nach Chile. Nachdem die Eltern zweier Kinder Schäfer 1961 erstmals wegen sexueller Gewalt gegen ihre Kinder angezeigt hatten, ging er nach Chile. Rund 300 Follower folgten. Unter ihnen waren mehrere quasi entführte Kinder, die Eltern einiger hatten nur Einverständniserklärungen für ihre Kinder unterschrieben, für einige Wochen mit einem Chor auf eine Reise innerhalb Europas zu gehen.
Ein Empfehlungsschreiben des oben genannten Botschafters Maschke erleichterte die Migration nach Chile. In einer abgelegenen Region an den Hängen der Kordillere bauten sie die Siedlung. Sie wurde bald unter dem Namen "Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad" offiziell als gemeinnützige Organisation anerkannt. Die Gruppe baute ein Krankenhaus, in dem Menschen aus der Umgebung kostenlos behandelt wurden, aber die Kosten wurden vom chilenischen Gesundheitssystem erstattet. Einige Mitglieder der Gruppe wurden im Krankenhaus monatelang mit Elektroschocks und erzwungener Verabreichung von Psychopharmaka misshandelt. 21 chilenische Kinder wurden in der Colonia Dignidad in betrügerischer Absicht adoptiert, oft nachdem sie zur Behandlung ins Krankenhaus gegangen waren. "Dort wurde zum Beispiel den Eltern gesagt, dass Kinder im Krankenhaus eine mehrmonatige Behandlung benötigen", begründet Stehle die Zusammenarbeit mit den Kommunen: "Dazu mussten Eltern – manchmal Analphabeten – vor Notaren oder Gerichten Einverständniserklärungen unterschreiben." Später wurde klargestellt, dass sie mit diesen Aussagen das Sorgerecht für ihre Kinder abgegeben haben. Viele Eltern konnten sie später nicht mehr besuchen.
Enge Zusammenarbeit mit der Diktatur
Unter Berufung auf unzählige Dokumente und Zeugenaussagen dokumentiert Stehle die enge Zusammenarbeit der Sektenhierarchie mit der Diktatur und der Direktion für Nationale Geheimdienste (DINA) und die Rolle der deutschen Politik in diesem Zusammenhang. Nach dem Staatsstreich vom 11. September 1973 wurden Hunderte von Gegnern in einem Gefangenenlager in Colonia Dignidad gefoltert und Dutzende getötet und in Massengräbern begraben. Um die Spuren zu verwischen, wurden ihre Leichen 1978 erneut exhumiert, verbrannt und ihre Asche im nahe gelegenen Perquilauquén-Fluss verstreut. Dies belegen die von Stehle zitierten Zeugenaussagen von Bewohnern der Siedlung und Mitgliedern der DINA.
1976 veröffentlichte die UNO Zeugenaussagen von Chilenen, die die Folter in der Colonia Dignidad überlebt hatten und aus dem Land fliehen konnten. Bald besuchte der damalige deutsche Botschafter in Chile, Erich Strätling, die deutsche Siedlung. Ihm und seiner Frau wurde eine "Art Show mit Liedern und musikalischen Darbietungen" präsentiert, gefolgt von einer Feldtournee, zitiert Stehle Strätlings spätere Aussagen während eines Verhörs durch einen deutschen Staatsanwalt. Der ehemalige Botschafter erklärte weiter: "Ich habe mir alle Wohn- und Geschäftshäuser angesehen, bin in die Keller aller Häuser gegangen, habe die Generatorstation und den Parkplatz besucht und nichts Auffälliges entdeckt." Nach seiner Rückkehr bat Strätling auch General Leigh, Oberbefehlshaber der Luftwaffe und Mitglied der Militärjunta, Luftaufnahmen von der Stätte zu machen. "Diese wurden vom [deutschen] Verteidigungsministerium evaluiert. Auf den Fotos wurden keine versteckten Gebäude oder Überwachungsmaßnahmen gefunden", fasst Stehle Strätlings Aussage zusammen.
Dies deutet darauf hin, dass es dem deutschen Botschafter 1976 nicht darum ging, die Menschenrechte zu garantieren. Sein Interesse galt der Aufrechterhaltung guter Beziehungen zur Militärjunta.
Dies erleichterte es der DINA und den Führern der Colonia Dignidad, ungestört weiter zusammenzuarbeiten. Als Amnesty International 1977 Berichte über Folterüberlebende veröffentlichte und Colonia Dignidad als Folterlager bezeichnete, verklagte die deutsche Siedlungshierarchie Amnesty International mit Anwälten, die ausgewählt wurden, um Vorsichtsmaßnahmen zu erhalten, was zu einem Verbot der Veröffentlichung des Berichts von Amnesty International führte.
Stehles Untersuchung beweist auch, dass Colonia Dignidad und DINA gemeinsam Schulungen in Foltertechniken und dem Umgang mit Waffen und Sprengstoffen durchgeführt haben. Mitglieder von Colonia Dignidad installierten Kommunikationstechnologie in DINA-Haftanstalten. Vieles deutet auch darauf hin, "dass die CD [Colonia Dignidad] eine wichtige Rolle bei den Vorbereitungen für den Putsch gespielt hat", schreibt Stehle. Er zitiert Originalquellen, die zeigen, dass die rechtsextremen Paramilitärs von "Patria y Libertad" bereits in den frühen 1970er Jahren in die deutsche Siedlung kamen, um eine militärische Ausbildung zu erhalten, und dass auch hochrangige Militäroffiziere kamen und gingen.
All dies mag dazu beigetragen haben, dass der Autor erst nach einer Beschwerde, wie im Buch beschrieben, Zugang zu den Akten des Politischen Archivs des Auswärtigen Amtes erhielt. Demnach argumentierte das Ministerium sogar 2010, dass eine Veröffentlichung der Archive der Colonia Dignidad "ein Konfliktpotenzial in dem Maße birgt, in dem sich diese Klarstellung auf seine Zusammenarbeit mit der Militärdiktatur bezog". Die "Offenlegung deutscher interner Informationen (...) und Kommunikation, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist" (...) schafft damit "Gründe für neue Konflikte und Anschuldigungen" zwischen Chile und Deutschland.
Mit verschiedenen Quellen zeigt Stehle das Engagement deutscher Institutionen auf. Ein sehr drastisches Beispiel ist seine Untersuchung des Waffenhändlers und BND-Informanten Gerhard Mertins. "Es gibt eine Reihe von Beweisen und Hinweisen darauf, dass die CD [Colonia Dignidad] ein wichtiger Punkt des Waffenhandels für das chilenische Militär war", erklärt Stehle. Die Gerichtserklärungen der Anwohner bestätigten "die zentrale Rolle des berühmtesten deutschen Waffenhändlers der Nachkriegszeit, Gerhard Mertins". Der ehemalige SS-Offizier Mertins, der nach 1945 Kontakte zu Neonazi-Gruppen unterhielt, vertrat westdeutsche Unternehmen im Ausland und handelte über seine Firma "Merex AG" hauptsächlich mit ausrangierten Waffen der Bundeswehr. Ab 1956 arbeitete Mertins für den Bundesnachrichtendienst (BND) unter dem Decknamen "Uranus", erklärt Stehle. Er fügt hinzu, dass Mertins in den 1970er Jahren wegen illegalen Waffenhandels in Konfliktgebiete angeklagt wurde, aber vor Gericht beweisen konnte, dass der BND sich dessen bewusst war." Mit dem Ziel einer gründlichen Aufklärung fordert Stehle, dass alle von den Geheimdiensten, insbesondere den BND-Archiven, unter Verschluss gehaltenen Dokumente offengelegt werden.
Umstrukturierung zur "Villa Bavaria"
Besonderes Augenmerk legt Stehle auch auf die Umstrukturierung der Colonia Dignidad in die Nachfolgeorganisation "Villa Baviera", die sie vor der Auflösung schützte. In dem Prozess, der 1988 in der letzten Periode der Diktatur begann, wurden das Land und das Eigentum an der Siedlung auf eine intransparente Holdinggesellschaft mehrerer geschlossener Aktiengesellschaften übertragen. Der Betrieb existiert in veränderter Form bis heute. Der Politikwissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler listet insgesamt 23 Unternehmen auf, die zur Holding gehören, darunter Tourismus, Landwirtschaft und acht Immobilienunternehmen. Es listet auch ihre jeweiligen Vertreter auf: Dies sind insgesamt weniger als zwanzig Personen, meist Nachkommen der alten Hierarchie der Gruppe, die den Zugang zu Macht und Gütern bis heute unter sich konzentrieren.
Als letzte historische Phase beschreibt der Autor den langsamen Prozess der Öffnung nach der Verhaftung von Paul Schäfer im Jahr 2005. Nachdem chilenische Familien, deren Kinder von dem Sektenführer in der Villa Bavaria vergewaltigt worden waren, 1996 Anzeige gegen ihn erstatteten, floh Schäfer mit einer Handvoll Anhängern nach Argentinien. Nur acht Jahre später wurde er in einem geheimen Versteck, einer Farm in der Nähe der Hauptstadt Buenos Aires, gefangen genommen. Seine Verhaftung markierte den Beginn einer langsamen Phase der Öffnung, in der mehrere Bewohner schließlich die Siedlung verließen. Rund hundert Menschen leben noch heute in der Villa Bayern, deren Erscheinungsbild stark vom Tourismus geprägt ist.
Stehle zeigt, dass die deutschen Bundesbehörden in allen historischen Phasen seit dem Umzug der Gruppe nach Chile "klare Hinweise" auf die Verbrechen hatten, aber "nicht angemessen eingegriffen", um sie zu verhindern. "Daher kann kein anderer Schluss gezogen werden, dass die deutschen Bundesbehörden für diese Verbrechen mitverantwortlich sind. Diese gemeinsame Verantwortung betrifft sowohl die Bundesregierung, insbesondere das Auswärtige Amt, als auch die deutschen Justizbehörden", so Stehle abschließend.
Verantwortung für Politik und Justiz
Er prüft auch detailliert alle politischen Initiativen und gerichtlichen Ermittlungen. Er beschreibt parlamentarische Untersuchungskommissionen und Gerichtsurteile in Chile, Anhörungen im Deutschen Bundestag und seinen einstimmigen Beschluss von 2017, die Verbrechen der Colonia Dignidad zu beleuchten – letztere als die bisher weitreichendste politische Initiative. In der Folge finanzierte die Bundesregierung die Freie Universität (FU) Berlin für ein Archiv der Oral History, bestehend aus Interviews mit Zeitzeugen. Die Installation einer Website des Gedächtnisses, der Dokumentation und des Lernens, die Klärung der Eigenschaften von Colonia Dignidad und andere in dieser Resolution definierte Anforderungen warten jedoch noch darauf, umgesetzt zu werden. Der Bundestag und die Bundesregierung werden sich weiterhin mit diesen Fragen beschäftigen müssen – und die Institutionen in Chile auch.
Niemand übernahm Verantwortung
In seiner Analyse beschreibt Stehle ein Muster staatlichen Handelns, bei dem sich Politik und Justiz sowohl in Deutschland als auch in Chile gegenseitig Verantwortung zuwiesen. Die "formale Verantwortung beider – aber in Wirklichkeit nicht definierter – staatlicher Stellen" sei eine wichtige Bedingung für die Colonia Dignidad, "um ihre Verbrechen so lange verewigen zu können".
In Anbetracht der Tatsache, dass die deutschen Bundesbehörden von den im Vergleich begangenen Verbrechen wussten, reagierten sie nicht ausreichend: "In Bezug auf das Ziel, die Menschenrechte zu sichern, sind sie gescheitert. Sie haben keine ausreichenden Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass die ihnen bekannten Verbrechen nicht weiter begangen werden. In vielen Fällen hat sogar das "Colonia Dignidad System" die Agenda bestimmt.
Einer der größten Justizskandale in der Bundesrepublik Deutschland
Der Autor stellt fest, dass das chilenische Justizsystem nach 2005 "zumindest bis zu einem gewissen Grad" die Verantwortung für die Aufklärung der Verbrechen übernommen hat: "Ohne die Urteile des chilenischen Justizsystems gäbe es immer noch keine offizielle Anerkennung" der Verbrechen als "bestätigte Fakten". Im Jahr 2016 verurteilte der Oberste Gerichtshof Chiles die Führer der ehemaligen Colonia Dignidad und DINA wegen "illegaler Vereinigung" zu Gefängnisstrafen. Im Jahr 2013 verhängte er auch Gefängnisstrafen gegen einige Führer der Colonia Dignidad wegen Mittäterschaft bei Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch. Unter ihnen ist der emblematischste Fall: Hartmut Hopp, einst ein Komplize Schäfers mit ausgezeichneten Kontakten zur Militärjunta und zur DINA und Direktor des Siedlungskrankenhauses. Doch Hopp war bereits 2011 nach Deutschland geflüchtet, wo er nichts zu befürchten hat: Weder Auslieferung nach Chile wegen seiner deutschen Staatsangehörigkeit, noch Verbüßung der chilenischen Strafe in einem deutschen Gefängnis, noch Anklage, noch Prozess: "Es gibt nicht genug Verdachtsmomente" sei die Begründung dafür, diese Ermittlungen und mehr als zehn gegen verschiedene Menschen allein in Nordrhein-Westfalen auf Eis gelegt zu haben. die Stehle analysierte. Die Fälle betrafen Sexualdelikte, Entführung von Kindern, Freiheitsentzug, Verletzung des Waffengesetzes, Verletzung und Mord. Infolgedessen blieben die Führer der Colonia Dignidad, denen die Flucht nach Deutschland gelang, alle ungestraft, selbst diejenigen, gegen die bereits in Chile ermittelt wurde.
Sehr detailliert erklärt der Autor einen der größten Justizskandale Deutschlands und kritisiert die deutsche Justiz dafür, dass sie "den systemischen Charakter der Colonia Dignidad als kriminelle Organisation nicht anerkennt". Er fügt hinzu, dass er "zu keiner Zeit aktiv genug" in der Untersuchung und Untersuchung war, "um die Verbindungen und Hintergründe des CD-Systems [Colonia Dignidad] zu beleuchten".
Infolgedessen blieben alle Verbrechen der Dignity Colony in Deutschland ungestraft, ein fatales Zeichen der Justiz. Allein die Lektüre dieses Kapitels zur rechtlichen (Nicht-)Klärung in Deutschland gibt Aufschluss darüber, warum die Gruppe so lange existieren und ungehindert Verbrechen begangen haben konnte und was dies für die Gesellschaft bedeutet.
Forderung nach einer opferzentrierten Perspektive
Als "angemessener Ansatz" fordere Stehle heute, dass der Fall Colonia Dignidad "grundsätzlich aus der Perspektive der Opfer (...) gesehen, ihre Bedürfnisse anerkannt und entsprechend gehandelt wird". Im Sinne einer "opferzentrierten Perspektive" fordert sie eine "Überprüfung der formellen und informellen Eigenschaften" von Colonia Dignidad oder aktuellen Unternehmen. "Diese Vermögenswerte sollten den Opfern zugute kommen." Eine Forderung, die auch im Beschluss des Deutschen Bundestages von 2017 zur Aufklärung über die Verbrechen der Dignity Colony ähnlich benannt wurde, aber noch nicht erfüllt wurde. Es bestehe auch Bedarf an einer "angemessenen Entschädigung der Opfer", auf die sie aufgrund der (Mit-)Verantwortung der deutschen Bundesbehörden Anspruch haben und die "ihnen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen soll, unabhängig von den Strukturen der post-sektischen Gemeinschaft".
Darüber hinaus sollte auf dem Gelände der ehemaligen Dignity Colony eine Erinnerungs-, Dokumentations- und Lernseite eingerichtet und mehr wissenschaftliche Forschung und "gründliche Forschung in einem politisch definierten Rahmen, zum Beispiel als Wahrheitskommission" erforderlich sein. Ziel dieser Kommission sollte es laut Stehle sein, die Verbrechen und ihre Opfer zu benennen. Darüber hinaus müsse aber "der Staat bestimmen, wer in jedem Fall verantwortlich war. Dies schließt ausdrücklich die politische (Mit-)Verantwortung, in diesem Fall auch der Bundesrepublik Deutschland, ein." Den Grundstein dafür hat Jan Stehle mit seiner Forschung gelegt.
Quelle: Nachrichtenpool Lateinamerika Juni 2022

Info über UN-Menschenrechtsrat
Bachelet wird kein weiteres Mandat des UN-Menschenrechtsrats übernehmen
"Wenn mein Mandat als Hoher Kommissar zu Ende geht, wird diese 50. Tagung des Rates die letzte sein."
Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, gab am Montag bekannt, dass sie nicht für eine zweite Amtszeit ihrer Position kandidieren wird, die sie 2018 übernommen hat.
Der chilenische Beamte sagte dem Menschenrechtsrat in Genf: "Wenn mein Mandat als Hoher Kommissar zu Ende geht, wird diese 50. Sitzung des Rates die letzte sein, in der ich mich äußere."
Angesichts der Entscheidung, die ohne Angabe von Gründen getroffen wurde, muss der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, einen Vorschlag unterbreiten, der der Zustimmung der Generalversammlung bedarf.
In Bezug auf Bachelets Duldung angeblicher Menschenrechtsverletzungen in China sagte er: "Ich habe immer die Bedeutung des Dialogs in meinen Interaktionen mit allen Mitgliedsländern betont, auch in den schwierigsten Fragen."
In diesem Sinne war die ehemalige chilenische Präsidentin die erste in ihrer Position, die an China teilnahm, wo sie sich bereit erklärte, jährliche hochrangige Kontakte zu führen, um den Stand der Menschenrechte zu erörtern.
Gleichzeitig stellte er fest: "Der Besuch war eine Gelegenheit, direkte Gespräche über Menschenrechtsfragen zu führen, einander zuzuhören, Probleme anzusprechen, den Weg für regelmäßigere Beziehungen zu erkunden und zu ebnen."
Bachelet, die Un-Frauen leitete, war die vierte Frau, die das Menschenrechtsbüro übernahm, das Mitte des letzten Jahrzehnts des letzten Jahrhunderts eröffnet wurde.
Quelle: teleSUR 13.06.2022

Menschenrechts-verletzungen
Amnesty:
Zahlreiche Menschenrechtsverletzungen beim Kampf gegen Bandenkriminalität in EL Salvador
In El Salvador tobt ein Kampf gegen Bandenkriminalität. In den vergangenen Wochen nahmen Behörden Tausende Mitglieder krimineller Gruppen fest.
Der salvadorianische Präsident Nayib Bukele sagte im Parlament, man stehe kurz davor, den Kampf gegen die organisierten Banden zu gewinnen. El Salvador werde endlich ein sicheres Land werden. Allerdings prangert Amnesty International schwere Menschenrechtsverletzungen an. Hintergrund ist der Ausnahmezustand, der seit Ende März in Kraft ist. Dadurch sind Inhaftierungen ohne Gerichtsurteile, ein längerer Verbleib in Untersuchungshaft und Gefängnisstrafen von bis zu 45 Jahren für Bandenmitglieder möglich. In den vergangenen zweieinhalb Monaten steckten die salvadorianischen Sicherheitskräfte nach eigenen Angaben mehr als 36.000 Menschen in Gefängnisse. Doch diese waren bereits vor zwei Jahren stark überbelegt - zum Teil zu 136 Prozent.
Damit offenbar nicht genug: Ein Bericht von Amnesty dokumentiert Fälle von Folter, willkürlichen Festnahmen, zwei Todesfällen in Polizeigewahrsam und vorübergehenden Verschleppungen.
In El Limonar, im Westen von San Salvador, wurde die Tochter von María Dolores García Mitte April festgenommen. Esmeralda wurde von Soldaten und Polizisten verschleppt. Seitdem hat ihre Mutter nichts mehr von ihr gehört. "Ich als ihre Mutter weiß genau, dass sie nichts verbrochen hat", sagt sie. "Esmeralda hat nur ihre Arbeit getan, sie hat sich für Frauenrechte und die Umwelt eingesetzt. Sie hat Gemüse angebaut und sich für Landwirtschaft ohne Chemikalien engagiert."
Mit der Zeit merkten sie, dass das System gegen sie arbeitet.
Noah Bullock
NGO Cristosal
García und rund 50 weitere Betroffene haben es sich zum Ziel gesetzt, ihre Familienangehörigen frei zu bekommen. Die NGO Cristosal unterstützt sie in ihrem Kampf.
NGO-Chef Noah Bullock sagt, "am Anfang dieses Ausnahmezustands dachten die Leute, ihre Familienmitglieder würden bald entlassen und bekämen Rechtsbeistand. Doch mit der Zeit merkten sie, dass das System gegen sie arbeitet."
Nach Behördenangaben haben kriminelle Banden in El Salvador rund 70.000 Mitglieder. Mehr als die Hälfte von ihnen sitzt demnach bereits hinter Gittern – in einem Land mit nur 6,5 Millionen Einwohnern.
Quelle: Euronews deutsch 04.06.2022
beim Kampf gegen Bandenkriminalität in El Salvador

Menschenrechts-verletzungen
WOHN- UND LANDRECHTE
Das Vereinigte Königreich besetzt immer noch beschämend die Chagos-Inseln
In den 1960er Jahren vertrieb die britische Regierung die gesamte indigene Bevölkerung von mehr als 1.500 Inselbewohnern aus dem Archipel und behauptete dann, sie habe keine ständige Bevölkerung, um ihren Bruch des Völkerrechts zu rechtfertigen.
Anfang dieses Jahres segelte eine Gruppe seiner ursprünglichen Bewohner auf die Insel - und strafte den britischen Kolonialismus Lügen. Es überrascht nicht, dass die britische Regierung den Versuch der indigenen Bevölkerung, auf den jahrzehntelangen Streit aufmerksam zu machen, zurückwies. Schließlich hat es die Resolutionen der Vereinten Nationen, einen Schuldspruch des Internationalen Gerichtshofs und ein Urteil eines UN-Gerichts im Jahr 2021, dass es seine "rechtswidrige Besatzung" der Chagos-Inseln beenden muss, ignoriert.
Jagdish Koonjul, der mauritische Botschafter bei den Vereinten Nationen, hisste letzten Monat die Flagge seines Landes auf dem Chagos-Archipel – was Harold Wilsons Labour-Regierung von 1965 das Britische Territorium im Indischen Ozean (BIOT) nannte, in einem flagranten Verstoß gegen das Völkerrecht.
Mit einem Schlag wurden alle Rechte der Bewohner – menschliche, wirtschaftliche, zivile – in einer Bewegung zerrissen, die von internationalen Institutionen seither abgelehnt wurde.
Die britische Regierung vertrieb die gesamte indigene Bevölkerung von mehr als 1.500 Inselbewohnern aus ihren Häusern auf dem Archipel.
Es erkannte, dass es eine neue Kolonie gründen, Souveränität über das Territorium beanspruchen und eine UN-Resolution von 1960 über das Recht auf Selbstbestimmung ignorieren konnte – solange niemand dort lebte.
Wenn es keine Einwohner gäbe, gäbe es keine demokratischen Rechte, die geschützt werden müssten, argumentierten Whitehall-Beamte.
Nachdem sie ihre Hunde vergast hatten, deportierten britische Beamte die Inselbewohner hauptsächlich nach Mauritius und auf die Seychellen. Wilson drohte, die Unabhängigkeit von Mauritius zu blockieren, wenn es den Deal ablehnte.
Die Vertreibungen sollten Platz für eine große US-Bomberbasis auf Diego Garcia, der größten der Chagos-Inseln, schaffen.
Ein Comeback schaffen
Im Februar dieses Jahres charterte Mauritius, das den Archipel beansprucht, ein Schiff, Bleu de Nîmes, auf die Inseln mit einer Gruppe seiner ursprünglichen Bewohner. Es war eine weitgehend symbolische Übung, aber eine wichtige in einem langen Kampf, um ein schreckliches Unrecht zu kippen.
Obwohl sie ein Fischereischutzschiff entsandte, um die Bleu de Nîmes zu beschatten, wies die britische Regierung den Versuch zurück, auf den jahrzehntelangen Streit aufmerksam zu machen.
Ebenso hat es die Resolutionen der Vereinten Nationen, einen Schuldspruch des Internationalen Gerichtshofs und ein Urteil eines UN-Gerichts im vergangenen Jahr ignoriert, dass Großbritannien seine "rechtswidrige Besatzung" der Chagos-Inseln beenden muss.
Philippe Sands QC, Juraprofessor am University College London, der die Inselbewohner vertritt, beschreibt die Reise als "historisch".
Er sagte gegenüber Declassified: "Es strafte eine britische Verlogenheit nach der anderen Lügen: dass die Chagos in den 1960er Jahren keine dauerhafte Bevölkerung hatten; dass Chagos heute unbewohnbar ist; dass Großbritannien die historischen Gebäude und Friedhöfe bewahrt und die Inseln sauber hält, widerlegt durch den Zerfall der historischen Gebäude und die Plastik- und anderen Trümmer, die herumlagen."
Sands fügte hinzu: "Die britische Regierung weiß, dass ihre Position unhaltbar ist, dass das Völkerrecht – der IGH (Internationaler Gerichtshof), das ISGH (International Tribunal for the Law of the Sea), die UNO und Sonderorganisationen – Chagos als Teil von Mauritius behandelt, dass sich der Boden unter ihren Füßen verschiebt. Die Frage ist nicht, ob Großbritannien die rechtlichen und politischen Realitäten anerkennen wird, sondern wann. Diese Reise öffnet die Tür zur Rückkehr der Chagossianer."
Ein schmutziger Deal
Großbritannien erklärt das Eigentum an den Inseln für das, was es als "Verteidigungszwecke" bezeichnet. Der Ausdruck ist ein Euphemismus für die US-Basis auf Diego Garcia, die verwendet wurde, um Ziele im Nahen Osten und in Afghanistan anzugreifen.
Das Pentagon beschrieb die Basis als "kritisch" bei der US-Invasion des Irak im Jahr 2003. Diego Garcia wurde auch von der CIA als Transitbasis für die Überstellung von Terrorverdächtigen nach Guantanamo Bay und in Geheimgefängnisse in Polen und Rumänien genutzt, wo sie gefoltert wurden.
Und als Gegenleistung dafür, dass es die Bomberbasis bauen ließ, bot Washington heimlich einen Rabatt von 11 Millionen Pfund auf die Kosten eines Polaris-Atomraketengeschäfts an, das die Labour-Regierung verhandelte.
Jahre später, 1980, schloss Margaret Thatcher einen ähnlichen geheimen Deal mit den USA und stimmte dem verstärkten Einsatz von Diego Garcia durch Amerika im Gegenzug für einen Deal über die Übernahme von Trident, dem Nachfolger von Polaris, zu.
Der Rassismus und Zynismus, mit dem das Auswärtige Amt, zuerst unter einer Labour-Regierung und dann unter ihren konservativen Nachfolgern, gegenüber den Chagossianern annahm, wurde in einem Telegramm vom 31. August 1966 anschaulich veranschaulicht. Dieser wurde von Sir Paul Gore-Booth – einem Beamten der britischen Delegation bei den Vereinten Nationen in New York – an das Außenministerium in London geschickt und bezog sich auf den Plan, die Inselbewohner gewaltsam zu vertreiben und Diego Garcia an die USA zu vermieten.
Gore-Booth schrieb: "Wir müssen sicherlich sehr hart sein. Das Ziel der Übung war es, einige Steine zu bekommen, die unsere bleiben werden; es wird keine indigene Bevölkerung geben, außer Möwen, die noch kein [UN-] Komitee haben (das Komitee für den Status der Frauen deckt nicht die Rechte der Vögel ab)."
In einer handschriftlichen Notiz antwortete der hochrangige Beamte des Auswärtigen Amtes, Dennis (später Lord) Greenhill: "Leider gehen zusammen mit den Vögeln einige Tarzans oder Men Fridays, deren Herkunft unklar ist und die hoffentlich nach Mauritius usw. gewünscht werden".
Der Plan, so das Auswärtige Amt, bestehe darin, "Verteidigungsanlagen" auf den Inseln "ohne Behinderung oder politische Agitation" zu bauen.
"Meeresschutzgebiet"
Jahre später, im Jahr 2009, ließ ein hochrangiger britischer Diplomat die Sprache in einer Notiz über ein geheimes Treffen mit einem US-Beamten, das von Wikileaks veröffentlicht wurde, wieder aufleben. Colin Roberts, der später zum Gouverneur der Falklandinseln ernannt wurde, sagte den Amerikanern, dass es tatsächlich "keine menschlichen Fußabdrücke" oder "Man Fridays" auf den Inseln geben würde.
Roberts sagte den USA, dass die britische Regierung die Idee hatte, das "größte Meeresschutzgebiet der Welt" um die Inseln herum einzurichten, so dass "ehemalige Bewohner es schwierig, wenn nicht unmöglich finden würden, ihren Anspruch auf Umsiedlung auf den Inseln zu verfolgen..."
Die Reserve wurde von David Miliband, dem Außenminister, in den letzten Tagen der Regierung von Gordon Brown auferlegt. Es wurde später nach dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen für illegal erklärt.
Successive British governments have claimed there is “no doubt” it has sovereignty over the Chagos islands since in 1814 it took them from the French (who took them from the Dutch, the first colonial settlers).
Großbritannien hat die Souveränität als etwas benutzt, das es sich aussuchen und wählen kann, wie es will. Darin heißt es, Großbritannien würde "die Souveränität über das Territorium (das BIOT) an Mauritius abtreten, wenn es nicht mehr für Verteidigungszwecke benötigt wird".
In einem sehr aufschlussreichen Kommentar sagte Olivier Bancoult von der Chagos Refugees Group, der im Alter von vier Jahren von den Inseln entfernt wurde, bei seinem Besuch auf den Inseln im vergangenen Monat: "Die Bedeutung dieser Reise besteht darin, dass wir eine Botschaft an die Welt senden können - über die Art von Ungerechtigkeit, die die britische Regierung mit Hilfe der US-Regierung erfahren hat. Unserem Volk zugefügt.
"Wenn wir weiße Menschen mit blauen Augen wären, hätten wir vielleicht eine bessere Behandlung wie die Falkland-Insulaner gehabt?"
Richard Norton-Taylor ist ein britischer Redakteur, Journalist und Dramatiker und der Doyen der britischen Berichterstattung über die nationale Sicherheit. Er schrieb für den Guardian über Verteidigungs- und Sicherheitsfragen und war drei Jahrzehnte lang Sicherheitsredakteur der Zeitung.
Foto: Internet Archive / Flickr
Quelle: progressive International Juni 2022

Menschenrecht-Völkerrecht
"Die Völker müssen das Recht haben, ihre eigene Geschichte, ihr eigenes Leben zu leben."
Grundsatzrede auf dem Gipfel am Ende der Welt von Aleida Guevara, Revolutionsärztin und Tochter von Ernesto "Che" Guevara.
"Solidarität ist vielleicht eines der schönsten Dinge am kubanischen Volk."
Eines der schönsten Dinge, die die Revolution für das kubanische Volk getan hat, ist, uns zu lehren, wie wir Solidarität mit allen Menschen in jedem Teil der Welt empfinden können.
Ich erinnere mich an einen Tag, als ich in meinem Krankenhaus war - ich bin ein pädiatrischer Allergologe - ein Professor sagte mir, dass sie nach Kuba kommen würden, um Hilfe im Kampf gegen Ebola zu bekommen. Ich sagte: "Aber wir wissen nichts über Ebola", "Es spielt keine Rolle, sie werden kommen, Sie werden sehen", antwortete er.
Und tatsächlich kam die Weltgesundheitsorganisation kurz darauf nach Kuba und bat um Hilfe bei Ebola. Wissen Sie, warum? Weil sie sicher waren, dass wir ja sagen würden. Und so schickten wir das Beste aus dem Land. Angehörige der Gesundheitsberufe, Krankenschwestern, Ärzte, Techniker gingen in den Kampf gegen Ebola und sie hatten Erfolg. Das gibt euch als Volk wirklich außerordentliche Kraft, denn ihr könnt sagen: "Wir sind fähig, wir sind in der Lage, überall auf der Welt hinzugehen, wo wir gebraucht werden, und anderen Menschen zu helfen. Es spielt keine Rolle, welche Hautfarbe Ihre Haut hat oder welcher Religion Sie angehören, es spielt keine Rolle, was Sie denken. Das ist egal. Wir können einfach nützlich sein und so sind wir auch." Das ist eines der schönsten Dinge an der sozialistischen Revolution.
Persönlich ging ich als Arzt, Allergologe, Kinderarzt auf meine erste Mission nach Nicaragua. Ich war noch ein junger Arzt, ich war 23 Jahre alt und im letzten Jahr meines Abschlusses. Die Revolution hatte gerade in Nicaragua gesiegt, und Kuba hatte nicht so viele Ärzte wie heute. Also traf sich Oberbefehlshaber Fidel Castro mit Medizinstudenten im letzten Jahr und fragte uns, wer das internationalistische Praktikum machen wolle - wir nennen das letzte Jahr des Medizinstudiums ein Praktikum. Aus meinem Jahr heraus traten 480 von uns nach vorne. So bin ich nach Nicaragua gekommen.
Es war eine außergewöhnliche Erfahrung für mich, weil ich mit dieser Revolution geboren wurde. Ich meine, ich wurde mit allem geboren, Gesundheit, Bildung, Würde bereits garantiert und, man weiß nicht wirklich, was eine andere Welt bedeutet, bis man in der Lage ist, sie zu leben, mit ihr in Kontakt zu treten.
Die nicaraguanische Erfahrung war hart, weil sie als beginnender revolutionärer Prozess, wie natürlich alle revolutionären Bewegungen, viele Schwierigkeiten hatte. Neben dem revolutionären Prozess übte die katholische Religion einen großen Einfluss darauf aus, das Volk praktisch in zwei Teile zu teilen.
Es war hart, es war eine schwierige Erfahrung, denn in Kuba war ich daran gewöhnt, dass die Gesundheitsversorgung völlig öffentlich, kostenlos und im Dienste aller Menschen war. Plötzlich hatte ich es mit Ärzten zu tun, die für kurze Zeit in den öffentlichen Sektor gingen und dann in den privaten Sektor gingen. Und sie konnten Patienten still und leise in unerfahrene Hände lassen, wie bei uns. Also mussten wir kreativ sein und dort als Menschen wachsen, und das taten wir.
Ich war auch in Angola. Ehrlich gesagt, das waren vielleicht die beiden schwierigsten Jahre meines Lebens. Man muss in Afrika leben, man muss fühlen, wie es ist. Sie haben jahrhundertelang gelitten und nichts kann es rechtfertigen. Das ist nicht richtig. Auch als Kinderarzt war es vielleicht die schwierigste, die schwerste Zeit, an die ich mich erinnern kann.
Ich habe dort zwei Cholera-Epidemien erlebt und es war schrecklich, wirklich schrecklich. Eltern kamen mit toten Kindern ins Krankenhaus. Wir konnten nichts tun, um sie zu retten. Ich ging durch das gesamte María Pía Krankenhaus, das später in Joscina Machel umbenannt wurde, von einem Ende zum anderen, indem ich Blut abnahm und Kochsalzlösung verabreichte. Es war eine immense Arbeit.
Aber du bekommst die Befriedigung zu wissen, dass du etwas erreicht hast, dass du es geschafft hast, einige dieser Kinder zu retten oder ihnen zumindest zu helfen.
Ich fing an, mit Kindern mit Tuberkulose zu arbeiten, und das war das Beste, was mir je passiert ist. Diese Kinder wurden auch sozial abgelehnt, weil die Menschen Angst hatten, sich zu infizieren.
Aber in Angola habe ich sehr wichtige und grundlegende Dinge gelernt, die Menschen wissen müssen. Man muss gegen jeden Rassismus kämpfen, nichts kann ihn rechtfertigen. Dieses Gefühl muss vom Antlitz der Erde gelöscht werden. Das Gleiche gilt für den Kolonialismus. Es gibt keine Möglichkeit, keinerlei Möglichkeit, es zu akzeptieren! Die Völker müssen das Recht haben, ihre eigene Geschichte, ihr eigenes Leben zu leben.
Der afrikanische Kontinent wurde geplündert und ausgebeutet, nicht nur seine Mineralien und sein Land, sondern auch seine Menschen, die auf einen anderen Kontinent gebracht wurden, als wären sie nur Lasttiere. Diese schrecklichen Taten in der Geschichte der Menschheit sollten nicht existieren! Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass solche Dinge in der heutigen Welt passieren! Deshalb muss die Solidarität zwischen den Völkern jeden Tag wachsen.
Es gibt viele Dinge zu tun und viele Völker zu helfen, aber wir dürfen ihnen weder unsere Kultur noch unsere große Weisheit aufzwingen. Wir müssen von ihnen lernen! Während der Zeit, in der ich mit Kichwa-Hebammen im Norden Ecuadors in Kontakt stand, lernte ich Dinge, die ich bei über hundert Geburten in Nicaragua nicht gelernt hatte. Ich habe Dinge gelernt, die nie in Büchern niedergeschrieben wurden, weil es die Weisheit unserer Völker ist.
Man muss also lernen, zuzuhören. Solidarität lässt dich nicht nur als menschliches Wesen wachsen, indem du dich für einen anderen nützlich fühlst, sie ermöglicht es dir auch, zu wachsen, indem du die Weisheit der Vorfahren lernst.
Die schiere Menge an Wissen, die wir im Laufe der Jahre gesammelt haben, ist außergewöhnlich, und das alles dank solcher Handlungen.
Ein internationalistischer Arzt zu sein bedeutet, einen Teil der Schulden zurückzuzahlen, die wir der Menschheit schulden, und ich denke, das ist eines der schönsten Dinge, die wir geschafft haben.
So haben wir in verschiedenen Teilen der Welt gearbeitet. Die Botschaft unseres Volkes der Solidarität verbreiten, aber gleichzeitig lernen. Lernen Sie viel über die Notwendigkeit von Liebe, Verständnis und Respekt zwischen Menschen. Wenn wir das nicht haben, können wir diese Welt nicht ändern, und wir müssen diese Welt ändern. So können wir nicht weiterleben.
Foto: Südafrikanische Regierung / flickr
Quelle: progressiv international Mai 2022
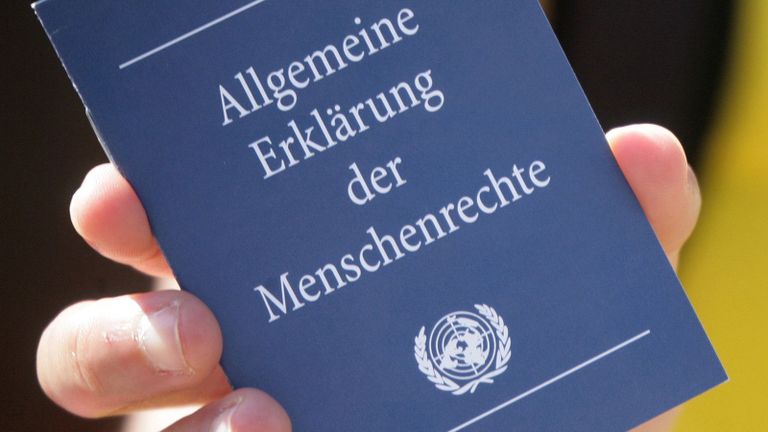
Menschenrecht auf Leben
Menschenrechte
IUVENTA: Die Menschheit auf dem Prüfstand
Aktivisten retteten 14.000 Menschenleben am Mittelmeer. Jetzt wird ihnen vorgeworfen, "die unerlaubte Einwanderung zu unterstützen und zu begünstigen".
"Europa ist unvertretbar", schrieb Aimé Césaire vor mehr als 70 Jahren und reflektierte die Dekadenz einer Zivilisation, deren Geschichte so viel Gewalt hervorgebracht hat. Heute, da Europa die Menschheit auf die Probe stellt, klingen Césaires Worte mit neuer Klarheit.
Am 2. August 2017 beschlagnahmten die italienischen Behörden die IUVENTA, unser Such- und Rettungsschiff. Wir, eine Gruppe junger Studenten und Aktivisten aus Deutschland, hatten diese Reise begonnen, indem wir unsere ersten Spenden für den Verkauf von Keksen und Second-Hand-Kleidung auf einem Flohmarkt gesammelt hatten. Zwischen dem Sommer 2016 und der Beschlagnahmung der IUVENTA hatten wir mehr als 14.000 Menschen gerettet, die sich auf die gefährliche Reise über die tödlichste Grenze der Welt, die zentrale Mittelmeerroute nach Europa, begeben hatten.
Jetzt werden unsere Genossen beschuldigt, "die unerlaubte Einwanderung zu unterstützen und zu begünstigen". Diese Anklagen basieren auf der Aussage eines ehemaligen Polizisten, der als Wachmann auf einem anderen Rettungsschiff arbeitete. Er fungierte als persönlicher Spion für den rechtsextremen Führer der rassistischen Lega Nord, der später italienischer Innenminister Matteo Salvini werden sollte.
Die Anschuldigungen lösten eine ausgedehnte Verfolgungskampagne durch den italienischen Staat aus. Bevor die IUVENTA beschlagnahmt wurde, hatte die Staatsanwaltschaft eine einjährige Überwachungsoperation genehmigt. Die italienische Polizei hörte unser Schiff ab und hörte Telefonate zwischen Journalisten und ihren Quellen ab. Nicht einmal vertrauliche Gespräche zwischen Anwälten und ihren Angeklagten waren sicher. Obwohl sie wiederholt entlarvt wurden, blieben die Anklagen hängen.
Nach fünf Jahren in einem rechtlichen Schwebezustand wird die erste vorläufige Anhörung dieses Falles am 21. Mai 2022 vor Gericht verhandelt. Vier Mitglieder der IUVENTA-Crew – und 17 ehemalige und aktuelle Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen und Save the Children – stehen vor Gericht. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen jeweils bis zu 20 Jahre Gefängnis und 15.000 Euro Geldstrafe für jeden der 14.000 geretteten Menschen.
Europäische Staaten missbrauchen nicht nur das Strafrecht, um Aktivisten daran zu hindern, Menschen auf See zu retten, sie nutzen es auch, um Menschen auf der Flucht zu terrorisieren. Italien und Griechenland haben auf Scheinprozesse zurückgegriffen, um Tausende von Menschen als Schmuggler zu verurteilen. In Griechenland dauern die Prozesse gegen diejenigen, die des Schmuggels beschuldigt werden, "durchschnittlich nur 38 Minuten, was zu einer durchschnittlichen Strafe von 44 Jahren und Geldstrafen von über 370.000 Euro führt".
Die Rettungseinsätze der IUVENTA wurden mit der italienischen Küstenwache koordiniert. Unsere Besatzungen handelten in voller Übereinstimmung mit den Anweisungen des italienischen Koordinationszentrums für Seenotrettung. Wir haben uns an die Regeln gehalten, während die europäischen Staaten sie weiterhin nach Belieben brechen. Uns wird vorgeworfen, mit Schmugglern zusammenzuarbeiten, doch die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten finanzieren, rüsten, trainieren und koordinieren kriminelle Gruppen, um die Drecksarbeit zu erledigen, Boote aus Libyen für sie zu stoppen. Die sogenannte libysche Küstenwache ist eine Ansammlung von Milizen, denen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Sklaverei, Erpressung und der Betrieb von "Konzentrationslagern" zur Inhaftierung von Menschen auf der Flucht vorgeworfen werden. Seit 2015 hat es keinen einzigen Tag gegeben, an dem die Europäische Union an ihren Grenzen nicht gegen das Völkerrecht verstoßen hat.
Heute wollen uns sogar linke Politiker davon überzeugen, dass eine humane EU-Migrationspolitik möglich ist. Das ist es nicht – aus zwei Gründen. Erstens sind Grenzen von Natur aus gewalttätige soziale Konstrukte. Grenzen sind immer offen, nur nicht für alle. Was wir erleben, ist ein politischer Kampf um die Durchlässigkeit von Grenzen. Es ist eine Frage, wer die Autorität hat zu entscheiden, wer es verdient, an Europas Küsten anzukommen, und wer nicht; der leben darf und der zum Tode verurteilt ist. Die Macht, Menschen in diese Kategorien zu filtern und zu unterteilen, produziert immer Gewalt, und ihr ultimativer Horizont ist Gefangenschaft und Tod.
Secondly, European borders are a manifestation of its violent colonialism — past and present. The deaths and the daily violence at Europe’s borders are not an accident, but a core feature of EU migration policy. They are the result of decades of deliberate policy decisions by national and EU politicians. They constitute the logical conclusion of a system of domination and discrimination sustained by denying certain people their right to move through this world. European power manifests at its borders. It manifests in the power it projects outwards by forcing other states to confirm and uphold arbitrary lines of division — born in colonialism and sustained by racism — drawn up by Europe's power-hungry plunderers in centuries past. We cannot abstract Europe's contemporary border crisis from its history of violence, colonial conquest, and transatlantic slavery. The people who drown in the Mediterranean are just the latest victims of Europe’s violent politics of domination.
The IUVENTA trial itself is also a reassertion of the border. We played by its unjust rules to save lives while European states flaunted their impunity. As they argue for their innocence, the trial will force the defendants to comply with the EU's twisted logic of what is legal and what is not. Activists are the ones on trial while Europe and its thugs beat and kill people on the move each day. "Europe is indefensible," Aimé Césaire wrote more than 70 years ago, reflecting on the decadence of a civilisation whose history has produced so much violence. Today, as Europe puts humanity on trial, Césaire’s words ring out with renewed clarity.
To learn more about the trial, you can find a detailed summary here.
Titus Molkenbur is a migration activist and researcher. He is a founding member of Jugend Rettet, a German NGO dedicated to rescuing lives at sea. He was the Head of Operations for their vessel the IUVENTA with which they rescued more than 14,000 people in the Central Mediterranean Sea before the ship was seized by Italian authorities.
Quelle: progressive Internationale 20.05.2022

Menschenrechte - UN Generalsekretär fordert
Menschenrechte
Guterres fordert Aufhebung des russischen Düngemittelembargos
UN-Generalsekretär António Guterres hat die sofortige Aufhebung des westlichen Embargos für russische Düngemittel gefordert. Tatsächlich ist Russland der weltweit führende Düngemittelhersteller. Der Mangel in diesem Bereich ist bereits in der Weltlandwirtschaft zu spüren. Wenn es so weitergeht, wird es in vielen Ländern, insbesondere in Afrika, zu einem drastischen Rückgang der Nahrungsmittelproduktion und zu einer raschen Hungersnot führen.
Das Wall Street Journal berichtete am 16. Mai, dass die Aufhebung des Embargos ausgehandelt werden könnte, wenn Getreide aus der Ukraine über Häfen im Asowschen Meer und im Schwarzen Meer exportiert werden kann. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte jedoch, dass, wenn Russland Handelsschiffen erlauben würde, in Kriegsgebieten zu kreuzen, dies das Problem nicht lösen würde, da die ukrainische Armee und der Westen viele Seeminen installiert haben, um eine russische Landung zu verhindern. Die Navigation ist extrem gefährlich geworden.
Übersetzung
Horst Frohlich
Quelle:Voltaire Netzwerk 18.05.2022

Info über Kolumbien
Weit verbreitete Ablehnung der Suspendierung des Bürgermeisters von Medellín in Kolumbien
Die Generalstaatsanwaltschaft suspendiert Daniel Quintero wegen angeblicher politischer Beteiligung an den Präsidentschaftswahlen.
Kolumbianische Persönlichkeiten, darunter der Kandidat für die Präsidentschaft des Landes für den Historischen Pakt, Gustavo Petro, schlossen sich am Dienstag der weit verbreiteten Ablehnung an, die die Suspendierung des Bürgermeisters von Medellín (Hauptstadt des Departements Antioquia), Daniel Quintero, durch die Generalstaatsanwaltschaft wegen angeblicher politischer Beteiligung an den Wahlen auslöst.
Über seinen Account im sozialen Netzwerk Twitter bezeichnete Petro die Entscheidung der Staatsanwältin Margarita Cabello als "Staatsstreich in Medellín" und forderte die Bürger und die Interamerikanische Menschenrechtskommission (IACHR) auf, die Volksabstimmung zu verteidigen.
Am Dienstag beschloss die Generalstaatsanwältin Margarita Cabello, den Stadtrat zu suspendieren, nachdem er über soziale Netzwerke ein Video verbreitet hatte, in dem er sagte: "Veränderung in erster Linie", in dem Kandidaten der Regierungspartei geglaubt haben, eine Einladung zu sehen, für Petro in der ersten Wahlrunde zu stimmen, die für den 29. Mai geplant ist.
Quintero seinerseits drückte sich so über die Tatsache aus: "Der Staatsstreich in Kolumbien hat begonnen."
Darüber hinaus sagte er, dass Cabello, "von Uribismo gedrängt, uns innerhalb von 12 Stunden vom Amt suspendiert, ohne Kompetenz oder ordnungsgemäßes Verfahren, ohne das Recht auf Verteidigung, was unsere politischen Rechte, die Verfassung und das Gesetz, die IACHR, aber vor allem den Volkswillen verletzt".
Die Entscheidung wurde auch von Petros Wahlkampfleiter Alfonso Prada abgelehnt, der sagte, dass eine Verwaltungseinheit einen demokratisch gewählten Beamten nicht suspendieren kann, so die IACHR. Er wies darauf hin, dass nur eine Justizbehörde dies tun könne.
Er bezeichnete die Entscheidung als unverhältnismäßig und erinnerte daran, dass sie die verfassungswidrige Entlassung von Petro als Bürgermeister von Bogotá wieder aufhebt.
Er wies darauf hin, dass es mehrere Beschwerden gegen den kolumbianischen Präsidenten Iván Duque wegen seiner häufigen Einmischung in Wahlangelegenheiten gegeben habe und die Generalstaatsanwaltschaft nichts unternommen habe.
Zu der Kritik fügte der Senator des Alternative Democratic Pole, Iván Cepeda, hinzu, der daran erinnerte, dass Duque angekündigt hatte, dass er an der Präsidentenkonsultation teilnehmen würde, und Cabello "mitschuldig schwieg".
Auf dem Punkt bestand die Journalistin María Jimena Duzán, die in Frage stellte, dass Cabello Quintero wegen möglicher Eingriffe in die Politik suspendiert habe, und ermahne Präsident Duque nicht, der dies wiederholt tue.
Der Direktor des Antikorruptionsinstituts, Camilo Enciso, sprach ebenfalls, der sagte, dass die Entscheidung des Generalstaatsanwalts nicht aufrechterhalten werde, weil er durch Verletzung des Gesetzes und der Rechtsprechung der IACHR ausweiche.
https://videos.telesurtv.net/es/content/284386
Der Abgeordnete von Antioquia, Andrés Fernando Meza, bezeichnete seinerseits die Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft als beispiellosen Akt und Staatsstreich gegen die politische Verfassungsmäßigkeit.
Im Gespräch mit einem lokalen Radiosender sagte Quintero am Mittwoch, dass er nach der Suspendierung seine Entlassung kommen sieht und dass er sich aus diesem Grund dafür einsetzen wird, sie zu stoppen.
Zusammen mit dem Bürgermeister von Medellín, Andrés Fabián Hurtado, Bürgermeister von Ibagué, der Hauptstadt des Departements Tolima, wurde aus dem gleichen Grund suspendiert; Gustavo Adolfo Herrera, Stadtrat von Calarcá, im Departamento Quindío, und Grenfell Lozano Guerrero, Vertreter von Nátaga, im Departamento Huila.
Quelle: teleSUR v.11.05.2022

Menschenrecht & Pressefreiheit
Aus: Ausgabe vom 07.05.2022, Seite 12 / Aktion
PRESSEFREIHEIT
Grenzen liberaler Demokratie
Radiosender und Verfassungsschutz beschränken Reichweite linker Zeitung
Von Dietmar Koschmieder
Am Internationalen Tag der Pressefreiheit am vergangenen Dienstag hob neben vielen anderen auch die Intendantin des öffentlich-rechtlichen Senders RBB (und amtierende ARD-Vorsitzende) Patricia Schlesinger hervor, wie wichtig Pressefreiheit sei. Die Bedeutung einer freien Presse sei »wirklich wesentlich für das Funktionieren unserer liberalen Demokratie. Das kann man gar nicht hoch genug wertschätzen«, weshalb sich die Aufgabe ergebe, eine »möglichst freie Berichterstattung aufrechtzuerhalten«, sagte sie auf RBB24-Inforadio. Aber schon am Mittwoch ist von den wohlfeilen Worten nicht viel übriggeblieben: Da teilte ihr Sender der Tageszeitung junge Welt mit, dass die weitere Ausstrahlung gebuchter Werbespots (die in diesen Tagen kombiniert mit einer Reihe anderer Werbemittel für den Kauf der Tageszeitung junge Welt am Kiosk werben sollten) mit sofortiger Wirkung gestoppt wird. Erstaunlich dabei ist, dass der Sender der Ausstrahlung zunächst nach interner Prüfung ausdrücklich zugestimmt und für die gebuchte Ausstrahlung bereits Rechnung gelegt hatte. Aber wesentlich erstaunlicher erscheint die Begründung, mit der man nun nach halber Umsetzung den Vertrag mit junge Welt gebrochen hat: Es habe »zahlreiche Beschwerden bezugnehmend auf die derzeitige Radiowerbung« der jungen Welt gegeben. Es empörten sich also Hörer, denen die Inhalte des Radiospots und damit das Selbstverständnis der jungen Welt nicht passten? Das sollte allerdings im Rahmen der Pressefreiheit auszuhalten sein. Hauptgrund für den Sender ist aber der Umstand, dass sich die junge Welt gegen die massive Verletzung der Pressefreiheit durch den deutschen Inlandsgeheimdienste mit rechtsstaatlichen Mitteln zur Wehr setzt: Die junge Welt befinde sich in einem »Rechtsstreit über die Zulässigkeit der Nennung im Verfassungsschutzbericht«, weshalb mit sofortiger Wirkung die Ausstrahlung der Werbespots in den RBB-Hörfunkprogrammen auszusetzen sei.
junge Welt meldete sich umgehend beim Sender und wies auf den entstandenen ökonomischen Schaden hin: Eine wesentliche Säule des crossmedialen Werbekonzeptes falle nun weg und minimiere damit auch die Wirkung anderer Werbemaßnahmen (etwa Kino- und Zeitungsanzeigen), die nicht zensiert wurden. Noch wesentlicher sei aber der faktische Umstand, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender, der zur Neutralität und Meinungsvielfalt verpflichtet ist, einer überregionalen Tageszeitung die Möglichkeit raube, über bezahlte Werbung auf die Zeitung und ihr inhaltliches Programm aufmerksam zu machen. Aber den gravierendsten Eingriff in die Pressefreiheit stelle die offizielle Begründung des RBB für sein Vorgehen dar. Wer die Nutzung rechtsstaatlicher Mittel gegen massive Eingriffe in die Presse- und Meinungsfreiheit missbrauche, um einen bereits genehmigten Radiospot aus dem laufenden Programm zu werfen, verletze Meinungs- wie Presse-, aber auch Gewerbe- und Wettbewerbsfreiheit. Hinzu komme, dass damit de facto bis zum letztinstanzlichen Abschluss des Verfahrens der jungen Welt die Möglichkeit entzogen wird, im RBB zu werben – bis dahin könnten zehn, womöglich aber auch zwanzig Jahre vergehen.
Auf jW-Anfrage konnte auch der RBB nicht ausschließen, dass der Hinweis auf den laufenden Prozess durch einen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes erfolgt sein könnte. Dessen Ziel ist es erklärtermaßen, der jungen Welt »den Nährboden zu entziehen«, ihr also ökonomisch zu schaden und Reichweite und damit Wirkmächtigkeit der Zeitung einzuschränken. Das vor allem mit der Begründung, dass die junge Welt eine andere Blattlinie vertritt als die meisten anderen Zeitungen. Aber statt über diesen Vorgang kritisch zu berichten (etwa anlässlich des Tages der Pressefreiheit), wirkt der Sender aktiv daran mit zu verhindern, dass die junge Welt für sich werben und damit auf sich aufmerksam machen kann. Damit erschwert der RBB – entgegen obengenannter Ansprüche – ganz konkret freie Berichterstattung. Und zeigt damit unfreiwillig die Grenzen »unserer liberalen Demokratie« auf.
Quelle junge Welt vom 07./08.05.2022 nik/JW
Radiospot: kurzelinks.de/jW-Radio
jW-Prozesskostenfonds: Kontoinhaberin: Verlag 8. Mai GmbH, IBAN: DE25 1005 0000 0190 7581 55, Stichwort: Prozesskosten

Menschenrecht auf eine würdevolles Leben
Aus: Ausgabe vom 07.05.2022, Seite 5 / Inland
ARMUTSVERWALTUNG
Aufnahmestopp bei Tafeln
Rheinland-Pfalz: Ehrenamtliche Lebensmittelausgaben in Mainz und Ludwigshafen am Limit – Linke fordert Unterstützung durch Landesregierung
Von Oliver Rast
Die Kapazitäten sind ausgereizt. Personell und logistisch. Die Verantwortlichen der Ausgabestellen von gespendeten, überschüssigen Lebensmitteln aus dem Handel haben in den vergangenen Wochen vielerorts einen Aufnahmestopp Bedürftiger verhängt. Auch in Rheinland-Pfalz (RLP) – in Mainz und Ludwigshafen etwa.
Die Situation in dem Bundesland sei bereits vor der Coronakrise prekär gewesen, erklärte Melanie Wery-Sims, Landesvorsitzende der Partei Die Linke, am Donnerstag in einer Mitteilung. Nun seien die Tafeln »endgültig an ihrer Belastungsgrenze«. Und offenbar darüber hinaus. »Wir wurden jüngst regelrecht überrannt«, sagte eine Mitarbeiterin der Mainzer Tafel am Freitag im jW-Gespräch. Die Einrichtung in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt versorgt 85 Haushalte. Übersetzt heißt das: »Mehrere hundert Menschen sind auf unsere Lebensmittel angewiesen.« Damit sei das Limit überschritten. Die Folge: Weitere Hilfesuchende werden abgewiesen. Wie lange geht der Aufnahmestopp? Bis Juni, danach werde neu entschieden, so die Tafel-Mitarbeiterin. Was sie besonders ärgert: Von der Kommune komme keinerlei Support, »die in den Amtsstuben ruhen sich auf dem Rücken der Ehrenamtlichen aus«.
Ähnlich ist die Lage in der Industriestadt Ludwigshafen. »In nur wenigen Wochen hatten wir 300 neue Zugänge von Bedürftigen«, so Jürgen Hundemer, Erster Vorsitzender des Trägervereins »Vehra« der örtlichen Tafel, am Freitag zu jW. Aktuell werde noch eine Liste mit »Altfällen« abgearbeitet. Mehr sei im Moment nicht machbar, trotz in summa 130 ehrenamtlichen Helfern in Ludwigshafen. Auch hier gilt: Aufnahmestopp, vorerst zumindest.
Nur, warum der aktuelle »Run« auf die Tafeln? Klar: Krise und Krieg, wachsende Armut und sozialer Abstieg. Menschen, die die Tafeln bislang gemieden haben, suchen diese nun auf, weiß Hundemer. Insbesondere seitdem die Lebenshaltungskosten horrend steigen. Und nicht zuletzt würde eine größere Zahl Geflüchteter aus der Ukraine die Ausgabestellen ansteuern. Noch seien die verfügbaren Nahrungsmittel für die rund 60.000 Tafel-Gänger in RLP nicht überall knapp, aber »im Einzelhandel bleiben einzelne Produkte länger im Verkauf als sonst«, sagte Hundemer weiter. Und in Mainz, erfuhr jW, schwanke das gespendete Lebensmittelaufkommen oft stark, eine »ständige Achterbahnfahrt«.
Ein Grundsatzproblem: Druck auf die Kommunen ist schwierig, die Tafeln sind privat organisiert, keine städtischen Angebote, hieß es unisono aus den Sozialdezernaten von Mainz und Ludwigshafen am Freitag gegenüber jW. Hinzu komme die angespannte Haushaltslage, wie Beate Steeg, Ludwigshafener Sozialdezernentin, gleichentags auf jW-Nachfrage sagte. Immerhin könne die Tafel dort mietfrei ein kommunales Gebäude nutzen. In Mainz ist selbst das nicht der Fall.
Die RLP-Linke sieht vor allem die Ampellandesregierung in der Pflicht. Wery-Sims: »Die Koalition muss die Vorstände der Tafeln anhören und ihre Arbeit finanziell und organisatorisch unterstützen.« Sofort. Wird sie? Eine Sprecherin des Landessozialministeriums am Freitag gegenüber jW: »Das Ministerium wird eine Deckungslücke von rund 40.000 Euro bei der Tafel-Logistik schließen.« Mickrig, erwidern Tafel-Vorstände.
Quelle: junge Welt 07.05.2022 Andreas Arnold/dpa
Die Belastungsgrenze ist erreicht: Immer mehr Bedürftige, immer mehr volle Tüten mit Lebensmitteln (Mainz, 20.3.2019)

Menschenrechte & Völkerrecht
Aus: Ausgabe vom 05.05.2022, Seite 2 / Ausland
EU-ABSCHOTTUNG
»Kriminelle Pushbacks wurden normal«
Frontex-Chef Leggeri musste Hut nehmen. Systematische Verstöße gegen Völker- und Menschenrechte. Ein Gespräch mit Karl Kopp
Interview: Gitta Düperthal
Fabrice Leggeri, der bisherige Exekutivdirektor der EU-Grenzagentur Frontex, hat am Freitag seinen Hut nehmen müssen. Er soll wiederholt illegale Pushbacks der griechischen Küstenwache in der Ägäis vertuscht haben. Wie weit gehen die Vorwürfe gegen ihn?
Viele Skandale pflastern seinen Weg. Es gibt umfassende Recherchen dazu, dass Leggeri über völkerrechtswidrige Zurückweisungen – Pushbacks – und andere Menschenrechtsverletzungen an den Grenzen Europas Bescheid wusste. Frontex hat unter Leggeris Ägide sowohl systematisch weggeschaut als auch nachweislich dabei mitgewirkt, wenn gegen das Völkerrecht und die EU-Grundrechtecharta verstoßen wurde.
In seinem Rücktrittsschreiben zeigte er keine Einsicht, sondern gab sich vielmehr überzeugt, dass irgendwelche politischen Kreise Frontex angeblich zu einer Menschenrechtsorganisation umfunktionieren wollten. Das ist absurd, aber es drückt aus, wo er politisch steht. Leggeri glaubte offenbar, das Völkerrecht umschreiben zu können. Als dann auch die EU-Antikorruptionsbehörde OLAF wegen Missmanagement etc. ermittelte, war klar, dass er den Bogen überspannt hat. Einige Staaten zogen ihre schützende Hand zurück, unter anderem Frankreich.
Welche Folgen hat das Vorgehen von Frontex für die Betroffenen?
Schutzsuchende werden erniedrigend behandelt, manche sterben durch illegale Pushbacks an den Grenzen. An der Ägäis setzt die griechische Küstenwache Menschen in aufblasbaren Rettungsbooten aus, um sie zurück in die Türkei zu schicken – was lebensgefährlich ist. Frontex war in zahlreichen Fällen Komplize. In blutiger Weise kooperiert die EU-Agentur zudem mit der bekanntermaßen verbrecherischen libyschen Küstenwache. Durch Luftüberwachung trägt Frontex dazu bei, Flüchtlingsboote im Mittelmeer zu erkennen und deren Daten an Libyens Küstenwache zu übermitteln. Mit der Folge, dass diese Bootsflüchtlinge zu Tausenden in Libyens Folter- und Vergewaltigungslager zurückgeschickt werden.
Wie konnte sich Leggeri aus Ihrer Sicht so lange auf dem Posten halten?
Er hat seit 2015 dort gewirkt. Frontex wurde unter seiner Ägide enorm ausgebaut, zuletzt mit einem riesigen Budget von etwa 700 Millionen Euro. Die Agentur war und ist ein Lieblingskind der Innenministerinnen und -minister. Motto: nie wieder 2015. Hauptsache, die Zahlen der Geflüchteten gehen zurück, koste es, was es wolle.
Rechnen Sie damit, dass es künftig besser wird ohne Leggeri?
Den Chef auszutauschen ist zwar ein wichtiger erster Schritt. Aber jetzt müssen auch alle Strukturen auf den Prüfstand. Um menschenrechtswidriges Handeln von Frontex aufzudecken und zu sanktionieren, muss nicht nur die interne Kontrolle ausgestaltet werden, sondern auch eine robuste externe unabhängige Kontrolle her. Frontex muss zurückgebaut und das Geld in andere Bereiche umverteilt werden, etwa in die zivile Seenotrettung.
Die Innenministerinnen und -minister ließen Frontex bislang gewähren.
Die Akteure haben sich nicht über Nacht verändert. Die demokratische Kontrolle durch das EU-Parlament muss gestärkt werden, damit die Agentur keine Straftaten an den europäischen Außengrenzen mehr verübt und Menschenrechte mit Füßen tritt. Auch die deutsche Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, steht in der Verantwortung, dass ein von ihr gewünschter »Neuanfang« kommt.
Was sagen Sie Reaktionären, die nach wie vor auf die »Festung Europa« setzen, weil aus deren Sicht sonst zu viele Menschen nach Deutschland flüchten würden und dies dann angeblich nicht mehr zu bewältigen wäre?
Diese Diskussion ist so alt wie die »Festung Europa« gegen Schutzsuchende. Leider bedienen die EU-Staaten mit einer enthemmten Form der Gewalt an den Außengrenzen diesen Diskurs. Kriminelle Pushbacks wurden normal. Die Bevölkerung sollte an diese Bilder gewöhnt werden. Dass es auch anders geht, sieht man an dem richtigen Umgang mit ukrainischen Geflüchteten. Die Fluchtwege nach Europa sind frei, die Leidgeprüften können das europäische Land, in dem sie Schutz suchen, frei wählen. So muss es auch sein. Klar ist aber: Geflüchtete erster und zweiter Klasse darf es nicht geben.
Quelle: junge welt vom 05.05.2022 Emrah Gurel/AP/dpa
Handlanger der EU-Abschottungspolitik ist der NATO-Partner Türkei. Aufgegriffene Geflüchtete auf einem Schiff der türkischen Küstenwache (13.9.2020)
Karl Kopp leitet die Europa-Abteilung der Nichtregierungsorganisation Pro Asyl

Leben in Frieden als ein Menschenrecht
Aus: Ausgabe vom 30.04.2022, Seite 10 / Feuilleton
UKRAINE-KRIEG
Kampf dem Atomtod
28 Prominente protestieren gegen weitere Aufrüstung und warnen vor der Eskalation zum Weltkrieg
Stefan Boness/IPON
Prominente wie der Kabarettist Gerhard Polt und die Journalistin Alice Schwarzer haben in einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) appelliert, nicht noch mehr schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Russland dürfe kein Motiv für eine Ausweitung des Krieges auf die NATO geliefert werden, schreiben die Unterzeichner. Sie warnen vor der Gefahr eines dritten Weltkrieges. Zu den 28 Erstunterzeichnern gehören der Filmemacher und Schriftsteller Alexander Kluge, die Philosophin Svenja Flaßpöhler, der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, der Sänger Reinhard Mey, der Rechtsphilosoph Reinhard Merkel, der Schauspieler Lars Eidinger, aber auch Leuchten unserer Zeit wie der Dichterfürst Martin Walser, der Schenkelklopfer Dieter Nuhr und die literarische Gewohnheitsverbrecherin Juli Zeh.
Der Bundestag hatte am Donnerstag mit großer Mehrheit die Lieferung sogenannter schwerer Waffen an die Ukraine gebilligt. Die Unterzeichner betonen, dass Russland mit dem Angriff auf die Ukraine das Völkerrecht gebrochen habe. Dies rechtfertige aber nicht, das »Risiko der Eskalation dieses Krieges zu einem atomaren Konflikt in Kauf zu nehmen«. Die Lieferung großer Mengen schwerer Waffen könnte Deutschland selbst zur Kriegspartei machen.
Eine zweite »Grenzlinie« sei das Leid der ukrainischen Zivilbevölkerung. »Dazu steht selbst der berechtigte Widerstand gegen einen Aggressor in einem unerträglichen Missverhältnis. Wir warnen vor einem zweifachen Irrtum: zum einen, dass die Verantwortung für die Gefahr einer Eskalation zum atomaren Konflikt allein den ursprünglichen Aggressor angehe und nicht auch diejenigen, die ihm sehenden Auges ein Motiv zu einem gegebenenfalls verbrecherischen Handeln liefern. Und zum andern, dass die Entscheidung über die moralische Verantwortbarkeit der weiteren ›Kosten‹ an Menschenleben unter der ukrainischen Zivilbevölkerung ausschließlich in die Zuständigkeit ihrer Regierung falle. Moralisch verbindliche Normen sind universaler Natur.«
Der offene Brief wurde am Freitag Vormittag auf der Website des feministischen Magazins Emma veröffentlicht und steht zur Unterzeichnung offen. (dpa/jW)
Quelle: junge Welt v. 30.04.2022 Die Unterzeichner warnen vor der Gefahr eines dritten Weltkriegs (Friedensdemonstration, Berlin, 7.4.2022)

Leben in Frieden als Menschenrecht
OFFENER BRIEF AN KANZLER OLAF SCHOLZ
28 Intellektuelle und KünstlerInnen schreiben einen Offenen Brief an Kanzler Scholz. Sie befürworten seine Besonnenheit und warnen vor einem 3. Weltkrieg. Der vollständige Brief hier. Ebenso die Gesamtliste der ErstunterzeichnerInnen. Ab sofort kann jede und jeder unterzeichnen!
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler,
wir begrüßen, dass Sie bisher so genau die Risiken bedacht hatten: das Risiko der Ausbreitung des Krieges innerhalb der Ukraine; das Risiko einer Ausweitung auf ganz Europa; ja, das Risiko eines 3. Weltkrieges. Wir hoffen darum, dass Sie sich auf Ihre ursprüngliche Position besinnen und nicht, weder direkt noch indirekt, weitere schwere Waffen an die Ukraine liefern. Wir bitten Sie im Gegenteil dringlich, alles dazu beizutragen, dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand kommen kann; zu einem Kompromiss, den beide Seiten akzeptieren können.
Wir teilen das Urteil über die russische Aggression als Bruch der Grundnorm des Völkerrechts. Wir teilen auch die Überzeugung, dass es eine prinzipielle politisch-moralische Pflicht gibt, vor aggressiver Gewalt nicht ohne Gegenwehr zurückzuweichen. Doch alles, was sich daraus ableiten lässt, hat Grenzen in anderen Geboten der politischen Ethik.
Zwei solche Grenzlinien sind nach unserer Überzeugung jetzt erreicht: Erstens das kategorische Verbot, ein manifestes Risiko der Eskalation dieses Krieges zu einem atomaren Konflikt in Kauf zu nehmen. Die Lieferung großer Mengen schwerer Waffen allerdings könnte Deutschland selbst zur Kriegspartei machen. Und ein russischer Gegenschlag könnte so dann den Beistandsfall nach dem NATO-Vertrag und damit die unmittelbare Gefahr eines Weltkriegs auslösen. Die zweite Grenzlinie ist das Maß an Zerstörung und menschlichem Leid unter der ukrainischen Zivilbevölkerung. Selbst der berechtigte Widerstand gegen einen Aggressor steht dazu irgendwann in einem unerträglichen Missverhältnis.
Wir warnen vor einem zweifachen Irrtum: Zum einen, dass die Verantwortung für die Gefahr einer Eskalation zum atomaren Konflikt allein den ursprünglichen Aggressor angehe und nicht auch diejenigen, die ihm sehenden Auges ein Motiv zu einem gegebenenfalls verbrecherischen Handeln liefern. Und zum andern, dass die Entscheidung über die moralische Verantwortbarkeit der weiteren „Kosten“ an Menschenleben unter der ukrainischen Zivilbevölkerung ausschließlich in die Zuständigkeit ihrer Regierung falle. Moralisch verbindliche Normen sind universaler Natur.
Die unter Druck stattfindende eskalierende Aufrüstung könnte der Beginn einer weltweiten Rüstungsspirale mit katastrophalen Konsequenzen sein, nicht zuletzt auch für die globale Gesundheit und den Klimawandel. Es gilt, bei allen Unterschieden, einen weltweiten Frieden anzustreben. Der europäische Ansatz der gemeinsamen Vielfalt ist hierfür ein Vorbild.
Wir sind, sehr verehrter Herr Bundeskanzler, überzeugt, dass gerade der Regierungschef von Deutschland entscheidend zu einer Lösung beitragen kann, die auch vor dem Urteil der Geschichte Bestand hat. Nicht nur mit Blick auf unsere heutige (Wirtschafts)Macht, sondern auch in Anbetracht unserer historischen Verantwortung - und in der Hoffnung auf eine gemeinsame friedliche Zukunft.
Wir hoffen und zählen auf Sie!
Hochachtungsvoll
DIE ERSTUNTERZEICHNERiNNEN
Andreas Dresen, Filmemacher
Lars Eidinger, Schauspieler
Dr. Svenja Flaßpöhler, Philosophin
Prof. Dr. Elisa Hoven, Strafrechtlerin
Alexander Kluge, Intellektueller
Heinz Mack, Bildhauer
Gisela Marx, Filmproduzentin
Prof. Dr. Reinhard Merkel, Strafrechtler und Rechtsphilosoph
Prof. Dr. Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler
Reinhard Mey, Musiker
Dieter Nuhr, Kabarettist
Gerhard Polt, Kabarettist
Helke Sander, Filmemacherin
HA Schult, Künstler
Alice Schwarzer, Journalistin
Robert Seethaler, Schriftsteller
Edgar Selge, Schauspieler
Antje Vollmer, Theologin und grüne Politikerin
Franziska Walser, Schauspielerin
Martin Walser, Schriftsteller
Prof. Dr. Peter Weibel, Kunst- und Medientheoretiker
Christoph, Karl und Michael Well, Musiker
Prof. Dr. Harald Welzer, Sozialpsychologe
Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist
Juli Zeh, Schriftstellerin
Prof. Dr. Siegfried Zielinski, Medientheoretiker
WER DEN OFFENEN BRIEF EBENFALLS UNTERZEICHNEN MÖCHTE,
BITTE AB SOFORT AUF CHANGE.ORG
WEITERE UNTERZEICHNERiNNEN
Katja Lange-Müller, Schriftstellerin
Katharina Fritsch, Künstlerin
Prof. Klaus Staeck, Grafiker, Heidelberg
Prof. Yuji Takeoka, Künstler
Dilek Zaptcioglu, Historikerin und Schriftstellerin
Oliver Schnare, Angestellter
Brigitte Kamps-Kosfeld, Sozialwissenschaftlerin
Heide Schnitzer, Reutlingen
Axel Beck, Petershagen
Prof. Dr. Anne-Gret Luzens, Mathematikerin (im Ruhestand)
Günter Luzens, Dipl.-Ing. (im Ruhestand)
Katharina Rinn, Human. Mother. Civil Engineer. Yogini. Tattooista. Gießen
Manfred Prantner, MAS, Wirtschafts-, Trauma- und Medienpädagoge, Landeck/Österreich
Dagmar Priepke, Frankfurt/Main
Andrea Köhrer
Barbara Gorel
Sonja Schönherr
Volker Groß, Hamburg
Corinna Behrens, Verwaltungsbetriebswirtin, Autorin, München
Mathias Liebig
Richard Wichmann, Studiendirektor a.D., Wallenhorst
Claudia Bittkowski
Klaus Keller, ehem. Krankenpfleger und Zeitsoldat, Gelnhausen
Dagmar Willhalm, Selbstständige
Silke Hillebrecht
Dieter Tackmann, Pensionär, Schwerin
Siegfried Niemeyer, Sonderschullehrer a.D., Osnabrück
Angelika Mallmann, EMMA-Redakteurin
Margitta Hösel, EMMA-Redakteurin
Anett Keller, EMMA-Verlagsleiterin
Chantal Louis, EMMA-Redakteurin
Annika Ross, EMMA-Redakteurin
Dr. Franz Schötz
Albrecht Hahn, Kleinmachnow
Klaus Maisch, Ettlingen
Doris Dauber
Ralf Schönwald, Zossen
Oliver Tabillion
Annegret Soltau, Bildende Künstlerin
Daniel Berger, Historiker
Karl-Heinz Deubner, Techniker
Stefanie Tyrach
Dr. Jörg Tyrach
Artur Born
Ralf Wirtz, EWI Erftland
Uwe Weller
Monika Baumann
Rupert Wille, Harsum
Thomas Sonntag, Kaarst
Annette Brückner
Martin Dörnhöfer
Axel Reinert, Angestellter
Benjamin Mayr, Rain am Lech
Fred Eric Schmitt, Journalist, Überherrn
Jessica Franck
Monika Anna Seeckts, Berlin, Rentnerin
Katja Fischer, Ärztin
Tilo und Inka Voigt
Katja Rebner
Heinz-Bernd Dannhüser, Beamter
Kerstin Knuth-Foltyn
Susanne Harbach
Prof.em.Dr.Dr.h.c. Hans-Peter Schwarz, Kunsthistoriker
Gertrud Peters, Kuratorin
Dr. Andrea Gleiniger, Architekturhistorikerin und Autorin
Ina Kohnle
Iris Zyngier
Peter Goebel, Bickenbach
Bernhard Alberts, Wiesbaden
Dr. Alexander Grau, Publizist, Journalist, Philosoph
Hiltrud Hamer
Daniela Schlarb
Thomas Härtel, Arzt
Ulrike Schaller-Scholz-Koenen, Sozialarbeiterin, Kunsttherapeutin, Bildende Künstlerin
Margit Reiner, Dipl.-Ing. Techn. Umweltschutz
Dr. Joachim Langstein, Bayreuth
Peter Krieger, Künster
Jürgen Weiß, Zwickau
Claudia Thirolf, Lehrerin a.D., Pädagogin, Lübeck
Ulrich Knak
Maria Rasche, Berlin
Renate Habeck, besorgte Bürgerin, geb. 1959
Frank Fuchs, Friedrichshafen
Harry Karpfinger
Gerd Bauz
Florian Mayr, Trostberg
Andreas Eichhorn
Ursula Morgenstern, Magdeburg
Matthias Keilwerth
Jan Heitmann, Dudeistischer Priester
Heike Orthen
Kalle Witzel, OStR im Ruhestand
Volker Gericke
Dorothea Kraus
Sven Respondek (Dj Spikee), Künstler
Griseldis Wilsdorf, Ärztin
Marco Böse, Techn. Angestellter Forschung und Entwicklung
Stephanie Frfr. von Liebenstein, freie Wissenschaftlerin
Bärbel Hirsschmann, Graal-Müritz, Rentnerin
Katrin Klincker-Kroth
Klaus und Marlies Thormann, Rentner
Ulrike Kraus, Rudolstadt
Matthias Lessig, Frankfurt am Main
Annett Markert, Niedernberg
Prof. Dr. Ingo Juchler, Politikwissenschaftler
Elke Fasler, Zittau
Dagmar Frost; Dr. med. Ursula Schlichtiger; Arno Bergsträßer; Annedore Waesche, Rektorin im Ruhestand; Wilfried Böring, Westerstede; Sven Bahnemann; Mario Magliani; Jochen Winter, Maler, Berlin; Christel Lemcke; Ilona Kolling, Zeitz; Gregor Ziese-Henatsch, Lehrer, Berlin; Christian Otte, Gitarrist; Walter Fuchs-Stratmann, Mensch, Bruder, Vater, Großvater, Leverkusen; Prof. Dr. Willi Bruns, Ingenieur, Berlin; Christine Zumbeck, Juristin; Utz Modrow; Torben Wieben; Birgit Löwinger; Birgit Kollmer; Angelika Müller; Norman Gilster; Edelgard Gilster; Rainer Gilster; Margitta Holitschke, Gymnasiallehrerin i. R., Leipzig; Laurent Goletz; Simone Kneitz-Mertin; Doris Dau, Panketal; Uwe Gremmel; Daniela Pass, Diplom-Designerin, Berlin; Angela Reinhardt; Alexander Böhle, Südharz/Bad Sachsa; Dr. phil. Dr. h.c. Stefan Neuhaus, Professor für Neuere deutsche Literatur, Uni Koblenz-Landau, Mendig; Eberhard Firl; Matthias Hechler, Unternehmer; Verena Brönnimann, Hausfrau, Schweiz; Jürg Wisbach, Schauspieler; Susanne Mingers, Heilpraktikerin; Jürgen Schadach, 67, Rentner; Steffen Schwarzbach, Ingenieur, Dresden; Peter Darga, Osteopath, Hamburg; Christine List, Berlin; Elke Blum; Karolin Bethke; Frau Puscholt; Dr.Karen Kaczmarek, Ärztin; Marlene Neske, Sozialpädagogin, Rentnerin; Urte von Bremen; Anna Morath; Christoph Heberle; Kerstin Vogel; Helmut Ullmann; John Schulz, Braunschweig; Frieder Monzer, Physiker, Umweltberater und Reisebuchautor, Berlin-Moabit; Sabine Slak; Andre Mees; Axel Witte, nur besorgter Bürger; Peter Otto, Berlin; Liane Bertram, Wernigerode; Lisa Heussner; Thomas Erler, KOOP – Abteilung, Außerbetriebliche Ausbildungsstätte, HWK Dortmund GmbH; Melanie Schulze, Rechtsanwältin, Bensheim; Traudl Kellermann, Dipl.-Soziologin und Versicherungsfachfrau; Armin Eichinger, Wenzenbach; Martina Eichinger Wenzenbach; Simon Eichinger Wenzenbach; Anna Eichinger Wenzenbach; Heinz Eichinger Wenzenbach; Joachim Neumann, Bernau bei Berlin; Thomas Heusel, Breuberg; Joachim Hoffmann, Gütersloh; Michael Schnelle; Mike Piee; Helmut Schulze, Berlin-Rahnsdorf; Gesa Homann, Juristin; Matthias Wiesmann; Paul Noel Koch; Alfred Prenzlow, Kunst|Menschen|Ideen, Leverkusen; Tatjana Peters, Unternehmerin, Obertshausen; Alexander Schindler, Deutschlehrer; Elke Knorr; Katharina Füllenbach; Gerald Rimpl; Peter Schmolke, Familienvater; Heiko Sadowski, Angestellter; Wilfried Maria Danner, Künstler, Komponist; Maik Schulze, Zwickau; Jutta Wirz; Ursula Krüger, Mutter und Grossmutter; Carina Rollenhagen; Alexander Ahner, Nidda; Peter Veittinger, Werkzeugmacher, Steingaden; Susann Witt; Silvia Möpert; Jürgen Herzog, Rentner, Presseck; André Seifert, Betriebswirt (IHK); Michael Tanz, Bottrop; Ilona Legler, Berlin; Hans-Bernd Ludwig, Halle; Werner Kick, Ismaning; Alexander Morgenstern, Mensch; Konrad Litschel, Unternehmensberater und Interimmanager, geboren 1966, Sachsenheim; Wolfgang Scheel; Stefan Oberpaul, Friedrichshafen; Jörg Cornelius, Bielefeld; Peter Sachs, Lehrer; Hans-Peter Eschen; Christian Broda, Jurist und Zukunftsforscher M.A.; Nicole Noheimer; Thomas Kretschmer, Rechtsanwalt , Lüssow/Stralsund; Lya Coldewey, Wennigsen; Christian Timm, Neukirchen; Daniel Bracht-Franke, Steinfurt; Herbert Müller, Dipl. Ing.; Kathleen Sandböck; Kapitän Thomas A. Liebert, Seelotse; Annett Kratzius-Rother, Selbständige, Gera; Detlef Rother, Selbständiger, Gera; Linus Pilch; Christian Broszio, Diplom-Psychologe, Ludwigshafen am Rhein; Christine May; Bernd Herrmann, Sportdirektor SSV Gera 1990e.V.; Jörn Rinke, Gera; Peter Gilles (Dipl.-Wirt.-Ing.), Unternehmer; Sebastian Linnerz, Grafikdesigner; Christiana Protto, Frankfurt am Main; Marlies Krämer, Sulzbach/Saar

Repression & Widerstand ; Die anderen Schulden – Bericht über Menschenrechtsverletzungen; Info über Argentinien
(Buenos Aires, 5. April 2022, lavaca/poonal).- Anfang April hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty Argentinien ihren jährlichen Bericht über Menschenrechtsverletzungen im Jahr 2021 veröffentlicht. Die Situation im Land wird darin auch im Hinblick auf Entwicklungen in Nord- und Südamerika betrachtet. Die Region „hatte bereits vor Covid-19 die höchste Einkommensungleichheit der Welt“, so der Bericht.
Diese Ungleichheit hat sich nun im Laufe der Pandemie verfestigt, auch falsche Versprechen der Regierung verbessern nichts an dieser Situation. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die wichtigsten Themen, auf die der Menschenrechtsbericht eingeht: das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, Feminizide, Kindesmissbrauch, staatliche Gewalt und das Ley Humedales – ein Gesetz, das die Feuchtgebiete des Landes vor Bränden schützen soll.
Das Recht auf freie, sichere und kostenlose Abtreibungen
Seit Ende 2020 sind Abtreibungen bis zur 14. Schwangerschaftswoche in Argentinien erlaubt. Die Verabschiedung des entsprechenden Gesetzes war ein historischer Erfolg der feministischen Bewegungen. Doch „ein Jahr nach der Annahme des Gesetzes 27.610 ist der Zugang für Frauen und gebärende Personen zu einem Schwangerschaftsabbruch noch immer erschwert. Das beginnt schon bei der Frage, wie und wo dieser vorgenommen werden kann: Ein Recht, das man nicht kennt, kann man auch nicht in Anspruch nehmen“. Zu diesem Ergebnis kommt der Amnesty-Bericht nach Anfragen an öffentliche Stellen, Interviews mit medizinischen Angestellten, Aktivist*innen, Anwält*innen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Betroffenen, die am eigenen Körper erlebt haben, wie schwer es ist, Zugang zu einer legalen Abtreibung zu bekommen. Das Urteil: Es fehlt an groß angelegten Kampagnen. Nur einige Provinzen des Landes haben einzelne Maßnahmen unternommen, um Informationen über das Recht auf einen freien, kostenlosen und sicheren Schwangerschaftsabbruch zu verbreiten.
Ein weiterer wichtiger Punkt des Berichts bezieht sich auf die Hotline für sexuelle Gesundheit, die das argentinische Gesundheitsministerium anbietet: Neun von zehn Anrufen haben mit dem Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen zu tun. Auch wenn damit der Beunruhigung und Ratlosigkeit der Betroffenen geholfen werden kann, „führt das in der Realität zu einem bürokratischen Kreislauf, der den Prozess der Beratung und des Zugangs sehr umständlich macht.“
Außerdem geht der Bericht auf den rechtlichen Umgang mit Abtreibungen ein. Einerseits werden Angestellte im Gesundheitswesen, die das Recht auf Abtreibung garantieren, noch immer kriminalisiert. Dazu gehört etwa das Strafverfahren gegen Miranda Ruiz: Die Ärztin, die im Krankenhaus Juan Domingo Perón in Tartagal, einer Stadt in der nordwestargentinischen Provinz Salta, tätig ist, hatte einer erwachsenen Patientin Zugang zu einer legalen Schwangerschaft gewährt. Trotzdem ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen der angeblichen Verursachung eines Schwangerschaftsabbruchs ohne Zustimmung. Auf der anderen Seite wurden bis Dezember 2021 bereits 37 Klagen gegen das Gesetz zur Legalisierung von Abtreibungen vorgelegt. Und das, obwohl die Judikative bereits in früheren gerichtlichen Prozessen jegliche Aktionen gegen die Norm systematisch zurückgewiesen hat.
Femizidale Gewalt
„Die geschlechtsspezifische Gewalt ist in Argentinien in dieser Dimension eine endemische Krise, die keine Regierung jemals lösen konnte“, heißt es im Bericht kategorisch. „Es scheint, dass die öffentliche Politik zur Beseitigung der geschlechtsspezifischen Gewalt nicht funktioniert. Außerdem fehlt den zuständigen Beamten, die das Gesetz erfüllen und anwenden sollen, die angemessene Perspektive.“
Der Bericht nimmt auch die Ergebnisse der Beobachtungsstelle für Feminizide der staatlichen Behörde Defensor del Pueblo de la Nación auf: 289 Todesopfer habe es im Jahr 2021 durch femizidale Gewalt gegeben. Die Beobachtungsstelle Lucía Pérez, eine öffentliche und selbstverwaltete Institution, registrierte jedoch mehr Fälle: 323 Feminizide und Travestizide (Morde an trans Personen und Travesti) im Jahr 2021.
Kindesmissbrauch
Beim Thema Kindesmissbrauch bezieht sich Amnesty Argentinien auf die Daten der landesweiten Umfrage über Kinder und Jugendliche, die UNICEF von 2019 bis 2020 durchgeführt hat. Laut dieser Umfrage gaben 11 Prozent der befragten Frauen zwischen 18 und 49 Jahren an, in ihrer Kindheit oder Jugend sexuell missbraucht worden zu sein. Übertragen auf Kinder und Jugendliche heute bedeutet das, dass mindestens eines von zehn Kindern oder Jugendlichen unter sexualisierter Gewalt leidet.
Außerdem gebären jedes Jahr etwa 80.000 Jugendliche ein Kind, 70 Prozent davon ungewollt und ungeplant. Besonders trifft das auf die unter 15-Jährigen zu: Acht von zehn dieser Jugendlichen wurden in Folge eines sexuellen Missbrauchs oder sexualisierter Gewalt schwanger, teilte eine Stelle des argentinischen Gesundheitsministeriums mit.
In Bezug auf den sexuellen Missbrauch von Kindern bezieht sich der Amnesty-Bericht etwa auf den Fall Thelma Fardin. Die Schauspielerin hatte ihren eigenen Fall öffentlich angezeigt. Am Abend darauf stiegen die Anrufe bei der für Kindesmissbrauch zuständigen Stelle um 1.200 Prozent. Im Bericht heißt es: „In Argentinien kommt es in nur 15,5 Prozent der Anzeigen von Delikten gegen die sexuelle Unversehrtheit zu einem Urteil. Dieses Muster zeigt sich auch in anderen Ländern des Kontinents. Die Straflosigkeit bei sexualisierter Gewalt sendet eine falsche Botschaft, nämlich die, dass Gewalt gegen Frauen toleriert wird. Das verstärkt das Gefühl der Unsicherheit und das anhaltende Misstrauen gegenüber der Justiz.“
Das Programm ESI (Educación Sexual Integral) soll die grundlegende Sexualerziehung in Argentinien gewährleisten. Es sieht Maßnahmen vor, damit Kinder und Jugendliche zum Beispiel Fälle von sexuellem Missbrauch erkennen und vorbeugen können und Methoden lernen, um ungewollte Schwangerschaften zu verhindern. Doch auch 16 Jahre nach Einführung des Programms gibt es noch immer eine deutliche Kluft zwischen den normativen Zielsetzungen und ihrer tatsächlichen Umsetzung. So berichtet Amnesty, dass nur 4 Prozent der Sekundarschüler*innen bejahte, Bildung über die grundlegenden, priorisierten und verpflichtenden Inhalte der ESI erhalten zu haben. Sieben von zehn Lehrer*innen gaben an, in Sachen geschlechtsspezifischer Gewalt, sexuellem Missbrauch an Kindern, sexueller Vielfalt sowie diverser Geschlechtsidentität und -ausdruck nicht genug geschult zu sein. Dies zeigt, dass es an staatlichen Maßnahmen fehlt, um die Bildung, die das entsprechende Gesetz vorsieht, auch tatsächlich zu gewährleisten.
Staatliche Gewalt
Bereits in den vergangenen Jahren hat Amnesty International in ganz Argentinien Fälle von Misshandlung, Erniedrigung, Drohung, exzessivem Gewaltgebrauch und Tötung durch staatliche Sicherheitskräfte registriert. Auch im Jahr 2021 gibt es solche Fälle zu beklagen. Auf einige Fälle der vergangenen Jahre soll hier im Einzelnen kurz eingegangen werden:
Der 17-Jährige Lucas González wurde im Viertel Barracas von Buenos Aires von Polizeibeamten erschossen.
In der Provinz Chaco drang eine Gruppe Polizist*innen unter Einsatz von Gewalt und ohne rechtliche Anordnung in das Haus einer Familie Qom-Indigener ein.
Der 22-Jährige Mauro Coronel starb, nachdem er in Santiago del Estero gewaltvoll von der Polizei festgenommen wurde.
Blas Correa, 17 Jahre alt, fuhr mit vier Freunden in Córdoba Auto, als er von der Polizei erschossen wurde.
Der 23-Jährige Josué Lagos, ebenfalls Mitglied der indigenen Gemeinschaft Qom, wurde während eines Polizeieinsatzes in der Provinz Chaco von Sicherheitskräften angeschossen.
Santiago Maldonado wurde 28 Jahre alt. Seine Leiche wurde im Jahr 2017 in einem Fluss auf dem Gebiet der Mapuche in der Provinz Chubut gefunden – 78 Tage, nachdem Sicherheitskräfte die Region abgeriegelt hatten.
Die Leiche des 22-Jährigen Facundo Castro wurde 107 Tage, nachdem er Ende April 2020 verschwunden war, gefunden. Er wurde zuletzt bei einer Polizeikontrolle in der Provinz Buenos Aires gesehen.
Das Ley Humedales
Fast ein Viertel der Fläche Argentiniens (21 Prozent) sind von Feuchtgebieten bedeckt. Im Jahr 2020 fielen fast 1.200.000 Hektar davon Bränden zum Opfer. Im Jahr 2021 haben die riesigen Brände in der Provinz Corrientes und die Ausrufung des Notstands durch die Regierung gezeigt, dass die Gefahr neuer derartiger Notlagen durch Brände weiterhin besteht.
Bereits seit 2013 wurden mehrere Entwürfe für ein Ley Humedales, also ein Gesetz zum Schutz von Feuchtgebieten, vorgelegt. Keiner dieser Vorschläge hat es jedoch bis jetzt in den argentinischen Kongress geschafft. Im Bericht heißt es: „Die Klimakrise verschärft sich Jahr für Jahr und hat gezeigt, dass sie einen verheerenden Effekt für die Gewährleistung der Menschenrechte hat. Die intensiven Hitzewellen, Dürren und großflächigen Brände im ganzen Land haben die Notwendigkeit, das Ley Humedales im Parlament zu behandeln, wieder auf die Tagesordnung gebracht“.
Übersetzung: Susanne Brust
Quelle: Nachrichtenportal Lateinamerika 20.04.2022

Arbeit & Gesundheit Studie über Kinderarbeit – Fast ein Fünftel der Kinder erwerbstätig; Info über Brasilien
(Montevideo, 13. April 2022, la diaria/poonal).- Laut einer gemeinsamen Untersuchung der Universitäten von Zürich und Pennsylvania ist der Anteil an erwerbstätigen Kindern in Brasilien deutlich höher als bisher angenommen. Die Zahl der arbeitenden Kinder zwischen 7 und 14 Jahren sei etwa sieben Mal höher als offizielle Statistiken angegeben hatten.
Offizielle Daten des World Development Indicators (WDI), einer Datenbank der Weltbank, zeigten noch im Jahr 2015, dass 2,5 Prozent der brasilianischen Kinder erwerbstätig seien, dies entspreche etwa 738.600 Kindern. Die nun von den Professoren Lichand und Wolf durchgeführte Studie zeigt, dass diese Zahl deutlich höher ist: 5.650.000 Kinder und demnach ein Anteil von 19,15 Prozent sei erwerbstätig, wie die Tageszeitung Folha de São Paulo die Studie zitiert.
Eltern machen häufig falsche Angaben
Der Grund für den großen Unterschied in den Statistiken: Die Zahlen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) basieren auf Umfragen, die in zahlreichen Ländern durchgeführt werden. „Diese Umfragen folgen einer Methodik, bei der zuerst die Eltern gefragt werden, ob ihre Kinder arbeiten. Wenn die Eltern lügen – etwa aus Angst vor einer Strafe, aus Scham oder aus anderen Motiven – zeigen die Statistiken am Ende eine deutlich kleinere Zahl“, so der brasilianische Wissenschaftler Guilherme Lichand, der an der Universität Zürich forscht.
Die Parameter, die die Forschenden nutzen, um Kinderarbeit zu definieren, folgen den Richtlinien internationaler Organisationen wie UNICEF und wurden gemeinsam mit Schulkindern entwickelt. „Wenn ein Kind jünger als 12 Jahre alt ist, arbeitet – egal wie viele Stunden – und dafür eine Entschädigung bekommt, dann sprechen wir bereits von Kinderarbeit. Wenn das Kind zwischen 12 und 14 Jahren alt ist, spricht man ab 14 Wochenstunden von Kinderarbeit, wenn es sich nicht um gefährliche Beschäftigungen handelt. Ab 15 Jahren gilt die Schwelle von 41 Wochenstunden“, erklärte die Wissenschaftlerin Sharon Wolf von der Universität Pennsylvania.
Viele Kinder im Kakaoanbau tätig
Laut der Studie führt die Tatsache, dass Kinder direkt nach ihrer Erwerbstätigkeit gefragt werden, zu einer deutlich genaueren Quote, als wenn den Eltern die gleiche Frage gestellt wird. Dieser Unterschied wurde auch in der Befragung von Kindern und Eltern deutlich, die im Kakaoanbau im ländlichen Gebiet der Costa de Marfil tätig sind. Eine Nichtregierungsorganisation hatte dort Untersuchungen durchgeführt. […]
„Es geht hier nicht darum, den Eltern ab und zu im Haushalt zu helfen. Es geht um bezahlte Kinderarbeit. Wenn Präsident Jair Bolsonaro zum Beispiel sagt, es sei gut, dass die Kinder arbeiten: Von welcher Arbeit spricht er da? Seine Definition ist unklar, das bremst die Debatte aus“, so die Forscherin Wolf.
Der Bereich des Kakaoanbaus wurde in Brasilien zur weiteren Untersuchung und Datensammlung ausgewählt, weil es dort historisch einen hohen Anteil von Kinderarbeit gibt. Die ILO hatte im Jahr 2018 deshalb die Organisation Papel Social beauftragt, die Aktivitäten im Inneren des Landes zu untersuchen. „Etwa 700.000 Kinder und Jugendliche arbeiten in der Produktionskette von Kakao, vor allem in den Bundesstaaten Bahía und Pará. Es ist das gleiche Phänomen wie beim Palmöl, bei Tabak oder bei Gips“, erklärte Marques Casara, Geschäftsführer von Papel Social.
Quelle: Nachrichtenportal Lateinamerika 20.04.2022

Info über EL Salvador
(Montevideo, 12. April 2022, la diaria).- Laut dem salvadorianischen Präsidenten Nayib Bukele wurden seit Verhängung des Ausnahmezustands am 27. März bereits 10.094 Personen festgenommen. Die Regierung hatte den Ausnahmezustand unter Zustimmung des Kongresses als Antwort auf die im Land herrschende Gewalt durch kriminelle Banden (auch Maras oder Pandillas genannt) verhängt. Allein in den 24 Stunden des 11. April seien 463 Menschen festgenommen worden. „10.094 Terroristen in 17 Tagen verhaftet. Weiter geht es…“, teilte Präsident Bukele über seinen Twitterkanal mit.
Laut offiziellen Angaben zählen die Maras im Land etwa 70.000 Mitglieder, davon waren bereits etwa 6.000 vor der aktuellen Offensive der Regierung inhaftiert. Der Ausnahmezustand erlaubt nun die Aufhebung bestimmter Bürgerrechte und außerordentliche Einsätze von Polizei und Militär. „Ohne Waffenstillstand gegen die Verbrecher“, twitterte die salvadorianische Polizei. Dazu Bilder von entkleideten Festgenommenen, auf deren Körpern die entsprechenden Tattoos als Erkennungszeichen der Maras zu sehen waren – insbesondere die der größten Bandenorganisation Mara Salvatrucha.
Schon über 100 Anklagen wegen Menschenrechtsverletzungen
Gleichzeitig beklagen Einzelpersonen, zivilgesellschaftliche Organisationen und die Staatsanwaltschaft zur Verteidigung der Menschenrechte über 100 Anklagen wegen Menschenrechtsverletzungen. Dazu gehören vor allem willkürliche Festnahmen, wie die Nachrichtenagentur Efe berichtet. Bukele entgegnete auf die Vorwürfe, bei den zahlreichen Festnahmen, die nun stattfänden, „können wir auch erwarten, dass es eine Fehlerquote von etwa einem Prozent gibt“. Bei vorherigen Festnahmeaktionen im Land hätte es immer deutlich höhere Fehlerquoten gegeben. „Tatsächlich wurden oft Unschuldige festgenommen und die Schuldigen nicht mal angefasst“, so der Präsident. „Das ändert sich nun. Aber in einer so großen Aktion gibt es immer Fehler, die man korrigieren muss“.
Gleichzeitig stellte Bukele die Kritik an seiner Politik in Frage. „All diese Leute, Nichtregierungsorganisationen, Medien, politische Parteien und sogenannte befreundete Regierungen haben die Bandenmitglieder verteidigt. In der Konsequenz sehen die Menschen in El Salvador nun, wer hinter dem Blutvergießen an ihren Familienangehörigen und Freunden steht“, so Bukele.
US-Außenminister ruft zur Wahrung der Bürgerrechte und Pressefreiheit auf
Zu den Regierungen, die die Offensive der salvadorianischen Regierung kritisieren, gehört auch die der USA. Außenminister Antony Blinken teilte kürzlich seine „Besorgnis“ über die Gewalt, die von den Maras ausgehe, mit. Gleichzeitig verurteilte er die von Bukele angestoßenen Schritte. „Die Regierung der USA wird El Salvador weiterhin in seinen Bestrebungen, die Verbreitung der Pandillas zu unterbinden, unterstützen“. Gleichzeitig rief Blinken dazu auf „die Bürger zu schützen und gleichzeitig die bürgerlichen Freiheiten, darunter auch die Pressefreiheit, zu wahren“.
Bukele entgegnete, es habe tatsächlich Unterstützung zur Verbrechensbekämpfung aus den USA gegeben, jedoch nur unter der Administration von Ex-Präsident Donald Trump. „Jetzt unterstützen sie nur noch die Pandillas und ihre „bürgerlichen Freiheiten““.
Reform des Strafrechts bedroht auch unabhängige Arbeit der Medien im Land
Der seit dem 27. März geltende Ausnahmezustand in El Salvador erlaubt nicht nur Festnahmen und Telefonabhörung ohne richterlichen Beschluss. Auf Wunsch des Präsidenten hat der Kongress das entsprechende Gesetz so reformiert, dass Mitglieder der Maras nun mit Freiheitsstrafen von bis zu 45 Jahren bestraft werden können. Außerdem erlaubt das Gesetz den Gerichten, bei jugendlichen Straftätern das für Erwachsene geltende Strafrecht anzuwenden.
Die Reformen sehen auch Gefängnisstrafen von 10 bis 15 Jahren für „jegliche Art schriftlicher Äußerung, die auf die unterschiedlichen kriminellen und terroristischen Gruppierungen von Maras oder Pandillas anspielen,“ vor. Salvadorianische Journalist*innen sehen darin „Zensur und die Kriminalisierung von Journalismus“. Auch US-Außenminister Blinken machte darauf aufmerksam, dass die Reform „den Journalismus über bestimmte Aktivitäten der Pandillas kriminalisiert“. Außerdem öffne das Gesetz einer Zensur der Medien Tür und Tor und verhindere die Veröffentlichung von Informationen über Korruption und andere Belange des öffentlichen Interesses. […]
„Ein Attentat auf die Presse- und Meinungsfreiheit“
Unterdessen hat sich die salvadorianische Journalistenvereinigung mit dem Onlinemedium El Faro solidarisiert. Ein Mitglied der Regierungspartei Nuevas Ideas, Kevin Sánchez, hatte auf Twitter angekündigt, zwei Journalisten von El Faro bei der Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Sie hätten „Pandilla-freundliche Nachrichten verbreitet, um die Bevölkerung einzuschüchtern“. Die Journalistenvereinigung drückte ihre „enorme Besorgnis“ über den Fall aus und verurteilte „jegliche Ausnutzung der Knebelreformen gegen Journalisten in der Ausübung der Pressefreiheit“.
El Faro hatte die aktuelle Situation im Land in einer Kolumne als „antidemokratischen Prozess der Machtkonzentration und Verfolgung von Kritikern“ bezeichnet, den die Regierung in Angriff genommen habe. Dort hieß es auch: „Die Legalisierung von Zensur ist ein Attentat auf die Presse- und Meinungsfreiheit, das es so seit Ende des Bürgerkrieges nicht gegeben hat.“ Als Protest gegen diese Einschränkungen hatte das Onlinemedium außerdem die eigene Webseite für eine Zeit geschlossen.
Quelle: Nachrichtenportal Lateinamerika 20.4.2022
Menschenrechte in Chile
(Berlin, 12. April 2022, ila).- Juan Rojas-Vásquez ist Deutsch-Chilene und wuchs in der Nähe der deutschen Sektensiedlung Colonia Dignidad in Chile auf. Sein Vater Miguel Rojas Rojas und sein älterer Bruder Gilberto Rojas Vásquez sind 1973 mutmaßlich in der Colonia Dignidad verschwunden. Seit Jahrzehnten wohnt Rojas-Vásquez nun in Stuttgart und setzt sich für die Aufklärung der Fälle ein. In einem Brief an die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock vom 14. März 2022 fordert er Unterstützung der Bundesregierung bei der Aufklärung ihres Schicksals. Poonal übernimmt eine leicht bearbeitete Fassung des Briefs, die zuerst in der ila erschienen ist.
Sehr geehrte Frau Außenministerin Baerbock,
ich heiße Juan E. Rojas-Vásquez, bin deutscher Staatsbürger, Vater von vier deutschen Kindern und Opa von sieben Enkelkindern. Ich bin am 15.10.1958 geboren und aufgewachsen in einem Dorf namens Parral in Chile, in der Nähe der Colonia Dignidad, zusammen mit meinen Eltern und sechs Geschwistern. Ich verfolge mit großer Besorgnis die Lage in der deutschen Kolonie, der ehemaligen Colonia Dignidad in Chile.
Ich bitte Sie dringend, sich gegen die Menschenrechtsverletzungen an der deutschen und chilenischen Bevölkerung einzusetzen. Ich bin auf der Suche nach meinem Vater und Bruder, die in Chile festgenommen wurden und spurlos verschwanden. Mein Vater heißt Miguel Rojas Rojas und mein Bruder Gilberto Rojas Vásquez.
Am 13. Oktober 1973, etwa um fünf Uhr morgens, stürmten Polizisten und Militärangehörige unser Haus. Sie waren bewaffnet. Sie nahmen meinen Vater fest. Da sie meinen größeren Bruder Gilberto suchten, kamen sie deshalb auch ins Schlafzimmer, wo ich im Bett lag, zusammen mit drei Geschwistern. Ich sah sie, bekam einen Schock und begann zu weinen. Dann richteten diese Männer ihre Pistolen ohne Worte auf uns. Damals war ich ein Junge von 14 Jahren. Ich dachte, dass sie uns erschießen würden. Ich hatte Todesangst. Ich bekam mit, wie sie meinen Vater mit lauter und brutaler Stimme anschrien. Ich konnte außerdem hören, dass sie meinen Vater schlugen. Später erzählte mir meine Mutter, dass mein Vater in Unterhosen abgeschleppt wurde.
Am nächsten Vormittag kam meine Schwägerin weinend zu uns und erzählte uns, dass in derselben Nacht ihr Mann, mein Bruder Gilberto, abgeholt worden war, von den gleichen Männern, die meinen Vater festgenommen hatten. Der Vorgesetzte dieser Männer kannte meinen Vater persönlich, er hieß Diógenes Toledo Pérez (er ist schon verstorben). Seit dieser Nacht habe ich meinen Vater und Bruder nie wiedergesehen. Ich vermute, dass mein Vater und mein Bruder Gilberto nach der Verhaftung am 13. Oktober 1973 in die deutsche Kolonie (Colonia Dignidad) verschleppt wurden.
Auf der Suche nach meinem Vater und Bruder besuchte ich in den 70er-Jahren mehrere Male die Colonia Dignidad, in der Hoffnung, sie dort zu finden. Jedoch ohne Erfolg. Auch ihr Grab habe ich nicht gefunden, denn die Colonia Dignidad schweigt darüber bis heute. Inzwischen bin ich sicher, dass mein Vater und auch mein Bruder in der deutschen Kolonie umgebracht wurden und dort auf dem Gelände unter der Erde verscharrt wurden.
Es ist geplant, dass Flugzeuge mit geomagnetischen Sensoren über die ehemalige Colonia Dignidad fliegen, um Leichen aufzuspüren. Diese Untersuchung wurde in Chile von der Ministerin Paola Plaza angeordnet. Darüber möchte ich genau informiert werden.
Eine Gedenkstätte für die Opfer von sexuellem Missbrauch und Menschenrechtsverletzungen der ehemaligen deutsche Kolonie wird hiermit befürwortet.
Für meine Recherchen über den Verbleib meiner Verwandten habe ich einen persönlichen Preis bezahlt. Massive Schläge der chilenischen Polizei auf meinen Kopf haben zu einem Gehörverlust geführt. Unter diesen Umständen musste ich Chile als 20-Jähriger verlassen. (…)
Dr. Hartmut Wilhelm Hopp war der Arzt der auslandsdeutschen Sekte beziehungsweise der totalitären religiösen Gemeinschaft Colonia Dignidad in Chile und die rechte Hand ihres Anführers Paul Schäfer. Hopp wurde wegen Beihilfe zum von Paul Schäfer begangenen Kindesmissbrauch von einem chilenischen Gericht zu fünf Jahren Haft verurteilt. In Deutschland läuft er frei herum. Reinhard Döring ist ein deutscher Staatsbürger, der zum engen Kreis von Paul Schäfer und zur Führungsmannschaft der deutschen Sektenkolonie Colonia Dignidad in Chile gehörte. Gegen den mittlerweile in Deutschland lebenden Döring besteht ein internationaler Haftbefehl der chilenischen Behörden. Da die Bundesrepublik Deutschland eigene Staatsangehörige nicht an Drittländer ausliefert, suche ich hier nach der Möglichkeit, diese Herren zur Rechenschaft ziehen zu lassen und durch die deutsche Gerichtsbarkeit zu verurteilen. Dafür ist die Unterstützung der Politik in Deutschland notwendig.
Meine Hoffnung, die Gräber von meinem Vater und Bruder zu finden, ist für mich der einzige Weg, um mein Leben in Ruhe fortzuführen und den Traumata und Belastungen ein Ende zu setzen. Um Ihnen meine persönliche Situation vorzustellen, möchte ich ein persönliches Gespräch mit Ihnen führen. Mit der Hoffnung, dass Sie mich und die juristische Aufarbeitung der von deutschen Staatsbürgern begangenen Menschenrechtsverletzung unterstützen, verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen
Juan E. Rojas-Vásquez
Quelle: Nachrichtenportal Lateinamerika April 2022
Juan Rojas-Vásquez mit der Grünen-Bundestagsabgeordneten Renate Künast bei der Eröffnung des Oral History Archivs zur Colonia Dignidad im Jahr 2022 / Foto: Ute Löhning
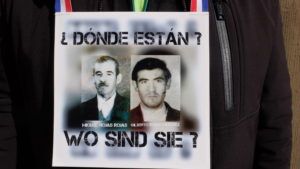

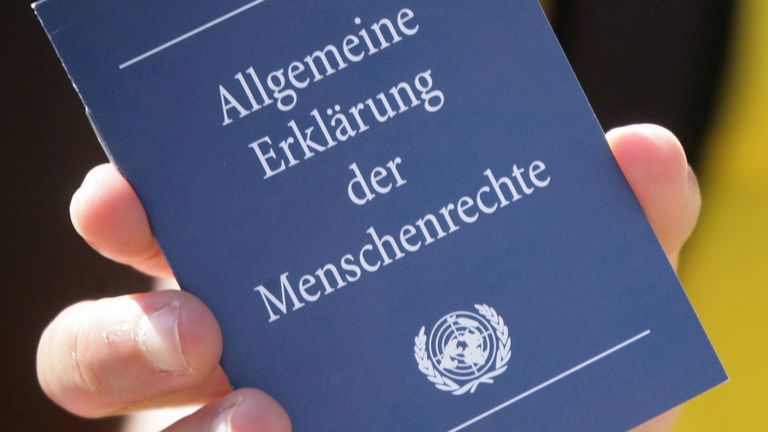
Info über Verstoß gegen Menschenrechte
Parteienverbot in Ukraine widerspricht Grundprinzipien der Menschenrechtskonvention des Europarats
„Das Verbot von elf Oppositionsparteien in der Ukraine, darunter die ,Union linker Kräfte' und die ‚Oppositionsplattform für das Leben', widerspricht grundlegenden Prinzipen der Europäischen Menschenrechtskonvention des Europarats wie auch die per Präsidialdekret verfügte Gleichschaltung der Medien“, erklärt Andrej Hunko, Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, zum Verbot von insgesamt elf Parteien durch die Selenskyj-Regierung in der Ukraine.
Sevim Dagdelen, stellvertretendes Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, ergänzt: „Durch den Ausschluss einer Vertretung gerade der Menschen in den östlichen und südöstlichen Landesteilen der Ukraine, in denen die Partei ‚Oppositionsplattform für das Leben‘ bis zu 50 Prozent der Stimmen erzielt hat, verlieren die Menschen dort die Möglichkeit demokratischer Repräsentation. Mit Parteienverboten einem großen Teil der Bevölkerung die Stimme entziehen zu wollen, ist nicht nur eine Verletzung der Vorgaben der Venedig-Kommission, sondern auch generell eine Absage an Demokratie und freie Wahlen. Diese Fehlentscheidung muss dringend korrigiert werden.“
Quelle: Andre Hunko, Sevim Dagdelen vom 21.03.2022

Verletzung der Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 11.04.2022, Seite 3 / Schwerpunkt
MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN
London macht die Drecksarbeit
London macht die Drecksarbeit: Seit Jahren bemüht sich das Vereinigte Königreich, Assange zu zermürben. Entscheidung zur US-Auslieferung erwartet
Von Ina Sembdner
Nach langer Umgarnung von britischer Seite und einem öffentlich diskreditierten Bild von Julian Assange hatte Ecuador im April 2019 unter der Präsidentschaft Lénin Morenos den finalen Schritt gewagt: Der Nachfolger des linken Rafael Correa gab den Journalisten zum Abschuss frei, die Zermürbungstaktik der britischen Justiz im Namen der USA konnte beginnen. Auch Correa und seine Familie waren intensiv ausspioniert worden. Im Mai 2019 unterzeichneten London und Quito ein Freihandelsabkommen.
Nach einem von Schikanen, fingierten Aussagen des Hauptzeugen, Rechts- und Menschenrechtsverletzungen und unhaltbaren Behauptungen durchzogenen Verfahren gegen den Journalisten in mehreren Etappen liegt die nächste Entscheidung am 20. April in den Händen der britischen Innenministerin Priti Patel. Sollte sie der Auslieferung zustimmen, kann Assange in den Punkten, in denen er ursprünglich verloren hat, Berufung einlegen. Darüber entscheidet dann der High Court. Sollte dieser zustimmen, können wiederum die USA beim Supreme Court Berufung gegen diese Entscheidung einlegen – ein Verfahren, das weitere Monate für den schlaganfallgeschwächten Verfolgten im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh bedeutet. Stimmt der High Court nicht zu, könnte der 50jährige in wenigen Wochen ausgeliefert werden. Dann drohen ihm bei Verurteilung in allen 18 Anklagepunkten 175 Jahre Haft in den USA für die Veröffentlichung der Wahrheit.
Patel selbst ist dabei seit langem in die Verfolgung des gebürtigen Australiers eingebunden. Wie die Investigativplattform Declassified UK am 29. März berichtete, war die Innenministerin »politische Beraterin« einer rechten Lobbygruppe, die Assange in den britischen Medien seit einem Jahrzehnt angreift, und wurde von dieser finanziert. Konkret geht es dabei um ihre Zeit als Mitglied des Beirats des transatlantisch ausgerichteten Thinktanks Henry Jackson Society (HJS) von 2013 bis 2016 – gemeinsam mit Lord James Arbuthnot, dessen Frau Emma später als Amtsrichterin den Prozess über die Auslieferung eingeleitet hatte. Sie fällte im Februar 2018 zwei entscheidende Gerichtsurteile gegen Assange, mit denen sie seine Ausreise nach Ecuador effektiv verhinderte.
Lord Arbuthnot war früher Minister für militärisches Beschaffungswesen und ist eng mit der Rüstungsindustrie und Geheimdiensten verbandelt. Aufschlussreich sind auch Anfragen von Declassified an das britische Innenministerium. Von Patel wurden Informationen erbeten über alle Anrufe oder E-Mails mit Bezug zu Assange, die sie seit ihrer Ernennung im Juli 2019 getätigt oder erhalten hatte. Vom Ministerium hieß es, man könne weder bestätigen noch dementieren, dass es etwas gebe, da »dies in jedem Fall die Offenlegung von Informationen bedeuten würde«. Die gleiche Anfrage erbrachte zur Amtszeit ihres Vorgängers Sajid Javid (2018–2019) die klare Antwort, man verfüge über keine diesbezüglichen Informationen. Er hatte einen Monat vor seinem Wechsel ins Finanzressort dem Auslieferungsantrag der USA stattgegeben. Großbritannien hat bis zu diesem Zeitpunkt noch nie einen Journalisten oder Herausgeber zur Strafverfolgung an ein Drittland ausgeliefert.
Quelle: junge Welt v.11.04.2022 Charlotte Graham/Pool via REUTERS

Info vom UN- Menschensrechtsrat
Aus: Ausgabe vom 09.04.2022, Seite 1 / Ausland
KRIEG IN DER UKRAINE
Russland verlässt UN-Menschenrechtsrat
Moskau tritt aus Organisation aus, nachdem UN-Vollversammlung für Suspendierung stimmte
Von Emre Şahin
Russland hat am Donnerstag (Ortszeit) den UN-Menschenrechtsrat verlassen. Zuvor hat die UN-Vollversammlung Moskaus Mitgliedschaft wegen des Ukraine-Kriegs ausgesetzt. Bei einer Abstimmung in New York votierten am Donnerstag 93 UN-Mitgliedstaaten für den US-Vorstoß zur Suspendierung von Russlands Mitgliedschaft. 24 Staaten stimmten dagegen, 58 Staaten enthielten sich. Notwendig war eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen.
Gegen die Resolution stimmten neben Russland unter anderem auch Belarus, China und der Iran. Enthaltungen gab es von mehreren afrikanischen Ländern, aber auch von Brasilien, Mexiko und Indien, berichtete AFP. Es ist erst das zweite Mal in der Geschichte des Menschenrechtsrats, dass die Mitgliedschaft eines Landes suspendiert wird. 2011 war die Maßnahme im Krieg gegen Libyen verhängt worden. Wie die chinesische Zeitung Global Times am Freitag berichtete, begründete der ständige Vertreter Chinas bei den Vereinten Nationen, Zhang Jun, seine Gegenstimme damit, die Resolution zur Suspendierung Russlands sei nicht offen und transparent verfasst worden.
Nach der Abstimmung bezeichnete der russische Außenminister Sergej Lawrow die Maßnahme in einer Erklärung als »rechtswidrigen und politisch motivierten Akt der Bestrafung«. Moskau habe deshalb beschlossen, den Menschenrechtsrat ganz zu verlassen, ähnlich wie die Vereinigten Staaten im Jahr 2018. Washington verließ damals ebenfalls das UN-Organ, weil es eine »chronische Voreingenommenheit« gegenüber Israel und einen »Mangel an Reformen« beklagte, so Reuters. Die Vereinigten Staaten wurden letztes Jahr jedoch erneut in den Rat gewählt. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, sagte am Donnerstag, die UN hätten »eine klare Botschaft gesendet, dass das Leiden der Opfer und Überlebenden nicht ignoriert wird«.
Quelle:junge Welt v. 09.04.2022
John Minchillo/AP/dpa
Die UN-Generalversammlung am Donnerstag in New York, kurz vor der Abstimmung zur Suspendierung Russlands

Art. 25 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Abs.1 Satz 1 "Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, die seine und seiner Familie Gesundheit und Wohlbefinden, einschließlich Nahrung, Kleidung Wohnung, ärztliche Betreuung... gewährleistet;"
Aus: Ausgabe vom 09.04.2022, Seite 14 / Thema
WELTHUNGER DURCH KRIEG
Geschürter Massenhunger
Durch den Ukraine-Krieg und die gegen Russland verhängten Sanktionen wird die ausreichende Versorgung mit Nahrungsmitteln weltweit erheblich erschwert
Von Wiebke Diehl
Wiebke Diehl schrieb an dieser Stelle zuletzt zusammen mit Ali Al-Dailami am 26. November 2019 über Geschichte und Hintergründe des Krieges im Jemen.
Der Ukraine-Krieg werde globale Auswirkungen haben, »die über alles hinausgehen, was wir seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben«, sagte David Beasley, Direktor des UN-Welternährungsprogramms (World Food Programme, WFP), vergangene Woche vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. In der Ukraine selbst versorge das WFP derzeit etwa eine Million Menschen mit Nahrungsmitteln. Man gehe aber davon aus, dass die Zahl der Hilfsbedürftigen dort auf 2,5 Millionen, bis Ende Mai auf vier Millionen und bis Ende Juni gar auf sechs Millionen Menschen steigen werde.
Die Dimension der Krise reicht indes weit über die Ukraine hinaus: Für Deutschland hat das Statistische Bundesamt für den März eine Inflationsrate von 7,6 Prozent berechnet. So hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Viele Wirtschaftsinstitute befürchten zudem, dass die Preissteigerungen noch deutlich zunehmen werden. Der Vizepräsident des Bauernverbands Schleswig-Holstein rechnet gar mit einer Verdopplung des Brotpreises auf bis zu zehn Euro pro Kilo.¹ Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen werden sich Sprit, Energie und Lebensmittel immer weniger leisten können und so zusehends vor existentielle Probleme gestellt. Dies gilt auch deshalb, weil die Preise für Nahrungsmittel schon vor dem Ukraine-Krieg in den vergangenen Jahren beständig gestiegen sind, Löhne und Sozialleistungen aber nur minimal angepasst wurden.
Um Leben und Tod geht es derweil für unzählige Menschen in Afrika und dem Nahen Osten, wo sich Preissteigerungen infolge des erheblichen Rückgangs von Produktion und Exportfähigkeit bei Grundnahrungsmitteln sowie durch drastisch steigende Energie- und Transportpreise ganz besonders fatal auswirken. Ursächlich ist der Ukraine-Krieg selbst, in dessen Folge in der »Kornkammer« Europas, zu der neben weiten Teilen der südlichen und östlichen Ukraine auch die angrenzenden Gebiete in Russland zählen, zumindest auf ukrainischer Seite kaum noch Getreide, Mais oder Raps angebaut werden können. Aber auch die erheblich verschärften, umfassenden Sanktionen gegen das wesentlich größere und exportstärkere Russland treffen den globalen Süden mit aller Härte. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich bereits bestehende Hungerkrisen verschärfen und vielerorts sogar zu Hungersnöten auswachsen werden.
Hungerkrisen und Hungersnöte
Eine Hungersnot wird entsprechend der Integrated Food Security Phase Classification (IPC) des WFP, die von verschiedenen Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen weiterentwickelt und verfeinert wurde, ausgerufen, wenn mindestens 30 Prozent der Kinder akut unterernährt sind, pro Person weniger als vier Liter Wasser am Tag zur Verfügung stehen, mindestens 20 Prozent der Bevölkerung weniger als 2.100 Kilokalorien am Tag zu sich nehmen können, kein eigenes Einkommen mehr erwirtschaftet werden kann und mindestens zwei von 10.000 Menschen pro Tag wegen Nahrungsmittelmangels sterben. Bis von einer Hungersnot gesprochen wird, müssen fünf Stufen der Hungerkrise durchlaufen sein. Phase fünf ist so extrem, dass sie nur selten erreicht wird. Die betroffene Bevölkerung kämpft jedoch schon in den vorhergehenden Stufen oft akut ums Überleben. Hungerkrisen und Hungersnöte entstehen durch Wetterextreme wie Dürren und die damit verbundene Zerstörung landwirtschaftlicher Erträge. Allein im Jahr 2020 haben die Folgen des Klimawandels 30 Millionen Menschen zu Vertriebenen gemacht. Vor allem Kriege und bewaffnete Konflikte aber zwingen Menschen zur Flucht, zerstören Märkte und stürzen ganze Bevölkerungen in Hungerkrisen und Hungersnöte. Sanktionen und hier insbesondere Wirtschaftssanktionen verschärfen solche Katastrophen immens. 60 Prozent der Hungernden leben nach Angaben des WFP in Gebieten, in denen Krieg und Gewalt herrschen, die zumeist von Rüstungsgüter exportierenden Staaten geschürt werden.
Obwohl rechnerisch ausreichend Nahrungsmittel für die gesamte Weltbevölkerung vorhanden sind, leiden mehr als 820 Millionen Menschen weltweit Hunger. Anders gesagt: Jedem neunten Menschen stehen nicht ausreichend Lebensmittel zur Verfügung, um ein gesundes Leben zu führen. Und der Hunger nimmt tagtäglich zu – auch weil der Preisindex für Nahrungsmittel schon seit langem beständig ansteigt.
Schon vor Beginn der Eskalation des seit 2014 schwelenden Krieges in der Ukraine hatten die globalen Preise für Nahrungsmittel einen Höchststand seit 2011 erreicht. Besonders sind sie im Zeitraum von 2007 bis 2008 sowie zwischen 2010 und 2011 gestiegen. Preise für Mais, Weizen und Reis haben sich in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten auf das doppelte und mehr verteuert. Dann ließen die SARS-CoV-2-Pandemie und die ihretwegen verhängten Maßnahmen wie Lockdowns, aber auch gesunkene oder ganz wegfallende Einkommen die Anzahl humanitärer Krisen weltweit sprunghaft ansteigen. Im Vergleich zu 2019 erhöhten sich die Preise, die Hilfsorganisationen für die von ihnen verteilten Lebensmittel bezahlen müssen, um 30 Prozent. Außerdem nahmen die Lieferkosten im gleichen Zeitraum um 42 Millionen US-Dollar pro Monat zu, schreibt das WFP auf seiner Webseite. Infolge des Ukraine-Kriegs und der verschärften Sanktionen gegen Russland sind sie inzwischen gar um 71 Millionen US-Dollar pro Monat gestiegen.² Der Preis für Agrarrohstoffe erhöhte sich allein innerhalb eines Jahres um 20,7 Prozent, im ersten Pandemiejahr sogar um 31 Prozent. Bei Ölsaaten wie Raps musste gar doppelt soviel bezahlt werden, ähnlich sah es bei Mais aus.
Experten wie Hans-Heinrich Bass vertreten die Ansicht, dass auch das Verhalten der Finanzmarktinvestoren preistreibend wirkt.³ Steigende Erdölpreise haben zusätzlich extrem verschärfende Effekte. Es muss davon ausgegangen werden, dass infolge des Ukraine-Krieges und der Russland-Sanktionen die Zahl der von akutem Hunger Betroffenen noch deutlich über derzeit 267 Millionen anwachsen wird.
Abnehmende Spendenbereitschaft
Zugleich nimmt die Bereitschaft der Geberländer, für die Kosten der Versorgung der Hunger leidenden Bevölkerungen aufzukommen, beständig ab. In Syrien und dem Jemen mussten bereits Nahrungsmittelrationen gekürzt werden, weil weit weniger als 50 Prozent der benötigten Mittel gedeckt sind. Das Phänomen abnehmender Spendenbereitschaft verstärkt sich infolge des Ukraine-Krieges, denn die Regierenden der westlichen Industrienationen leiten Gelder an die ebenfalls notleidende ukrainische Bevölkerung um. Hinzu kommen immens steigende Ausgaben für die Aufrüstung des eigenen Militärs. Nicht zuletzt die zukünftige Erfüllung des Zwei-Prozent-Ziels der NATO und die gigantische Summe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr führen dazu, dass die Bundesregierung anderswo sparen wird. Im aktuell im Bundestag behandelten Haushaltsentwurf machen sich die Folgen deutlich bemerkbar: Ausgerechnet für das WFP sollen die Mittel um 56 Prozent sinken, für Krisenbewältigung und Wiederaufbau bereitgestellte Mittel um 40 Prozent. Bei einer jüngst für den Jemen abgehaltenen Geberkonferenz hat die Bundesregierung ihren Beitrag im Vergleich zum Vorjahr von 200 Millionen auf 110 Millionen Euro fast halbiert, obwohl der Bedarf laut Vereinten Nationen erheblich angestiegen ist.
Zwar rechtfertigt die Bundesregierung die drastischen Kürzungen der Beiträge ans WFP mit der während der Coronapandemie vorgenommenen Aufstockung, die man jetzt wieder zurücknehme, indem der Betrag also auf den Stand vor Corona gesetzt werde. Das ist aber alles andere als angemessen angesichts der Tatsache, dass die Folgen der Pandemie keinesfalls als bewältigt gelten können und zudem durch die aktuellen und zukünftigen deutlichen Preissteigerungen vielmehr eine weitere Erhöhung nötig wäre. In eindringlichen Worten warnen Hilfsorganisationen deshalb davor, Hungerkrisen weltweit im Zuge des Ukraine-Krieges zu vergessen.
Denn die globalen Auswirkungen machen sich bereits nach kurzer Zeit auf das schlimmste bemerkbar: Von »Schockwellen auf den Lebensmittelmärkten« infolge des Ukraine-Krieges spricht Corinne Fleischer, WFP-Generaldirektorin für den Nahen Osten und Nordafrika, und gelangt zu dem Schluss, die »Widerstandsfähigkeit der Menschen« sei »an einem Wendepunkt angelangt«. Jeder Haushalt in den betroffenen Regionen werde getroffen, niemand verschont.⁴ So ist laut WFP Speiseöl in den vergangenen Wochen im Jemen um 36 Prozent, in Syrien gar um 39 Prozent teurer geworden. Im Libanon sei der Preis für Weizenmehl um 47 Prozent gestiegen, in Libyen seien es 15, in Palästina 14 Prozent. Der Nahe Osten und Nordafrika haben vor dem Krieg und der Verhängung der Sanktionen mehr als 50 Prozent ihres Getreidebedarfs besonders aus Russland, aber auch aus der Ukraine bezogen, Kenia sogar 70 Prozent. Der sich in der schwersten Finanz- und Wirtschaftskrise seiner Geschichte befindliche Libanon deckte seinen Weizenbedarf zu 50 Prozent allein aus der Ukraine. Gerade die Länder des Nahen und Mittleren Ostens sind dafür bekannt, dass in der Vergangenheit »Brotunruhen« immer wieder zu schweren politischen Verwerfungen und gewaltsamen Auseinandersetzungen geführt haben.
Die Bevölkerung im globalen Süden treffen die Preissteigerungen nicht nur besonders hart, weil ohnehin schon große Teile der Bevölkerung hungern. Ursächlich dafür ist auch, dass dort schon jetzt zwischen 60 und 100 Prozent des einem Haushalt zur Verfügung stehenden Geldes für Nahrungsmittel ausgegeben wird – im Vergleich zu im Schnitt etwa zwölf Prozent in Deutschland. Auch deshalb beteiligen sich unter dem Strich nur die westlichen Industrienationen an den Russland-Sanktionen. Ärmere Länder könnten sich dies schlichtweg nicht leisten, selbst wenn sie wollten.
Wichtigste Exporteure fallen aus
Aus der Schwarzmeerregion wurden vor der Eskalation im Ukraine-Krieg mehr als 30 Prozent des weltweit konsumierten Weizens, davon 20 Prozent allein aus Russland, und ein fast genauso hoher Anteil an Gerste exportiert. 20 Prozent der Sonnenblumen und ihres Öls kamen aus der Ukraine, aus Russland waren es gar 70 Prozent. Hinzu kommen unter anderem Raps und Mais. Russland ist zudem gemeinsam mit Belarus der weltweit größte Exporteur für Düngemittel. Wegen der schon vor dem Ukraine-Krieg und den verschärften Russland-Sanktionen, jetzt aber noch einmal deutlich stärker gestiegenen Preise für Düngemittel sind auch Länder in Lateinamerika wie etwa Brasilien, das weltweit größter Exporteur von Sojabohnen ist, betroffen und müssen ihre Produktion zurückfahren. Mit 200 Millionen Hektar gegenüber nur 17 Millionen Hektar in Deutschland verfügt Russland über riesige landwirtschaftliche Nutzflächen. Über am Schwarzen Meer gelegene Häfen wurden bislang Grundnahrungsmittel in alle Welt verschifft.
Aber jetzt werden Ausfuhren aus russischen Häfen durch die Sanktionen erheblich eingeschränkt. So steht etwa der wichtigste russische Exporthafen Noworossijsk, der zugleich Haupthafen der russischen Schwarzmeerflotte ist, auf westlichen Sanktionslisten. Auch wissen Händler nicht, wie sie angesichts der Sanktionen Weizen und andere Grundnahrungsmittel bezahlen sollen. Zudem wird die Schwarzmeerregion von der zivilen Schiffahrt aus Sicherheitsgründen gemieden. Die in ihrer Härte fast präzedenzlosen Sanktionen gegen Russland, die von Washington vorgegeben und von den EU-Mitgliedstaaten in vorauseilendem Gehorsam umgesetzt werden, sind vielfältig. Neben der Beschlagnahmung von Vermögen von reichen Russen, die vermeintlich, aber in den allermeisten Fällen nicht nachgewiesenermaßen Präsident Wladimir Putin unterstützen, und Sanktionen im Flugverkehr wurden Handel und Finanzbranche umfassenden Einschränkungen und Blockaden unterworfen. Besonders weitgehende Konsequenzen werden der Ausschluss von russischen Banken aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT und das Einfrieren von Devisenreserven der russischen Zentralbank haben. Westliche Firmen ziehen sich mehr und mehr aus Russland zurück. Die USA haben zudem einen Importstopp für russisches Erdöl und Gas verhängt, worauf sie allerdings viel weniger angewiesen sind als die EU-Staaten: So importierte Deutschland 2019 41 Prozent seines Erdgases, 27 Prozent seines Öls und sogar 47 Prozent seiner Kohle aus Russland.
Als Gegenmaßnahme hat Moskau inzwischen den Export von Getreiden bis Ende Juni teilweise gestoppt, wenn es auch auf der Grundlage einzelner Lizenzen Ausnahmen geben soll. Zucker und Zuckerstoff sollen gar bis Ende August nicht mehr ins Ausland verkauft werden. Für die Monate Februar und März wurde zudem ein Exportverbot für Ammoniumnitrat, das für die Herstellung von Stickstoffdünger benötigt wird, verhängt. Nachdem russisches Staatsvermögen in Höhe von mehr als 300 Milliarden US-Dollar konfisziert worden war, ordnete Putin an, dass russische Rohstoffe in Zukunft nur noch in der Landeswährung Rubel bezahlt werden können. Denn in den bislang üblichen westlichen Reservewährungen gebe es keine Eigentumssicherheit mehr. Zwar haben sich die G7-Staaten geweigert, dies zu akzeptieren. Aber dass Moskau insbesondere gegenüber Deutschland und anderen EU-Mitgliedstaaten einen gewichtigen Hebel in der Hand hat, ist offensichtlich.
Ebenfalls als Gegenmaßnahme gegen westliche Finanzsanktionen hat die russische Zentralbank den Verkehr von Geldern im Wert von gleichfalls 300 Milliarden US-Dollar für »unfreundliche Länder« eingegrenzt. Der Rubel hat sich nach einem ersten starken Verfall schnell wieder stabilisiert. Dennoch: Jeder, der in Russland über ein Konto verfügt, spürt die Auswirkungen westlicher Sanktionen. Von Visa oder Mastercard ausgestellte Bankkarten können nicht mehr verwendet werden, und es ist verboten, mehr als 10.000 US-Dollar abzuheben. Dies trifft allerdings auch im Ausland lebende Russinnen und Russen sowie Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner. Die Kaufkraft der russischen Bevölkerung ist gesunken, Waren sind aus den Geschäften verschwunden. Obwohl Moskau das russische Finanzsystem nach der Verhängung von Sanktionen 2014 infolge der russischen Annexion der Krim unabhängiger gemacht und ein eigenes Kreditkartensystem eingeführt hat, werden die Auswirkungen der Maßnahmen auf die russische Bevölkerung spürbar bleiben.
Russland ruinieren
Dass die gegen Russland verhängten Sanktionen tatsächlich als »friedenspolitische Sanktionen«⁵ zu bezeichnen sind, also allein die Beendigung des Krieges gegen die Ukraine zum Ziel haben, ist mehr als fragwürdig. Denn wäre dies der Fall, müssten sich die Maßnahmen auf den militärischen Bereich beschränken und ein klares Ziel haben – nämlich die Beendigung des Krieges. Auch müsste ein Ende der Sanktionen definiert und explizit festgeschrieben werden, dass sie auslaufen, sobald Putin den Krieg stoppt. Statt dessen deutet einiges darauf hin, dass auch die gegen Russland verhängten Sanktionen dem alten, etwa aus Syrien, Kuba, Venezuela, dem Irak und dem Iran bekannten Drehbuch von Regime-Change-Versuchen folgen: Das Leid der Bevölkerung soll in einem Maße erhöht werden, auf dass die sich gegen die eigene Regierung erhebt und sie stürzt. Dafür sprechen auch zahlreiche Äußerungen von Regierenden in den westlichen Industrienationen. So will Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Russland »ruinieren«. Und US-Präsident Joseph Biden verstieg sich jüngst während eines Besuchs in Polen zu der Aussage, Putin könne »nicht an der Macht bleiben«.
Allerdings haben Sanktionen das jeweilige Ziel – zumeist den Regime-Change – in den allerwenigsten Fällen erreicht. Im Gegenteil: Die getroffene Bevölkerung rückt zumeist näher an ihre Regierung, während letztere die politische Repression erhöht. Gerade an Erdöl und Erdgas reiche Länder sind noch nie durch Sanktionen in die Knie gezwungen worden. Auch Russland wird sein Öl und Gas woanders verkaufen können. Es sind ärmere Menschen, ob in Deutschland, anderen EU-Ländern oder Russland selbst, vor allem aber im globalen Süden, die erheblichen Schaden nehmen werden, was aber die Staaten, die Sanktionen verhängen, billigend in Kauf nehmen.
Selbst sogenannte »Targeted sanctions«, also »gezielte« oder »individuelle« Sanktionen, sind in ihrer Wirkung keinesfalls so zielsicher wie behauptet. Viele, die sich heute freuen, wenn die Yachten russischer Oligarchen beschlagnahmt werden, sollten sich klarmachen, dass auch diese Form von Sanktionen in den meisten Fällen letztlich die Zivilbevölkerung trifft. Dies gilt, weil »Machteliten« sich das Geld, das ihnen genommen wird, oft aus der Staatskasse wiederaneignen. Aber auch, weil die »gezielten« Sanktionen, die äußerst willkürlich verhängt werden und denen in den allermeisten Fällen keine unabhängige Überprüfung der proklamierten Schuld des Sanktionierten vorausgeht und in deren Prozedere keine gangbaren Beschwerde- und Anfechtungsmöglichkeiten vorgesehen sind, sehr häufig nur eine Vorstufe zu Wirtschaftssanktionen darstellen. Von den gesellschaftlichen Verwerfungen, die sich in Form von in diesem Fall gegen Menschen russischer Herkunft begangenen Übergriffen und Drohungen sowie der bereits stattgefundenen Schändung sowjetischer Ehrenmale manifestieren, ganz zu schweigen.
Verantwortungslose Politik
Am 14. März erklärte Caritas International anlässlich des 11. Jahrestags des Syrien-Krieges, »der Krieg in der Ukraine« habe »dramatische Auswirkungen auf die Versorgungslage in Syrien«. Die Preise seien in nur wenigen Tagen rapide gestiegen, der Wert des syrischen Pfunds sei »kaum noch kalkulierbar«. Es zeige sich »wie unter einem Brennglas, welche drastischen Auswirkungen der Krieg auf die Ernährungssicherheit in vielen Ländern haben wird«. In Syrien leben bereits jetzt 90 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze. Verschuldet haben ihre aussichtslose Lage ebenfalls Wirtschaftssanktionen mit dem Ziel, einen Regime-Change herbeizuführen.
Laut einer im März veröffentlichten Studie des US-Instituts »Center for Global Development« werden die zu erwartenden weltweiten Preiserhöhungen mehr als 40 Millionen Menschen in extreme Armut stürzen.⁶ Wie viele – auch wegen der Russland-Sanktionen – den Hungertod sterben müssen, ist nicht abschätzbar. Zwar hat Präsident Putin angekündigt, Länder des globalen Südens könnten Importe aus Russland weiterbeziehen und in russischem Rubel bezahlen. Aber die oftmals von schweren Finanz- und Wirtschaftskrisen gebeutelten Länder, in denen ein großer Teil der Bevölkerung hungert, haben nahezu keine finanziellen Mittel, um selbst Nahrungsmittel zu beschaffen. Statt dessen sind sie auf die Unterstützung von Hilfsorganisationen angewiesen, die den Bestimmungen in ihren jeweiligen Herkunftsländern und damit auch den Sanktionsregimes unterliegen. Und auf UN-Ebene werden Washington und Brüssel dafür sorgen, dass etwa das WFP die von ihm verteilten Lebensmittel nicht in Rubel bezahlt.
Die ehemalige US-amerikanische Außenministerin Madeleine Albright befand noch Jahre später, dass die 500.000 Kinder, die durch die – zwar vom UN-Sicherheitsrat beschlossenen, in ihrer Wirkung aber zweifellos völkerrechtswidrigen – Irak-Sanktionen getötet wurden, »den Preis wert« gewesen seien. Und das, obwohl das Ziel, Saddam Hussein zu stürzen, nicht erreicht wurde. Es sieht alles danach aus, dass auch der deutsche Bundeskanzler, die deutsche Außenministerin oder der US-amerikanische Präsident diese Frage eines Tages werden beantworten müssen. Dieses Mal allerdings wird sie sich nicht auf die Bevölkerung des sanktionierten Landes beschränken.
Anmerkungen
1 https://www.salzburg24.at/news/welt/brotpreis-verdopplung-in-deutschland-befuerchtet-118962841
3 https://media.suub.uni-bremen.de/bitstream/elib/2919/1/00102366-1.pdf
5 Siehe hierzu und zum Folgenden: https://www.oefse.at/en/publikationen/aktueller-kommentar/aktueller-kommentar-maerz-2022/
Quelle: junge Welt v. 09.04.2022 Amr Abdallah Dalsh/REUTERS
Die Weizenpreise werden infolge des Krieges in der Ukraine weltweit drastisch steigen. In den Ländern des Nahen und Mittleren Ostens kam es in der Vergangenheit immer wieder zu »Brotunruhen« (Bäckerei in einem Vorort von Kairo, 31. Januar 2022)


Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Art 2 Verbot der Diskriminierung
Art. 22 Recht auf soziale Sicherheit
Ethos
Velit expetendis omittantur sed ei, sit suavitate deseruisse sententiae ex. Ne omnium mentitum sea. Hinc interesset usu no, id nec autem quando sadipscing. Vix quem errem malorum et, elit labores reprehendunt ut usu. Nullam ornatus legimus est ei, denique intellegat ex est.
Aus: Ausgabe vom 09.04.2022, Seite 16 / Feuilleton
RECHTE VON MINDERHEITEN
Eine halbe Million
Transgeschlechtlichkeit in Italien. Über den Kampf der Sichtbarmachung und Entpathologisierung
Von Francesco Bertolucci
Es wird geschätzt, dass es in Italien mindestens 500.000 Transgender gibt, deren Leben von der Schule bis zur bis zur täglichen Bürokratie ein ständiger Hindernislauf ist. In dem europäischen Land, das nach der Türkei die zweithöchste Zahl an Gewalttaten gegen transgeschlechtliche Menschen verzeichnet, scheint ihre Anwesenheit außen vor gelassen zu werden. »Sobald die Leute über uns sprechen, reden sie über Gendertheorien. Sie haben uns entmenschlicht«, so Christian Leonardo Cristalli, Vorsitzender der Gruppo Trans di Bologna. »Wir sind Menschen mit konkreten Bedürfnissen, aber unsere Körper sind nicht vorgesehen. Wir sind ein Problem.« Cristalli nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er über die Situation von Transgender in Italien spricht.
Dabei handelt es sich um Menschen jedes Alters: von kleinen Mädchen und Jungen bis hin zu Älteren. Jede Altersgruppe hat ihre eigenen Bedürfnisse, die weder von der Gesellschaft noch von dem italienischen Staat ignoriert werden können. Sie landen oft in den Nachrichten, weil, wie Professor Paolo Valerio von ONIG, dem Nationalen Observatorium für Geschlechtsidentität, erklärt, »Berichte über Missbrauch und Gewalt, die Transgender-Personen erleiden, an der Tagesordnung sind«. Gewalt bis hin zu Mord ist das, was wir wahrnehmen können. All die anderen Schwierigkeiten von Transgender im Alltag sehen wir nicht.
Name und Identität
Das Verständnis, dass bei der Geburt ein biologisches und damit ein soziales Geschlecht vorgegeben wird, das die Person nicht als ihr eigenes empfindet, entsteht in der Kindheit oder Jugend. Dies ist eine schwierige Phase im Leben. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass eine Person in der Schule von allen mit einem Namen angesprochen wird, den sie nicht als ihren eigenen empfindet, sehen Erwachsene das vielleicht als eine Lappalie. Aber für Teenager und Vorpubertierende ist es keine. Eine mögliche Lösung für diesen Fall ist der Rückgriff auf eine Aliasidentität, die in Verabredung mit der Schule in das elektronische Register eingetragen wird, um so Leid und Mobbing zu vermeiden, wie Fiorenzo Gimelli erklärt, Präsident von Agedo, einer Vereinigung von Familien und Freunden von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen und jeder anderen sexuellen oder geschlechtlichen Identität mit Büros in ganz Italien.
»Die Angst, vor den Mitschülern mit einem Namen genannt zu werden, in dem sie sich selbst nicht wiedererkennen, führt bei vielen Jungen und Mädchen zu Depressionen, Selbstverletzungen und Schulabbruch«, erklärt Gimelli weiter. Bis heute gibt es dank der Arbeit der Agedo und anderer Vereinigungen wie Genderlens in Italien 68 Schulen, in denen die Eintragung eines Alias möglich ist. Allerdings gibt es insgesamt mehr als 50.000 Schulen in Italien. »Tausende italienische Jugendliche und Vorjugendliche sind also ohne diesen
Schirm.«
Cinzia Messina erläutert die Schwierigkeiten: »Die Einführung einer Aliasmöglichkeit in den Schulen ist ein echter Alptraum.« Wie die Vorsitzende von Affetti Oltre il Genere, einer Vereinigung von Eltern von Transgender-Personen in der Emilia Romagna und Elternteil eines transgeschlechtlichen Mädchens, weiter erzählt, zögere die Schulleitung oft, weil sie weiß, dass sie mit einer Reihe von Schwierigkeiten rechnen muss. »In Ravenna zum Beispiel hatten wir keinen Erfolg. Wir haben es nicht geschafft, irgendeine Art von Selbstbestimmung zu erlangen: die Warnung eines Politikers genügt und alles bricht zusammen.«
Dabei ist das Problem geschlechtergetrennter Toiletten und Umkleideräume für Teenager und Vorschulkinder nicht unbedeutend. »Viele hören deshalb auf, Sport zu treiben, oder lassen sich aus diesem Grund vom Sportunterricht in der Schule abmelden. Nehmen wir den Fall eines Jungen, der meint, er habe eine weibliche Geschlechtsidentität«, sagt Antonella Muraca von der Sektion Genua der Agedo und Elternteil eines transgeschlechtlichen Jungen. »Wenn er beim Sport in die Mädchenumkleidekabine geht, muss er sich vor allen Anwesenden outen. Das ist in diesem Alter nicht einfach. Und vielleicht hat er Probleme, auf die Toilette zu gehen, denn dann könnte er sich outen.« Camilla Vivian, Autorin des Buches »Mio Figlio in Rosa« (Mein Sohn in Rosa), das auf den gleichnamigen Blog folgte, weist auf das fehlende Problembewusstsein hin. Dabei genüge es, Menschen, die das Problem nicht sähen, »zwei Liter Wasser trinken zu lassen, sie nicht auf die Toilette zu schicken und sie zu fragen, wie sie sich fühlen«. In ihrem Blog sprach Vivian zum ersten Mal in Italien die Frage der Geschlechtsidentität im Kindesalter an und ermöglichte es vielen Familien, mit dem Thema in Kontakt zu kommen.
»Ich lebe jetzt in Spanien, und hier ist alles sehr einfach. Es geht automatisch: Wenn man in die Schule geht und sagt, ich bin Chiara, dann ist man Chiara. Punktum. Wenn ein Kind, das bei der Geburt als männlich eingestuft wurde, sagt: ›Ich bin ein Mädchen‹, dann ist das die natürlichste Sache der Welt. Wenn man sich hier medizinisch umwandeln lassen will, geht man, sobald man kann, dorthin und beginnt innerhalb von zwei bis drei Monaten mit der Umwandlung, ohne jegliche psychologische Therapie, Tests und all die Dinge, die man in Italien macht.« Dem stimmt auch Michela Mariotto von Genderlens, einem Kollektiv von Eltern transgeschlechtlicher oder geschlechtsneutraler Menschen, zu. »In Katalonien«, so die Anthropologin, die an der Autonomen Universität von Barcelona über Geschlechtsvarianz in der Kindheit forscht, »gibt es seit 2017 ein Protokoll für Schulen, auch für private oder katholische, nach dem die Verpflichtung besteht, den Namen im Schulregister zu ändern und die kleine Person ausschließlich nach dem Geschlecht anzusprechen, mit dem sie sich identifiziert. Das gleiche gilt für die Benutzung der Toiletten, Umkleideräume, Uniformen usw.«
Aufklärung und Weiterbildung
In Italien sei die geschlechtliche Abweichung in der Kindheit eine private Angelegenheit, die irgendwie eingedämmt oder versteckt werden müsse. »In Spanien ist es eine soziale Angelegenheit, die in allen Bereichen unterstützt wird, von den Eltern über die Schule bis hin zum Sport«, fährt Mariotto fort. Es gebe Schulungen nicht nur über die Möglichkeit, dass es transgeschlechtliche Kinder gibt, sondern auch über die Tatsache, dass männlich oder weiblich zu sein nur ein soziales Konstrukt ist. In Italien stellt sich das schwieriger dar. Für Muraca von Agedo ist klar, dass die Schulung des gesamten Personals in Fragen der Geschlechtsidentität notwendig wäre. »Wir sprechen hier von Büros, Schulen und sogar Ärzten.«
Der Mangel an geschultem Personal in Italien führt dabei zu weiter gehenden Gesundheitsproblemen. »Es gibt sehr wenig Ausbildung für Spezialisten wie Endokrinologen oder Psychotherapeuten«, sagt Michele Formisano, Präsident des CEST, des trans- und geschlechtsspezifischen Gesundheitszentrums, das jeden Monat von Dutzenden von Menschen aufgesucht wird. »Es ist nicht so, dass ein Universitätsabsolvent das einfach so machen kann: Hier gibt es eine Welt in der Welt. Ein Endokrinologe muss über Erfahrung und Spezialwissen verfügen, zum Beispiel in bezug auf Menschen, die sich einer Hormonersatztherapie unterziehen.« Es gebe aber nur sehr wenige Zentren, und die Wartelisten seien sehr lang. Formisano fordert, dass es in jeder Stadt ein multidisziplinäres Zentrum geben sollte oder zumindest eine Mindestanzahl von Spezialisten in der örtlichen Gesundheitsbehörde.
Marco Piraccini/imago images/ZUMA Wire
Monica Romano setzt sich als erste transgeschlechtliche Stadträtin für ein Umdenken in Mailand ein (5.11.2021)
Aber es wird auch etwas gegen den Mangel an Ausbildung getan. Im Juli 2021 wurde SIGIS, die italienische Gesellschaft für Geschlechtsidentität und Gesundheit, mit dem Ziel gegründet, Menschen mit Geschlechtsinkongruenz zu schützen und Fachleute aus wissenschaftlicher Sicht auszubilden. Dies sei eines der wenigen Zentren, in dem in Italien Hormonbehandlungen durchgeführt werden können und an das sich jedes Jahr mindestens 300 Personen wenden, so Formisano weiter. Aber »es fehlt ein strukturierter Lehrplan«, zudem gebe es bislang noch einen Mangel an genauen Daten auf nationaler Ebene.
Trotz der wichtigen Einführung des Portals infotrans.it im Jahr 2020, das von der italienischen Regierung geschaffen wurde, um die medizinischen Dienste zu kartieren, sind die über das ganze Land verstreuten Freiwilligenverbände der Brückenkopf zwischen den wenigen multidisziplinären Zentren und den Betroffenen. Sie bieten Informationen, psychologische Unterstützung, Starthilfe, elterliche Unterstützung, Selbsthilfegruppen, Online- und persönliche Treffen, Berufsberatung und sind manchmal der Ausgangspunkt für diejenigen, die den Übergang schaffen wollen.
»Wir sind 23 Freiwillige«, erklärt Ilaria Ruzza von Sat Pink, dem ersten Anlaufpunkt für Transgender mit Büros in Verona, Padua und Rovigo. Dort kann man den Übergangsprozess mit den angeschlossenen Organisationen beginnen. »In zehn Jahren haben wir 1.484 Menschen aufgenommen, davon etwa 70 Prozent in den letzten drei Jahren.« Die Zahl steige ständig, und die meisten von ihnen sind junge Leute zwischen 15 und 22 Jahren.
»Eine Sache, die ich hervorheben möchte«, fährt Formisano von CEST fort, »ist das Problem für die Gesundheit. Wenn Sie ein Transgender-Mann sind, der nicht an der Phalloplastik operiert wurde, haben Sie keinen Zugang zu einer gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung. Gleiches gilt für eine Prostatauntersuchung, wenn Sie eine Transgender-Frau sind, die keine Vaginoplastik hatte. Und wenn Sie eine hatten, gibt es keine Aufmerksamkeit für die Pflege der Neovagina. Im Grunde wird die Person operiert und dann sich selbst überlassen.«
Die alltäglichen Probleme einer Transgender-Person in Italien betreffen nicht nur den gesundheitlichen, sondern auch den bürokratischen Aspekt. »Wir suchen keinen Pietismus, und wir brauchen ihn auch nicht«, sagt Monica Romano, die bei den letzten Wahlen in den Mailänder Stadtrat gewählt wurde. Sie versucht, um ein Zeichen zu setzen, den Aliasnamen für die Dienstleistungen der Mailänder Stadtverwaltung zu etablieren. »Ich musste mit einem Staatsanwalt sprechen, um mich Monica Romano nennen zu dürfen. In vielen Ländern gibt es einen gemeinsamen Verwaltungsakt, mit dem man seinen Namen ändern kann. Wir sind im Rückstand, aber die italienische Zivilgesellschaft ist den Institutionen voraus.«
Keine Störung
In der jüngsten Ausgabe der Internationalen Klassifikation der Krankheiten der Weltgesundheitsorganisation von 2018 wurde die Formulierung »Geschlechtsdysphorie« in »Geschlechtsinkongruenz« korrigiert und damit aus dem Kapitel der Störungen in das der sexuellen Gesundheit verschoben. »Das Problem«, bemerkt Egon Botteghi von Rete Genitori Rainbow, einer nationalen Vereinigung zur Unterstützung von LGBTI-Eltern mit Töchtern und Söhnen aus früheren heterosexuellen Beziehungen, »besteht darin, das bestehende Gesetz zu ändern, das nicht mehr zeitgemäß ist. Da es sich nicht mehr um eine psychische Krankheit handelt, sollte es keinen Diagnoseprozess mehr geben, wie es derzeit der Fall ist, ob eine Person eine Anpassung oder eine Operation haben möchte. Wir brauchen ein neues Gesetz zur Geschlechtsangleichung, das den Prozess beschleunigt, vereinfacht und von medizinischen und gerichtlichen Bewertungen befreit. So viele Menschen müssen aufgrund unserer Vorschriften, die voller Hindernisse sind, mit nicht beglaubigten Dokumenten leben. Diese Hindernisse betreffen sowohl diejenigen, die nach der Umwandlung Eltern werden möchten, als auch diejenigen, die bereits vor der Umwandlung Eltern waren.«
Botteghi erklärt die Problematik: »Für den italienischen Staat bin ich zum Beispiel zu 100 Prozent ein Mann, aber ich bin auch die Mutter meiner Kinder. Wenn ich also ein Dokument ausfüllen muss, muss ich ›Mutter‹ schreiben, wenn es verlangt wird, und die Mitarbeiter wissen nicht, was sie tun sollen, was tausend Probleme aufwirft. Es würde genügen, die Formulierung ›Elternteil‹ zu belassen. Eins und zwei sind nicht nötig. Die Formulare für diesen und andere Fälle zu aktualisieren und Schulungen anzubieten ist keine Science-Fiction.« Was die Elternschaft nach der Transition betrifft, war es lange so, dass transgeschlechtliche Menschen nach der Transition nicht Eltern werden durften. Bis 2015 war nach italienischem Recht eine Sterilisation erforderlich, um die Dokumente zu ändern.
Auch heute gibt es noch viele Hindernisse. Die »Pathologisierung« von Transgender-Personen in Italien erfolgt auch durch die Terminologie und die Art und Weise, in der über sie gesprochen wird. Dies stellte Mariotto von Genderlens in seiner Forschungsarbeit fest, für die er italienische und spanische Familien befragte. »In Italien«, erklärt der Anthropologe, »waren die einzigen Begriffe, die den Familienmitgliedern selbst zur Verfügung standen, um die Erfahrungen ihrer Söhne und Töchter zu erklären, die medizinische Sprache.« In den Interviews sprachen die Eltern selbst von Geschlechtsdysphorie, was in Spanien nicht der Fall gewesen sei. »Nein, es gab tatsächlich einmal einen spanischen Vater, der darüber gesprochen hatte«, wirft Mariotto ein, »aber er sagte, dass Dysphorie ›nicht das ist, was mein Sohn hat‹.« Er wollte sich von diesem Begriff distanzieren.
In Italien sprechen wir oft darüber, und zwar auf negative Weise. Wenn man Ärzte fragt, antworten sie mit medizinischen Begriffen. »Transgeschlechtliche Menschen existieren durch die Diagnose«, sagt Christian Leonardo Cristalli, Präsident der Associazione Gruppo Trans, die sich aus trans- und intergeschlechtlichen sowie nichtbinären Menschen zusammensetzt. »Sogar die Entscheidung der AIFA (italienische Arzneimittelbehörde), Hormontherapien nach einer bestimmten Diagnose in bestimmten Zentren kostenlos abzugeben, hat uns pathologisiert. Ich gehöre zur letzten Generation von Transmenschen, die sterilisiert werden mussten, um Dokumente zu erhalten. Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern müssen wir heute immer noch zur Psychotherapie gehen, Tausende von Euro ausgeben und unseren Zustand diagnostizieren lassen. Sogar Malta ist uns in dieser Hinsicht voraus.« Es gebe Menschen, die darauf verzichten, ins Krankenhaus zu gehen, um nicht in Verlegenheit zu kommen. Andere gingen nicht wählen, weil die Warteschlangen nach Geschlechtern getrennt sind, und geraten so in Situationen, in denen sie ständig darauf hingewiesen werden, dass sie in der falschen Schlange stehen.
Quelle: junge Welt v.09.04.2022
Yara Nardi/REUTERS
»Meine Freiheit schützt deine«: Teilnehmerinnen der Pride-Parade in Rom (8.6.2019)
Monica Romano setzt sich als erste transgeschlechtliche Stadträtin für ein Umdenken in Mailand ein (5.11.2021)

Info über Menschenrechte in EL Salvador
Vereinte Nationen, besorgt über Bandenbekämpfungsmaßnahmen in El Salvador, fordern Achtung der Menschenrechte
Der salvadorianische Präsident Nayib Bukele sagt, dass in neun Tagen des Ausnahmezustands mehr als 6.000 Menschen festgenommen wurden, was es den Behörden ermöglicht, Bandenverdächtige ohne Haftbefehl festzunehmen. Das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte äußerte sich am Dienstag besorgt über die in El Salvador beschlossenen außergewöhnlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Bandengewalt und verwies auf die angebliche "grausame Behandlung" von Gefangenen, denen vorgeworfen wird, Bandenmitglieder zu sein.
"Wir sind zutiefst besorgt über die Reihe von Maßnahmen, die kürzlich in El Salvador als Reaktion auf die Zunahme der Bandenmorde eingeführt wurden", sagte die Sprecherin der Hohen Kommissarin Liz Throssell in einer Pressemitteilung in Genf.
Der salvadorianische Präsident Nayib Bukele drängte darauf, im Kongress (der von seinen Verbündeten kontrolliert wird) auf die Genehmigung von Sofortmaßnahmen, die Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten und die Ausweitung der Polizeibefugnisse als Reaktion auf eine Welle von 87 Morden, die sich zwischen dem 25. und 27. März ereigneten, drängte.
Höhepunkte:
- Das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte äußerte sich besorgt über die angebliche "grausame Behandlung" von Menschen, die beschuldigt werden, Bandenmitglieder zu sein, und die in El Salvador inhaftiert sind.
- Seit dem Inkrafttreten des Ausnahmezustands in diesem Land am 27. März wurden Polizei- und Armeekräfte in Gebieten mit Bandenpräsenz eingesetzt.
- Nach Angaben der salvadorianischen Behörden wurden bisher mehr als 6.000 bandenbezogene Personen verhaftet.
Laut Throssell wurden polizeiliche und militärische Kräfte seit Inkrafttreten des Ausnahmezustands am 27. März in Gebieten mit Bandenpräsenz eingesetzt und "Berichten zufolge auf unnötige und übermäßige Gewaltanwendung zurückgegriffen".
Am Montag sagte Bukele, dass mehr als 6.000 Bandenmitglieder in neun Tagen des Ausnahmezustands verhaftet wurden, was es den Behörden ermöglicht, Verdächtige, Mitglieder dieser Banden zu sein, ohne Haftbefehl festzunehmen.
Bukele erlässt Den Ausnahmezustand in El Salvador, um Bandenverbrechen entgegenzutreten
Laut der Sprecherin des Hohen Kommissars wurden einige Gefangene, die beschuldigt werden, zu einer Bandengruppe zu gehören, "mutmaßlich grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung ausgesetzt", fügte Throssell hinzu.
"Wir erkennen die Herausforderungen an, die sich aus der Bandengewalt in El Salvador ergeben, und die Pflicht des Staates, für Sicherheit und Gerechtigkeit zu sorgen. Es ist jedoch unerlässlich, dass dies in Übereinstimmung mit den internationalen Menschenrechtsnormen geschieht", fügte die Sprecherin des HOHEN KOMMISSARS der Vereinten Nationen für Menschenrechte hinzu.
Diese Organisation unter dem Vorsitz der Chilenin Michelle Bachelet warnte auch vor den Reformen, die letzte Woche verabschiedet wurden, um die Höchststrafe für die Zugehörigkeit zu Banden von 9 auf 45 Jahre Gefängnis zu erhöhen, und die auch härtere Strafen für Minderjährige festlegte, die Verbrechen begehen, während sie Teil einer Bande sind.
"Wir erinnern El Salvador daran, dass das Recht auf Leben, das Recht, nicht gefoltert zu werden, die Grundsätze eines fairen Verfahrens und die Unschuldsvermutung sowie die Verfahrensgarantien, die diese Rechte schützen, jederzeit gelten, auch während des Ausnahmezustands. Dies gilt insbesondere für Kinder", sagte die Sprecherin.
El Salvador schloss das Jahr 2021 nach offiziellen Angaben mit einer Mordrate von 18 Todesfällen pro 100.000 Einwohner ab.
Quelle: SBS Espanòl 06.04.2022 (Salvadorianische Polizisten eskortieren mutmaßliche Bandenmitglieder zu einem Untersuchungsgefängnis. Quelle: Sipa USA Camilo Freedman / SOPA Images/Si)

Info zur Meinungsfreiheit
Aus: Ausgabe vom 10.03.2022, Seite 15 / Medien
PRESSE- UND INFORMATIONSFREIHEIT
Mediendiktatur des Westens
»Zensur im Namen der Demokratie«, »koloniales Modell«: Lateinamerikanische Reaktionen auf das EU-Verbot von RT und Sputnik
Von Volker Hermsdorf
Mit dem Verbot der russischen Nachrichtenportale RT und Sputnik haben EU-Politiker mal eben so Artikel 5 des Grundgesetzes der BRD außer Kraft gesetzt. Bürgern, die sich aus erster Hand über Positionen der Kriegsparteien informieren möchten, wird dies verwehrt. Journalisten werden in ihrer Berufsausübung eingeschränkt. Das restriktive Vorgehen gegen die grundgesetzlich mit »Ewigkeitsklausel« garantierte Presse-, Meinungs- und Informationsfreiheit wird in der deutschen Öffentlichkeit widerspruchslos hingenommen oder sogar unterstützt, gleichzeitig werden Angriffe auf Journalisten und Medien in Russland mehrheitlich scharf verurteilt. Die doppelten Standards werden in Lateinamerika aufmerksam registriert. Medienakteure wenden sich dort gegen die Außerkraftsetzung der Bürgerrechte durch die EU-Zensoren.
Die mexikanische Tageszeitung La Jornada bezeichnete das Verbot von Sputnik und RT in einem Leitartikel am 1. März als »bedrohlichen Präzedenzfall für die Meinungsfreiheit und das Recht auf Information«. Zu konstatieren sei ein Rückfall in die »dunkelsten Jahre des Kalten Krieges«. Das gern vorgetragene Argument, die zensierten Medien verbreiteten russische Propaganda, sei »ebenso kindisch wie parteiisch«. Zum einen sei es unmöglich, mit Sicherheit festzustellen, »was in den Medien der kriegführenden Länder Information und was Propaganda ist«, zum anderen gebe es mehr als zwei Sender, »die teilweise oder vollständig von Regierungen finanziert werden, die im aktuellen Konflikt die Ukraine unterstützen«. Die Zeitung verwies auf BBC, Deutsche Welle und Voice of America. In Kriegszeiten, »in denen sich Desinformationen, Fake News und vielfältig getarnte Medienlügen häufen«, sei es besonders wichtig, dass das Publikum verschiedene, auch widersprüchliche Darstellungen von Vorgängen miteinander abgleichen könne, heißt es in dem Leitartikel. Das EU-Verbot schade weniger der Regierung von Wladimir Putin als den betroffenen Gesellschaften, »die nun keine Bezugspunkte mehr haben (…) um zu verstehen, was in dem neuen geopolitischen Konflikt (…) geschieht«.
Vor der wachsenden Gefahr einer »globalen Mediendiktatur« zu warnen, bedeute nicht, »dass wir Putin oder einen Krieg unterstützen«, erklärte die argentinische Tageszeitung Pagina 12 am 4. März. Die Informationsverbote des Westens seien allerdings »Teil einer Strategie, auf die selbst die ehrlichsten Menschen hereinfallen«. Die Direktorin des lateinamerikanischen Nachrichtensenders Telesur, Patricia Villegas, erinnerte daran, dass ihr Sender schon mehrfach von rechten, US-freundlichen Regimen in Lateinamerika zensiert wurde. »Das war wie der erste Schritt auf dem Weg, den die Europäische Union jetzt weiter beschritten hat mit dem Verbot russische Medien. Im Namen der Demokratie werden abweichende Stimmen zum Schweigen gebracht«, stellte die kolumbianische Journalistin fest. Ähnliche Kritik äußerten unter anderem die Föderation der Journalisten Lateinamerikas und der Karibik (FEPLAC), die Nationale Journalistenföderation Brasiliens (FENAJ) und die Gewerkschaft der Medienschaffenden in Buenos Aires (Sipreba).
Es gibt auch lateinamerikanische Länder, die den Betrieb von RT in jüngster Zeit – zumindest teilweise – einzuschränken versuchten, darunter Uruguay. Die Zensurmaßnahmen trafen auf Proteste hochrangiger Politiker. So versicherte Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador am 1. März, seine Regierung werde nichts unternehmen, um »das Recht auf freie Meinungsäußerung zu irgendeinem Thema einzuschränken«. Der venezolanische Kommunikationsminister Freddy Ñáñez warf der EU vor, »die Realität und die Wahrnehmung zu manipulieren«. Der ehemalige Präsident Boliviens, Evo Morales, bezeichnete das EU-Verbot von RT und Sputnik als »Zwangsmaßnahmen«, und erklärte: »Europa verteidigt angeblich das Recht auf freie Meinungsäußerung. Jetzt sehen wir, dass es das Recht auf freie Information eher einschränkt.« Die »alte Welt« müsse »dieses Modell des Kolonialismus, der Putschisten und der Interventionisten überwinden«.
Quelle: junge Welt 10.03.2022; Bild Gleb Garanich/REUTERS
»Bedrohlicher Präzedenzfall«: RT-Übertragungswagen am Roten Platz in Moskau

Info über Philipinen
Eine Blutspur: Widerstand gegen Die Tyrannei auf den Philippinen
Im Jahr 2021 wurden mindestens 29.782 Menschenrechtsverletzungen von staatlichen Kräften der Regierung Von Rodrigo Duterte begangen - durchschnittlich 82 pro Tag.
Eine erhebliche Anzahl von Verstößen geht auf den bewaffneten Konflikt zwischen der philippinischen Regierung und der Kommunistischen Partei der Philippinen zurück, der am 26. Dezember 2021 seinen 53. Gründungsjubiläum feierte. Trotz des Umfassenden Abkommens über die Achtung der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts (CARHRIHL), das 1998 von beiden Parteien unterzeichnet wurde, kommt es regelmäßig zu Rechtsverletzungen, die im bewaffneten Konflikt begründet sind.
Anmerkung des Herausgebers: 1969, nur vier Jahre nach der jahrzehntelangen Herrschaft von Ferdinand Marcos, begann die Neue Volksarmee (NPA) – der bewaffnete Flügel der Kommunistischen Partei der Philippinen (CPP) und später Mitglied der linken politischen Koalition Der Nationalen Demokratischen Front der Philippinen (NDFP) – ihren langwierigen Volkskrieg auf dem philippinischen Land. Es dauert bis heute an.
Während eines kurzen Tauwetters in den Beziehungen in den 90er Jahren unterzeichneten die Konfliktparteien zwei Abkommen - das Gemeinsame Abkommen über Sicherheits- und Immunitätsgarantien (JASIG) und das Umfassende Abkommen zur Achtung der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts (CARHRIHL) -, in denen bestimmte Schutzmaßnahmen für politische Vertreter der Konfliktparteien bzw. Zivilisten verankert sind.
Trotz dieser Vereinbarungen haben Präsident Rodrigo Duterte und die Streitkräfte der Philippinen (AFP), wie Marcos zuvor, brutale Gewalt (und die Unterstützung der USA) angewendet, um die Rebellion zu unterdrücken - ebenso wie jede Organisation, von der sie behaupten könnte, dass sie Verbindungen zu ihr hat, real oder eingebildet. Wie der folgende Bericht des Wire-Partners Bulatlat detailliert beschreibt: "Bei weitem sind die meisten Opfer des bewaffneten Konflikts Zivilisten auf dem Land" - alltägliche philippinische Menschen, vor allem Bauern, die in die umfassende Repressionskampagne der Regierung verwickelt sind.
Menschenrechtsorganisationen wie Karapatan haben im Laufe des Jahres besondere Fälle von CARHRIHL-Verstößen festgestellt. Einige davon sind das direkte Ergebnis von Zusammenstößen zwischen den Streitkräften der Philippinen und der Neuen Volksarmee. Fast alle Verstöße wurden jedoch von der AFP begangen.
Im Jahr 2021 erlitten mindestens 21 rote Kämpfer, die von staatlichen Kräften getötet wurden, ebenfalls CARHRIHL-Verstöße. Vier weitere waren NDFP-Friedensberater und -sprecher, die trotz des Schutzes durch das Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) ebenfalls von staatlichen Streitkräften getötet wurden.
Mindestens 15 der von staatlichen Streitkräften getöteten NPA-Kämpfer wurden als kampfbereit oder kampfunfähig gemeldet. Die verbliebenen Kämpfer erlitten die Schändung der Überreste und/oder die Weigerung, die Überreste ihren Lieben zurückzugeben.
In einem aktuellen Beispiel wurde berichtet, dass Floreta "Ka Kelly" Ceballos und ihr Begleiter Wilfredo Fuentes am vergangenen 14. Dezember bei einem Zusammenstoß in der Nähe von Himamaylan, Negros Oriental, getötet wurden. NPA-Negros bestritt dies und behauptete, dass die beiden am 9. Dezember entführt und gefoltert worden seien. Berichte der NPA deuteten darauf hin, dass Ceballos "Nackentrauma, Stichwunden in der Brust und Platzwunden in ihren Armen" erlitt, während Fuentes auch Anzeichen von Folter zeigte.
Nach Angaben der NPA war Ceballos zum Zeitpunkt ihrer Entführung unbewaffnet und nicht in der Lage, sich an Kämpfen zu beteiligen.
Nicht einmal "hochkarätige Ziele" waren von CARHRIHL-Verstößen ausgenommen. Am vergangenen 29. Oktober wurde Jorge "Ka Oris" Madlos, Sprecher der Neuen Volksarmee und Mitglied ihres Nationalen Operationskommandos, zusammen mit einem Gefährten in Impasug-ong, Bukidnon, getötet. Das Militär behauptete, dass Madlos ein Opfer bei einer bewaffneten Begegnung war, aber die NDF konterte diese Behauptungen und behauptete, dass er auf dem Weg zu einer regelmäßigen Untersuchung und Behandlung sei.
In mindestens einem Fall wurden NPA-Kämpfern ihre Rechte als Kriegsgefangene verweigert, nachdem sie von staatlichen Kräften gefangen genommen worden waren. Am 11. Dezember wurde Justine Kate Raca gezwungen, sich zu ergeben, nachdem eine Begegnung mit staatlichen Kräften im Barangay Tinitian, Roxas, Palawan zum Tod eines Gefährten geführt hatte. Laut Karapatan Southern Tagalog werden Racas Rechte als Kriegsgefangene verletzt, weil sie in einem Marinelager festgehalten wird, ohne dass Anklage gegen sie erhoben wurde.
Racas getötete Begleiterin, Remil Padilla Rodriguez, soll sich bereits ergeben haben, bevor er erschossen wurde, so Augenzeugenberichte, die von Karapatan ST gesammelt wurden.
Die größten Auswirkungen betreffen die Zivilbevölkerung
Die mit Abstand meisten Opfer des bewaffneten Konflikts sind jedoch Zivilisten auf dem Land. Allein in diesem Jahr gab es mindestens 24 Fälle von militärischem Bombardement, 13 Fälle von Beschuss und 11 Fälle von Beschuss durch Militärflugzeuge über Bauerngemeinschaften im ganzen Land. Es wurde berichtet, dass mindestens 21.376 Zivilisten aufgrund dieser Vorfälle zur Evakuierung gezwungen wurden, wobei mindestens 15.000 interne Flüchtlinge aus der südlichen Tagalog-Region kamen.
In mehr als einem Fall führten die Bombenangriffe zu einer weit verbreiteten Zerstörung der Umwelt. Am 30. Oktober zum Beispiel wurden die Wälder um sitio Gabunan im Barangay Dumalaguing, Impasug-ong, Bukidnon zerstört, nachdem die FA-50-Kampfjets der AFP Bomben in der Gegend abgeworfen hatten. Der Bombenanschlag fiel mit den Berichten des Militärs über den Tod von Ka Oris bei einem angeblichen Zusammenstoß zusammen.
Abgesehen von diesen Bombenanschlägen führte das Militär allein in diesem Jahr mindestens 488 Kampfhandlungen gegen die NPA in 69 Provinzen des Landes durch. Obwohl einige dieser Operationen zu Begegnungen zwischen der AFP und der NPA führten, führten diese auch zum Tod oder zur Verhaftung mehrerer Zivilisten, die später als "NPA-Kämpfer" oder "NPA-Sympathisanten" bezeichnet wurden.
Diese Vorfälle sind auf die Städte übergeschwappt und können durch Dutertes plumpe Herangehensweise an den Umgang mit Aktivismus gesehen werden. Mindestens 40 Zivilisten wurden Opfer außergerichtlicher Tötungen, darunter neun Massenführer in der südlichen Tagalog-Region am vergangenen 7. März, der als "Bloody Sunday" bezeichnet wurde.
In städtischen Zentren werden Verstöße gegen CARHRIHL durch eine fehlende Unterscheidung zwischen progressiven und revolutionären Kräften angeheizt. Seit Dezember 2018 hat Duterte es zur offiziellen Politik gemacht, progressive Organisationen als "Fronten" der CPP-NPA-NDF zu markieren, über die National Task Force zur Beendigung des lokalen kommunistischen bewaffneten Konflikts. NTF-ELCAC-Erklärungen haben deutlich gemacht, dass es aktiv Progressive und ihre Organisationen "rot markiert", in dem Glauben, dass sie tatsächlich Kommunisten sind.
Grauzonen und Schwächen
Trotz Rechtsinstrumenten wie der Menschenrechtskommission und CARHRIHL bewegt sich der bewaffnete Konflikt zwischen der AFP und der NPA immer noch in einer Grauzone, die zu Versäumnissen und Misshandlungen auf Kosten des Lebens von Zivilisten führt.
Die Wurzeln liegen in der Weigerung der philippinischen Regierung, die NDFP als Vertreter eines kriegführenden Staates anzuerkennen. Ihr Beharren darauf, die CPP-NPA-NDFP als "Terroristen" zu bezeichnen, bedeutet, dass Institutionen und Rechtsinstrumente wie CARHRIHL bei der Überwachung von Verstößen im bewaffneten Konflikt unwirksam werden.
Es verzettelt auch Fragen der Menschenrechte unter Schichten von Spitzfindigkeiten über die AFP und die individuellen Aktionen der NPA. Keine Seite kann sich darauf einigen, was ein "gültiges" Ziel in ihrem Bürgerkrieg darstellt. Die NPA wird häufig beauftragt, sich gegen die Behauptungen der AFP über "Terrorismus" zu rechtfertigen.
Obwohl CARHRIHL Bestimmungen zur Untersuchung und Bestrafung von Menschenrechtsverletzungen im Laufe des Konflikts getroffen hat, hat das Abkommen an sich noch wenig Biss in Bezug auf die tatsächliche Durchsetzung. Zum Beispiel hat die philippinische Regierung die Aufrechterhaltung eines Gemeinsamen Überwachungsausschusses für CARHRIHL-Verstöße eingestellt, obwohl sie eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet hat. Vor kurzem gab das Ministerium für Inneres und Kommunalverwaltung eine Erklärung ab, in der es effektiv erklärte, dass es CARHRIHL nicht anerkennt und es als "nur eine Vereinbarung" bezeichnet.
Auf der anderen Seite betrachtet die NDFP CARHRIHL als "einen Schritt vorwärts in Richtung der Aushandlung eines gerechten Friedens zwischen den beiden Parteien". Sie hält weiterhin an ihrer Seite des JMC fest und drängt weiterhin auf die Fortsetzung der GRP-NDFP-Friedensgespräche.
Eine große Frage bei den Wahlen 2022 ist, wie sie sich auf den bewaffneten Konflikt auswirken wird. Keiner der großen Kandidaten hat sich noch nicht wesentlich zu Friedensgesprächen oder zur Aufrechterhaltung von CARHRIHL verpflichtet. Es besteht jedoch immer noch die Hoffnung, dass sich die Dinge in den Monaten vor Mai ändern könnten.
Quelle: 03.03.2022 Progressive International

Info über Argentinien
Argentinische Feministinnen rufen gegen patriarchale Mentalität auf
Sie werden gegen einen aktuellen Fall von Gruppenvergewaltigung in Palermo, einem Stadtteil von Buenos Aires, demonstrieren, aber auch gegen die patriarchalische Mentalität und den Machismo.
Das Kollektiv "Ni una menos" von Argentinien rief am kommenden 8. März zu einem Streik und einer allgemeinen Mobilisierung vor dem Kongress der Nation auf, um den jüngsten Fall von Gruppenvergewaltigung und sexuellem Missbrauch gegen eine junge Frau sowie die patriarchalische Mentalität und den Machismo in der Gesellschaft zu verurteilen.
Die Ablehnung des Vorfalls, der sich in der Nachbarschaft von Palermo, nördlich von Buenos Aires, ereignete, bildet das Leitmotiv des Aufrufs des Kollektivs, das als Slogan "Recover the streets" hat.
Im Einklang damit forderte die Bewegung eine stärkere Intervention der öffentlichen Ordnung des Staates, um solche Ereignisse zu verhindern. In diesem Zusammenhang sagten sie: "Die Schuld ist bei uns. Lasst diejenigen, die entkommen sind, dafür bezahlen!"
Die Mobilisierung wird von der Avenida 9 de Julio zum Kongress führen. Nach Angaben der Organisatoren hat es das Ziel, "die Schulden zu markieren, die der Staat und die Regierung gegenüber Frauen und Dissidenten haben, die Vorrang vor der Zahlung der Auslandsschulden haben müssen", sagte das Mitglied des Kollektivs, Luci Cavallero.
Die Rückkehr der Ni una menos-Bewegung nach zwei Jahren ohne Demonstration aufgrund der Covid-19-Pandemie hat vorgeschlagen, "eine Agenda von Forderungen zu weben", um die Frauenrechte auszuweiten.
In diesem Sinne gehören zu den Themen, die in den neuen Initiativen, für die das Kollektiv kämpfen will, die Anerkennung der Arbeiter in der Volkswirtschaft, Löhne, die die Inflation übersteigen, und die Einführung eines Gesetzes über die Trans-Arbeitsquote.
Zur gleichen Zeit hielten soziale und gewerkschaftliche Organisationen Demonstrationen im Stadtteil Munro (Provinz Buenos Aires) ab, um den Fall Palermo anzuprangern. Sie taten dies mit dem Slogan "Missbrauch ist Pandemie" und forderten, umfassende Sexualerziehung (ESI) in Schulen einzuführen.
Quelle: teleSUR 03.03.2022

Info über Peru
Prozess beginnt in Peru wegen Zwangssterilisation
Mehr als 200.000 indigene Frauen wurden während der Amtszeit von Alberto Fujimori (1990-2000) praktiziert.
Nach fast 20 Jahren des Wartens beginnt an diesem Donnerstag in Peru der Prozess gegen drei ehemalige Gesundheitsminister wegen der Zwangssterilisationen von mehr als 200.000 indigenen Frauen während der Amtszeit von Alberto Fujimori (1990-2000).
Drei ehemalige Gesundheitsminister werden wegen der Durchführung solcher Operationen ohne Zustimmung der Opfer strafrechtlich verfolgt, Ereignisse, die sich zwischen 1996 und 1998 ereignet haben.
Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer und Alejandro Aguinaga werden voraussichtlich zum Dock stoßen. Letzterer ist derzeit Kongressabgeordneter der Popular Force Party, die den Fujimorismus vertritt.
Presseberichten zufolge werden sie als Täter (mit Beherrschung der Tatsache) von Verbrechen gegen Leben, Körper und Gesundheit, schwere Verletzungen, gefolgt von Tod, im Zusammenhang mit schweren Menschenrechtsverletzungen untersucht.
Es wird angenommen, dass sie Zwangssterilisationen als systematische Praxis gefördert haben, um die Geburtenrate zu senken und die Armut zu verringern.
Sterilisationen wurden an frauen mit niedrigem Einkommen aus indigenen Gemeinschaften durchgeführt.
Die peruanische Verfassung besagt, dass die reproduktiven und sexuellen Rechte von Frauen genehmigt und informiert werden müssen, was sie in diesem Fall nicht respektiert hat.
Während einer Pressekonferenz am Mittwoch baten die Opfer des Falles den Generalstaatsanwalt und den Präsidenten der Justiz, "eine unabhängige, unparteiische Untersuchung ohne Diskriminierung zu garantieren".
Darüber hinaus forderten sie, "dass die Rechte der Opfer innerhalb der Frist des Gesetzes garantiert werden, damit die Wahrheit bekannt ist und wir vor Gericht gehen können".
Der Nationale Koordinator für Menschenrechte (Cnddhh) und die Organisation Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) forderten ebenfalls die Einleitung der Verfahren zur Ausweitung der Auslieferung von Fujimori.
Der ehemalige Präsident, der 2005 in Chile verhaftet und aus diesem Land ausgeliefert wurde, verbüßt eine 25-jährige Haftstrafe wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, und sein Gerichtsverfahren wegen Zwangssterilisationen würde ausgesetzt bleiben.
Experten zufolge ist es notwendig, darauf zu warten, dass die chilenische Justiz zustimmt, die Anklagen der Auslieferung auszuweiten und unter ihnen die bewusste und absichtliche Förderung von Zwangssterilisationen aufzunehmen.
Quelle: teleSUR 03.03.2022

Info über Kolumbien
Verfassungsgericht entkriminalisiert Schwangerschaftsabbrüche
(Bogotá, 22. Februar 2022, Colombia Informa/la diaria/poonal).- Das kolumbianische Verfassungsgericht hat Abtreibungen bis zur 24. Schwangerschaftswoche entkriminalisiert. Es ist ein historischer Erfolg für die feministischen Bewegungen des Landes, die unter schwierigen Bedingungen für die reproduktiven Rechte aller Frauen gekämpft haben.
Die knappe Entscheidung für eine Legalisierung von Abtreibungen fiel am 21. Februar im Verfassungsgericht des Landes in Bogotá. Fünf Richter*innen hatten dafür, vier weitere dagegen gestimmt. Zukünftig sind Schwangerschaftsabbrüche bis zur 24. Woche der Schwangerschaft legal, nach dieser Frist nur noch in drei Fällen: nach sexuellem Missbrauch, bei Lebensgefahr für die Mutter oder Lebensunfähigkeit des Fötus. Diese Regelung hatte vor der jüngsten Gerichtsentscheidung für alle Abtreibungen gegolten.
Die Bewegung Causa Justa por el Aborto, in der sich über 100 Organisationen und 130 Aktivist*innen zusammengefunden haben, hatte das Gericht über den Rechtsweg dazu gezwungen, über das Thema abzustimmen. Die historische Entscheidung könnte nun die Lebensbedingungen von Tausenden Frauen im Land verbessern.
Gericht appelliert an Kongress und Regierung
Die Pressemeldung, über die das Gericht die Entscheidung mitteilte, enthielt außerdem einen Aufruf an den kolumbianischen Kongress und die Regierung. Sie sollten politische Maßnahmen ergreifen, die das Wohlergehen von Frauen gewährleisten. „Eine eindringliche Bitte an den Kongress der Republik und die Landesregierung: dass sie unbeschadet der sofortigen Umsetzung dieses Urteils und so bald wie möglich eine umfassende öffentliche Politik formulieren und umsetzen, die die in diesem Urteil beschriebenen weiten Bereiche des mangelnden Schutzes der Würde und der Rechte schwangerer Frauen vermeidet und ihrerseits das gesetzliche Recht auf Leben während der Schwangerschaft schützt, ohne diese Garantien zu beeinträchtigen, und zwar auf der Grundlage der in der vorangegangenen Entschließung genannten Bedingungen. Dazu gehören auch die erforderlichen legislativen und administrativen Maßnahmen.“
Mit der Entscheidung mahnte das Verfassungsgericht auch an, dass der Kongress und die Regierung eine Politik einführen müsse, die klare Mindestvoraussetzungen erfüllen muss: „die klare Offenlegung der Möglichkeiten, die schwangeren Frauen während und nach der Schwangerschaft zur Verfügung stehen; die Beseitigung jeglicher Hindernisse für die Ausübung der in diesem Urteil anerkannten sexuellen und reproduktiven Rechte; das Vorhandensein von Instrumenten zur Schwangerschaftsverhütung und -planung; die Entwicklung von Aufklärungsprogrammen zur sexuellen und reproduktiven Aufklärung für alle Personen; Maßnahmen zur Begleitung schwangerer Mütter, die unter anderem Adoptionsmöglichkeiten einschließen, und Maßnahmen, die die Rechte derjenigen garantieren, die unter den Umständen schwangerer Frauen geboren werden, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen möchten“.
Das Urteil des Verfassungsgericht ist eine Errungenschaften der Frauen. Es ist ein Schritt im Kampf feministischer Bewegungen für ein universelles Recht auf Abtreibung, zu dem alle Frauen Zugang haben. Neben den Richter*innen betonen auch zahlreiche feministische Aktivist*innen, dass bei einer Entkriminalisierung nicht Halt gemacht werden dürfe. Stattdessen sei es nun angebracht, die Entscheidung in die staatliche Gesundheitspolitik zu übertragen und die Gerichtsentscheidung umfassend umzusetzen. „Wir werden so lange darauf bestehen, bis dieser ungerechte, unwirksame und kontraproduktive Straftatbestand nicht mehr angewendet wird. Die Fristen erkennen zweifellos bis zu einem gewissen Grad die Autonomie der Frauen bis zu einem bestimmten Stadium der Schwangerschaft an, aber sie beruhen nicht auf wissenschaftlichen Grundlagen und sprechen den Frauen die Fähigkeit ab, als vollwertige moralische Subjekte zu entscheiden“, sagte Ana Cristina González Vélez, führende Aktivistin der Causa Justa-Bewegung und Mitbegründerin des Runden Tisches für das Leben und die Gesundheit der Frauen.
Quelle: Nachrichtenportal Lateinamerika Februar/März 2022 (Die grüne Erfolgswelle feministischer Kämpfe erreicht auch Kolumbien / Foto: Colombia Informa)

Mauerbau in Lateinamerika
Mauerbau – Bekämpfung der Armen statt der Armut
(Montevideo, 22. Februar 2022, desinformémonos) – Bisher wurden in Lateinamerika Mauern errichtet, um wohlhabende Bezirke von den Armenvierteln zu trennen, wie etwa in Rio de Janeiro, wo die Favelas durch Mauern von den „Bairros Nobres“ abgegrenzt werden, oder in Lima, wo die berühmte „Schandmauer“ einen großen Slum in Pamplona Alta von dem wohlhabenden Viertel Casuarinas trennt.
Mobilität wird beschränkt, Migration eingedämmt
Bisher gab es zwischen einigen Ländern mehr oder weniger ausgedehnte Grenzanlagen. Argentinien errichtete eine fünf Meter hohe und 1,3 Kilometer lange Mauer, um die Stadt Posadas vom paraguayischen Ort Encarnación zu trennen, obwohl beide Länder Mitglieder des Mercosur sind. Der Bau wurde im Jahr 2015 während der Regierungszeit von Cristina Fernández vom Staat und der Provinzregierung in Auftrag gegeben. Ein neokolonialistischer Beschluss, der die Mobilität der Armen einschränkt. Schlimmer sieht es an der Grenze zwischen Mexiko und Guatemala aus: Mit Unterstützung der US-Regierung wurde hier eine umfangreiche Grenzsicherungsanlage errichtet, die die Migrant*innen zwingt, auf gefährlichere Strecken auszuweichen, wo ein höheres Risiko besteht, in die Hände von Schmugglern und Menschenhändlern zu fallen. Die 1974 in Amsterdam gegründete Non-Profit Organisation Transnational Institute (TNI) spricht in ihrem Bericht „Mundo amurallado, hacia el Apartheid Global” aus dem Jahr 2020 von einer zunehmenden Militarisierung der Grenzanlagen. Ecuador hatte 2017 versucht, eine kleine Mauer an der Grenze zu Peru zu errichten, stellte die Arbeiten aufgrund der massiven Kritik jedoch wieder ein.
Fast die Hälfte der Grenze wird zur Mauer
Am 20. Februar begann die Dominikanische Republik unter der Regierung von Luis Abinader mit dem Bau des ersten richtig langen Grenzzauns zwischen zwei Ländern der Region Lateinamerika und Karibik. Geplant ist eine fast vier Meter hohe und 20 Zentimeter dicke Konstruktion aus Stahlbeton mit 70 Wachtürmen, Bewegungssensoren, Gesichtserkennungskameras, Radar- und Infrarotsystemen. Mit einer Länge von 160 Kilometern würde sich die Mauer etwa über die Hälfte der Strecke, die die Grenze zwischen den beiden Ländern ausmacht, erstrecken. Die Gesamtkosten des Baus belaufen sich auf etwa 31 Millionen Dollar. Es gehe vor allem darum, organisierte Kriminalität einzudämmen, so die Regierung. Ebenso wichtig ist es ihr jedoch auch, die Einwanderung zu unterbinden.
Haiti, das ärmste Land der westlichen Hemisphäre
In den letzten Monaten hatte die Dominikanische Republik ihre Migrationspolitik gegenüber Haiti verschärft, zum Teil als Folge der schweren Krise, in der das Land sich befindet. Medienberichte brachten die Hintergründe deutlicher auf den Punkt: Haiti sei „einer der ärmsten Orte Lateinamerikas und der Welt“, während die Dominikanische Republik „ein sehr beliebtes Reiseziel in der Region ist, das in den letzten Jahrzehnten einen beträchtlichen Aufschwung verzeichnen konnte.“ In Haiti leben elf Millionen Menschen, von denen nach Aussagen der Organisation Médecins du Monde weit mehr als ein Drittel auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Etwa 500.000 Haitianer*innen leben in der Dominikanischen Republik, wo sie im Baugewerbe 29 Prozent, in der Landwirtschaft etwa 28 Prozent der Beschäftigten stellen. Rund neunzig Prozent der Haitianer*innen sind afrikanischer Abstammung, während in der Dominikanischen Republik Menschen mit europäischem Hintergrund und hellerer Haut dominieren. Menschen aus Haiti werden marginalisiert. Die zunehmende Militarisierung der Region, Begleitmusik des Mauerbaus, richtet sich überwiegend gegen Arme und Migrant*innen und schürt Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Insofern war es sicher kein Zufall, dass das Bauprojekt am Ufer des Masacre-Flusses, wo sich der wichtigste Grenzübergang der Insel befindet, in Anwesenheit einer großen Militärdelegation aus den höchsten Rängen der Streitkräfte stattfand.
Quelle: Nachrichtenportal Lateinamerika Feb/März 2022

Gegen Krieg und für den Frieden und Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 02.03.2022, Seite 2 / Inland
HOCHRÜSTUNGSKANZLER SCHOLZ
»Bellizistische Kehrtwende ist unvorstellbar«
Bundesregierung nutzt Russlands Krieg in der Ukraine für groß angelegte Aufrüstung und Waffenlieferungen. Ein Gespräch mit Jürgen Grässlin
Interview: Kristian Stemmler
Für Entsetzen hat die Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Sondersitzung des Bundestags am Sonntag gesorgt, 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr aufzuwenden. Wie bewerten Sie den Schritt?
Auf der einen Seite sind wir alle erschrocken über das Vorgehen der russischen Streitkräfte. Extrem geärgert habe ich mich darüber, dass Bundeskanzler Olaf Scholz unter dem Eindruck dieses völkerrechtswidrigen Angriffskrieges »eine Zeitenwende in der Geschichte des Kontinents« verkündet hat. Über ein Sondervermögen soll der Verteidigungsetat um rund 40 Prozent erhöht werden, 100 Milliarden Euro schuldenfinanziert für die Bundeswehr bereitgestellt werden. Die Ukraine erhält deutsche Kriegswaffen. Diese bellizistische Kehrtwende des sozialdemokratischen Bundeskanzlers ist für mich nicht nachvollziehbar, eigentlich unvorstellbar. Olaf Scholz könnte als Hochrüstungskanzler in die deutsche Geschichte eingehen.
Die Reaktionen der Aktienmärkte kamen am Montag postwendend.
Wo Krieg ist, finden sich immer die Profiteure des Mordens und Abschlachtens. Entgegen dem Kursverfall in den ersten Kriegstagen profitierten die Händler des Todes vom Krieg in der Ukraine: Die Aktie von Krauss-Maffei Wegmann stieg innerhalb eines einzigen Tages um 3,6 Prozent, die von Hensoldt um 5,1 Prozent, Airbus um 6,5 Prozent und Rheinmetall um sieben Prozent.
In welchem Umfang werden deutsche Waffen an die Ukraine geliefert?
Die Bundesregierung hat den NATO-Partner Niederlande ermächtigt, 400 Panzerfäuste aus deutscher Produktion an die Ukraine zu liefern, zudem 14 gepanzerte Fahrzeuge. Aus den Beständen der Bundeswehr werden weitere 1.000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen des Typs »Stinger« geliefert. Dies seien Defensivwaffen, sagt die Ampelkoalition. Wir warnen vor diesem Trugschluss: Jede vermeintliche Defensivwaffe kann auch offensiv eingesetzt werden. Defensivwaffen gibt es nicht.
Zeitgleich zur Debatte im Bundestag gab es vor dem Reichstagsgebäude am Sonntag eine Kunstaktion. Was war zu sehen?
Studierende der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim haben unter Leitung von Mathias Rebmann eine riesige Präsentationswand errichtet, die einen Einblick in »Deutschlands größte Waffenkammer« ermöglichte. Der Bundestag wurde mit Röntgenstrahlen durchleuchtet, zum Vorschein kamen Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe und Panzer. Zeitgleich mit Scholz hielt ich meine Rede vor dem Bundestag. Darin habe ich die Kehrtwende zur Abrüstung gefordert. Allein 2021 genehmigte die Bundesregierung Rüstungsexporte im Volumen von 9,35 Milliarden Euro bei Einzelausfuhren – ein neuer Negativrekord.
In Ihrer Rede sagten Sie, Russlands Völkerrechtsbruch dürfe nicht Türöffner für Rüstungsexporte in Krisen- und Kriegsgebiete sein. Können Sie das konkretisieren?
In der Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel wurden bis zuletzt milliardenschwere Rüstungsexportgenehmigungen in Länder erteilt, die bis heute das Völkerrecht missachten und Menschenrechte schwer verletzen. So brachen und brechen Ägypten, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate das Waffenembargo gegen Libyen. Die VAE und Saudi-Arabien verstießen und verstoßen gegen das humanitäre Völkerrecht im Jemen, wo sie Krieg gegen die Huthi-Rebellen führen. Die Türkei verletzt fortwährend die territoriale Integrität Syriens und des Irak durch militärische Interventionen gegen Kurdinnen und Kurden. Dennoch erhalten alle diese Staaten Kriegswaffen oder deren Bestandteile aus Deutschland. Keinesfalls dürfen die Waffenexporte an die Ukraine als Türöffner für neuerliche Waffentransfers in Krisen- und Kriegsgebiete genutzt werden. Rüstungsexporte in diese Staaten müssen per Gesetz rechtsverbindlich und einklagbar verboten werden. Unsere zentrale Forderung: Die Bundesregierung muss ein neues Rüstungsexportkontrollgesetz schaffen. Wir brauchen klare Exportverbote und ein Verbandsklagerecht.
Quelle: junge Welt 02.03.2022 ( Bild Patrick Seeger/dpa
Ein Bundeswehr-Soldat mit einer Stinger-Rakete visiert bei einer Luftwaffenübung ein Flugzeug an (2010)
Jürgen Grässlin ist Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) und Vorsitzender des Rüstungsinformationsbüros

Info vom UN-Menschenrechtsrat
Russland lehnt US-Stationierung von Atomwaffen in Europa ab
Lawrows Äußerungen bestätigen Russlands Position zu den seit Jahrzehnten geforderten Sicherheitsgarantien.
Der russische Außenminister Sergej Lawrow wies am Dienstag die Verbreitung von US-Atomwaffen in Europa per Videokonferenz zurück und forderte die zuständigen Behörden auf, sie unverzüglich zurückzuziehen.
Der russische Außenminister sagte am Rande einer Konferenz über nukleare Abrüstung: "Ich kann Ihnen versichern, dass Russland als verantwortungsbewusstes Mitglied der internationalen Gemeinschaft und seinen Verpflichtungen in Bezug auf die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen verpflichtet ist, alle notwendigen Maßnahmen ergreift, um das Aufkommen von Atomwaffen und verwandten Technologien in der Ukraine zu verhindern."
Im Gegenzug warnte er vor den Möglichkeiten, dass Kiew auf seinen nicht-nuklearen Status verzichtet, was die Sicherheitsgarantien sowohl regional als auch global untergräbt.
Lawrow forderte den Westen auf, den Waffenfluss zu verringern, um gewalttätigere Ereignisse zu vermeiden. In Übereinstimmung damit versicherte der Diplomat, dass Moskau "keine landgestützten Raketen" mittlerer und kurzer Reichweite habe oder habe, wie sie von der Nordatlantikpakt-Organisation (NATO) in der Ukraine geplant seien.
Gleichzeitig machte der Außenminister die USA, die NATO und die Europäische Union für die Krise in der Ukraine verantwortlich, indem er die von Russland seit Jahrzehnten geforderten Sicherheitsgarantien verletzte.
In diesem Zusammenhang stellte er fest, dass die aktuelle Situation das "Ergebnis der Absprache der westlichen Sponsoren des kriminellen Regimes" ist.
Der russische Beamte erinnerte an seine Forderungen, die in den jüngsten Gesprächen enthalten waren. Dazu gehören die Aufrechterhaltung der NATO-Grenzen in Osteuropa, die Rückkehr zu ihren militärischen Fähigkeiten von 1997 und die Nichtnutzung militärischer Einrichtungen in den Nachbarländern Russlands.
Andererseits sagte der russische Außenminister am Dienstag vor dem UN-Menschenrechtsrat, das Ziel der von Moskau gestarteten Spezialoperation sei es, "die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren".
Er sagte, die russische Operation "ist besonders relevant, jetzt, da die Ukraine in die NATO hineingezogen wird und Waffen erhält".
Die an der Krise in der Ukraine beteiligten Parteien scheinen sich in fast jedem Punkt der Verhandlungen anzunähern. Der Westen missachtet die russischen Sicherheitsgarantien und schürt den Konflikt durch ein Wettrüsten, das dem kriegstreiberischen militärisch-industriellen Komplex nur passen könnte.
Quelle:teleSUR 01.03.2022
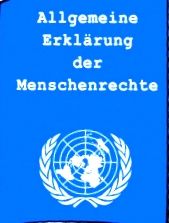
Info über Sierra Leone
DEMOKRATISCHE VOLKSLIGA
PDL
# 1 Zara Lane, Portee, Wellington, Freetown. Sierra Leone, Westafrika
salpedel1986@gmail.com; sierraleonepdl@gmail.com; freedomsal@yahoo.fr
"Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit bestimmten unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, darunter Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. — daß zur Sicherung dieser Rechte Regierungen unter den Menschen eingesetzt werden, die ihre gerechte Macht aus der Zustimmung der Regierten ableiten; — daß, wann immer irgendeine Regierungsform diese Ziele zerstört, es das Recht des Volkes ist, sie zu ändern oder abzuschaffen und eine neue Regierung einzusetzen, die ihre Grundlage auf solchen Grundsätzen legt und ihre Befugnisse in einer solchen Form organisiert, wie für sie am ehesten ihre Sicherheit und ihr Glück zu beeinflussen scheinen". IM KONGRESS, 4. JULI 1776
Die einstimmige Erklärung der dreizehn Vereinigten Staaten von Amerika
Öffentliche Pressemitteilung vom 23. Februar 2022
PDL STREBT DEMOKRATISCHE GERECHTIGKEIT FÜR EIN BESSERES UND WOHLHABENDERES SIERRA LEONE AN
Das Gesetz zur Registrierung politischer Parteien wurde 2002 als wichtiger Bestandteil des Pakets politischer und Wahlreformen verkündet, das von der Wahrheits- und Versöhnungskommission Sierra Leones (TRC) und dem Lome-Friedensabkommen von 1999 empfohlen wurde, das dazu beitrug, den erbitterten Bürgerkrieg im Land zu beenden. Die Verfasser dieses Gesetzes sahen ein System vor, das unsere Mehrparteiendemokratie stärkt, um eine echte politische Entwicklung zu entwickeln und jene heiklen Themen anzugehen, einschließlich Ausgrenzung, Diktatur, Menschenrechtsverletzungen usw., die die Hauptursachen für das Chaos sind, in dem sich Sierra Leone heute befindet .
PDL ist der Ansicht, dass das Gesetz zur Registrierung politischer Parteien die verfassungsmäßigen Rechte und demokratischen Freiheiten der Sierra Leoner durchsetzen sollte; und die Aktivitäten der politischen Parteien gerecht und ohne Diskriminierung jeglicher Art zu regeln; Förderung der Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Parteienfinanzierung; und ein Ende der Politik der Wahlgewalt, des Tribalismus und der regionalen Hegemonie zu sehen.
Trotz bestehender gesetzlicher Bestimmungen, die darauf abzielen, gleiche Wettbewerbsbedingungen für diejenigen zu schaffen, die für ein Amt kandidieren wollen, gehen politische Parteien und Kandidaten immer noch eklatant über diese Einschränkungen hinaus, basierend auf der Überzeugung, dass Geld allein jedes politische Amt kaufen kann. So wie es den Menschen in Sierra Leone ermöglicht wird, politische Parteien ihrer Wahl zu gründen und zu registrieren, sind transparente und wirksame Mechanismen notwendige Instrumente, die in einer Demokratie benötigt werden, um die Wettbewerbsbedingungen zwischen Kandidaten und politischen Parteien bei Wahlen zu verbessern. Die PDL ist der Ansicht, dass das Gesetz zur Registrierung politischer Parteien auch die Wahlkampfspenden einerseits und die Wahlkampfausgaben andererseits streng regeln sollte.
Die PDL glaubt, dass eine Wahl den Menschen das Recht gibt, ihren Willen auszudrücken und ihre Macht zu delegieren, ihre Führer unter gleichen Wettbewerbsbedingungen zu wählen. Die Menschen sollten frei sein, vertrauenswürdige Führer zu wählen, die in der Lage und willens sind, durch eine Politik zu regieren, die den Willen der Bürger widerspiegelt. Daher sollte die Auswahl von Führungskräften auf einem Prozess basieren, der frei von Einschüchterung oder Einfluss jeglicher Art ist.
Die PDL befürwortet Reformen der sierra-leonischen Wahlgesetze, um es sowohl den Kandidaten als auch den Wählern zu ermöglichen, Wahlen als eine demokratische Übung zu betrachten und nicht als eine Form des Kampfes um ethnische Überlegenheit oder einen Weg, um Reichtum anzuhäufen.
Im Zeitalter des Informationszeitalters verlässt sich ein Teil der pro-oppositionellen Gruppen junger Menschen auf die sozialen Medien, darunter Facebook, Whatts-app, LinkedIn, Twitter, um die sierra-leonische Politik der internationalen Gemeinschaft näher zu bringen. Diese Gruppe junger Sierra Leoner, die sich im demokratischen Prozess entfremdet fühlen, sehen das Internet jetzt als lebendiges Forum, um Bindungen zu knüpfen.
Die Position der PDL ist sehr klar; wir sind in keiner Weise bereit, das Gewissen der sierra-leonischen Nation zu verraten. Es liegt in unserem Mark, nicht schlecht über die andere Opposition oder die Regierungspartei zu sprechen. Wir glauben, dass wir mit der anderen Opposition auf der gleichen Seite des Zauns stehen; aber wir müssen ihre Linie nicht abschleppen. Mitglieder und Unterstützer der PDL behalten sich das Recht vor, das Branding zwischen guter und schlechter Führung zu unterscheiden. Wir wollen für die Nachwelt auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, um uns nicht in die falsche Ecke zu stellen.
Nachdem die People's Democratic League dies bereits gesagt hat, bekräftigt sie, dass die PPRC uns jetzt an den Rand gedrängt hat. Von bestimmten Arbeitern der PPRC in Freetown wurden viele ungerechte Angriffe auf PDL-Mitglieder und Unterstützer verübt. Wir wollen, dass die zivilisierte internationale Gemeinschaft sich dagegen ausspricht, die legitimen Rechte, demokratischen Freiheiten, integrität und Würde unserer Mitglieder und Unterstützer anzugreifen, deren einziges Verbrechen unsere Entschlossenheit ist, eine politische Partei zum Wohle aller Sierra Leoner zu registrieren, zur Festigung von Frieden, Demokratie und demokratischer verantwortungsvoller Staatsführung beizutragen und Sierra Leone vor weiterer Zerstörung und Verwüstung durch die Hände der Sierra Leoner zu bewahren. Politiker, die sich nur um sich selbst, ihre Familien, Freunde und Kumpane kümmern.
Aus diesem Grund begrüßten wir den anhaltenden Besuch von US-Gesetzgebern in Afrika als rechtzeitig und im Interesse der Förderung von Frieden, Stabilität, Menschenrechten, guter Regierungsführung, Entwicklung und Wohlstand in der Region. Keine Kultur der Welt genießt den Luxus, Hass, Einschüchterung oder Ungerechtigkeit gegen eine ausgewählte Gruppe von Menschen auszuteilen. Und diejenigen, die die Lizenz für ihr Fehlverhalten beanspruchen, indem sie die PDL bei den Parlamentswahlen 2018 böswillig ausschließen und sich hinter einer geschätzten Institution wie der PPRC verstecken, schaden dem Frieden und der Demokratie in Sierra Leone mehr als sie nützen.
Sierra Leone ist der einzige Ort auf der Erde, den wir unser Zuhause nennen können. Der Geist der Mehrparteienverfassung von 1991 ist gefährdet, als diejenigen, die zur Verwaltung öffentlicher Institutionen ernannt wurden, ihren Charakter verloren. Diese gesichtslosen Bürokraten haben hartnäckig ihre Köpfe in den Sand gesteckt und weigern sich, den Schaden zu sehen, den sie unserem hart erkämpften Frieden und unserer Demokratie zufügen.
Die Verzögerung bei der Ausstellung der endgültigen Registrierungsbescheinigung der PDL für politische Parteien ist ein bewusster Plan, um unsere Mitglieder und Unterstützer in ganz Sierra Leone zu entmündigen. Dies hat uns trotz aller Frustrationen die Kraft und Entschlossenheit gegeben, weiterhin unser verfassungsmäßiges Recht und unsere demokratische Freiheit zu fordern, unsere Partei zu registrieren und uneingeschränkt an den Parlamentswahlen 2023 teilzunehmen. Wir wollen den Menschen in Sierra Leone, afrikanisch und der internationalen Gemeinschaft versichern, dass die PDL nicht frustriert oder eingeschüchtert wird und sich nicht an jedem Versuch beteiligen wird, die Würde und den Anstand des Tempels unserer Demokratie zu beschädigen.
Sierra Leone muss aufsteigen, damit die Demokratie gedeihen kann. Die PDL will sich für Frieden, Demokratie und demokratische gute Regierungsführung einsetzen. Wir werden stattdessen weiterhin friedlich, demokratisch und rechtmäßig den Kurs unserer Registrierung für eine vollwertige politische Partei verfolgen.
Sierra Leone für dich, Sierra Leone für mich!
Absender:
(Häuptling) nAlimamy Bakarr Sankoh
Gründungsmitglied, Leiter und Nationaler Vorsitzender
Die People's Democratic League
Telefon: +232-88-533470
Quelle : Bild- GeFiS-Archiv, 23.02.2022

Schutz der Menschenrechte
Aus: Ausgabe vom 12.02.2022, Seite 8 / Inland
KINDERRECHTE
»Die Armee ist kein Ort für junge Menschen«
2021 rekrutierte die Bundeswehr mehr als 1.200 Minderjährige. Protest am Sonnabend. Ein Gespräch mit Michael Schulze von Glaßer
Interview: Gitta Düperthal
Rainer Unkel/imago images
Kein Job wie jeder andere: Bundeswehr-Soldaten bei einer Übung (2018)
Michael Schulze von Glaßer ist politischer Geschäftsführer der »Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen und -gegner«. Die DFG-VK ist Mitbegründerin der Kampagne »Unter 18 nie – Keine Minderjährigen in der Bundeswehr«
Kundgebung: Sonnabend, 11 Uhr vor dem NRW-Landtag in Düsseldorf
Für diesen Sonnabend, den Internationalen Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten, hat das Bündnis »Unter 18 nie! Keine Minderjährigen in der Bundeswehr« Aktionen angekündigt. 2021 traten 1.239 Jugendliche ihren Dienst in der deutschen Armee an, anteilig 7,4 Prozent aller Rekrutierten. Ist das vergleichsweise viel oder wenig?
Im vergangenen Jahrzehnt, also von der Aussetzung der Wehrpflicht bis heute, wurden bei der Bundeswehr mehr als 15.000 Minderjährige ausgebildet. In den Jahren 2010 und 2011 waren es jeweils etwa 600 junge Menschen unter 18 Jahren, in manchen Jahren danach stieg die Anzahl auf mehr als 2.000. Wegen Corona brachen die Rekrutenzahlen bei der Bundeswehr insgesamt ein, somit glücklicherweise auch die Zahl der Minderjährigen.
Ihre Kritik teilen nicht alle. Argumentiert wird etwa, man rekrutiere junge Menschen ab 16 Jahren doch nur freiwillig, mit Zustimmung der Eltern und unter der Bedingung, dass sie nicht in kriegerischen Konflikten oder im bewaffneten Wachdienst eingesetzt werden. Das überzeugt Sie nicht?
Nein. Studien weisen darauf hin, dass gerade Kinder und Jugendliche ein hohes Risiko haben, traumatisiert zu werden. Sie dürfen nicht an Waffen ausgebildet werden, um auf Menschen zu schießen. Der UN-Ausschuss für Kinderrechte und die Kinderkommission des Bundestages fordern die deutsche Regierung seit Jahren auf, das Mindestalter für die Rekrutierung zu erhöhen.
Sie führen die lange Skandalliste des »Arbeitgebers Bundeswehr« an. Was meinen Sie damit?
Je jünger Menschen sind, wenn sie in die straff hierarchisch strukturierte Bundeswehr eintreten, desto eher laufen sie Gefahr, Opfer sexueller Übergriffe oder von Rechtsextremisten vereinnahmt zu werden. Schon ältere Rekruten haben Probleme damit, Nein zu sagen, wenn es um Rituale oder Mutproben geht und sie befürchten müssen, als »Kameradenschwein«, »Verräter« oder »Lusche« ausgegrenzt zu werden. Jugendlichen fällt das erst recht schwer. Es gibt sogar bei Ausbilderinnen und Ausbildern der Bundeswehr Widerstände, Minderjährige an der Waffe auszubilden. Die Armee ist kein Ort für junge Menschen.
Was hat es mit dem sogenannten Red Hand Day an diesem Sonnabend auf sich?
Erstmals wurden am 12. Februar 2002 rot angemalte Hände auf Schildern und Plakaten als Zeichen gegen den Einsatz von Kindersoldaten eingesetzt, als das Zusatzprotokoll zur UN-Kinderrechtskonvention in Kraft trat. Seither beteiligen sich an solchen Aktionen weltweit Hunderttausende, darunter viele Kinder und Jugendliche. Schätzungsweise 250.000 Kinder müssen als Soldaten Menschen verletzen oder töten, die meisten in Kriegen in afrikanischen oder asiatischen Ländern. Deutschland ist der viertgrößte Waffenexporteur der Welt – viele der Betroffenen werden mit deutschen Waffen in den Kampf geschickt. Damit das endlich aufhört, müssen also auch die hiesigen Exporte gestoppt werden.
In Düsseldorf rufen die DFG-VK NRW sowie die Landes- und Bezirksvertretungen der Schülerinnen und Schüler zur Kundgebung vor dem Landtag auf. Das Schulministerium dort hat eine Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr. Wir meinen: Wehrdienstberater, die sich neuerlich »Karriereberater« nennen, haben bei Jobbörsen an Schulen nichts zu suchen. Kindern und Jugendlichen dürfen keine Werbematerialien der Bundeswehr zugeschickt werden.
Was erwarten Sie von der Ampelregierung?
Zunächst muss die Regierung ihre Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag erfüllen. Darin heißt es: »Ausbildung und Dienst an der Waffe bleiben volljährigen Soldatinnen und Soldaten vorbehalten.« Minderjährige haben aber aus unserer Sicht überhaupt nichts im Militärdienst zu suchen, auch nicht im Taktiktraining, in der strategischen Planung oder ähnlichem. Die Bundeswehr muss raus aus den Schulen. Wir erwarten, dass dort die Antikriegsbewegung mit Friedensbildung wirkt.
Quelle: junge Welt 12.02.2022

Info über Palästina
Israels Apartheid gegen die Palästinenser: ein grausames Herrschaftssystem und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit
Die israelischen Behörden müssen für die Begehung des Verbrechens der Apartheid gegen die Palästinenser zur Rechenschaft gezogen werden, sagte Amnesty International heute in einem vernichtenden neuen Bericht. Die Untersuchung beschreibt, wie Israel ein System der Unterdrückung und Herrschaft gegen das palästinensische Volk durchsetzt, wo immer es die Kontrolle über seine Rechte hat. Dazu gehören Palästinenser, die in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten (OPT) leben, sowie vertriebene Flüchtlinge in anderen Ländern.
Der umfassende Bericht", Israel's Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity, legt dar, wie massive Beschlagnahmungen palästinensischen Landes und Eigentums, rechtswidrige Tötungen, gewaltsame Transfers, drastische Bewegungsbeschränkungen und die Verweigerung der Staatsangehörigkeit und Staatsbürgerschaft für Palästinenser Komponenten eines Systems sind, das nach internationalem Recht Apartheid gleichkommt. Dieses System wird durch Verstöße aufrechterhalten, die Amnesty International als Apartheid als Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne des Römischen Statuts und der Apartheidkonvention feststellte.
Amnesty International fordert den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) auf, das Verbrechen der Apartheid in seiner aktuellen Untersuchung im OPT zu berücksichtigen, und fordert alle Staaten auf, universelle Gerichtsbarkeit auszuüben, um Die Täter von Apartheidverbrechen vor Gericht zu bringen.
Unser Bericht enthüllt das wahre Ausmaß des israelischen Apartheidregimes. Ob sie in Gaza, Ostjerusalem und dem Rest des Westjordanlandes oder in Israel selbst leben, die Palästinenser werden als minderwertige rassische Gruppe behandelt und systematisch ihrer Rechte beraubt. Wir fanden heraus, dass Israels grausame Politik der Segregation, Enteignung und Ausgrenzung in allen Gebieten unter seiner Kontrolle eindeutig auf Apartheid hinausläuft. Die internationale Gemeinschaft ist verpflichtet zu handeln
Agnès Callamard, Generalsekretärin von Amnesty International
"Es gibt keine mögliche Rechtfertigung für ein System, das auf der institutionalisierten und anhaltenden rassistischen Unterdrückung von Millionen von Menschen aufgebaut ist. Apartheid hat keinen Platz in unserer Welt, und Staaten, die sich dafür entscheiden, Israel zu berücksichtigen, werden sich auf der falschen Seite der Geschichte wiederfinden. Regierungen, die Israel weiterhin mit Waffen versorgen und es vor der Rechenschaftspflicht vor den Vereinten Nationen schützen, unterstützen ein System der Apartheid, untergraben die internationale Rechtsordnung und verschärfen das Leiden des palästinensischen Volkes. Die internationale Gemeinschaft muss sich der Realität der israelischen Apartheid stellen und die vielen Wege zur Gerechtigkeit verfolgen, die beschämend unerforscht bleiben."
Die Ergebnisse von Amnesty International bauen auf einer wachsenden Zahl von Arbeiten palästinensischer, israelischer und internationaler NGOs auf, die den Apartheid-Rahmen zunehmend auf die Situation in Israel und/oder die OPT angewendet haben.
Apartheid identifizieren
Ein System der Apartheid ist ein institutionalisiertes Regime der Unterdrückung und Herrschaft einer rassischen Gruppe über eine andere. Es handelt sich um eine schwere Menschenrechtsverletzung, die im Völkerrecht verboten ist. Die umfangreichen Recherchen und rechtlichen Analysen von Amnesty International, die in Absprache mit externen Experten durchgeführt wurden, zeigen, dass Israel ein solches System gegen die Palästinenser durch Gesetze, Richtlinien und Praktiken durchsetzt, die ihre anhaltende und grausame diskriminierende Behandlung gewährleisten.
Im internationalen Strafrecht stellen spezifische rechtswidrige Handlungen, die innerhalb eines Systems der Unterdrückung und Herrschaft begangen werden, mit der Absicht, es aufrechtzuerhalten, das Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Apartheid dar. Diese Handlungen sind in der Apartheidkonvention und im Römischen Statut festgelegt und umfassen rechtswidriges Töten, Folter, Zwangsumsiedlung und die Verweigerung grundlegender Rechte und Freiheiten.
Amnesty International dokumentierte Handlungen, die in der Apartheidkonvention und im Römischen Statut in allen von Israel kontrollierten Gebieten verboten sind, obwohl sie in der OPT häufiger und gewaltsamer vorkommen als in Israel. Die israelischen Behörden ergreifen mehrere Maßnahmen, um den Palästinensern absichtlich ihre Grundrechte und -freiheiten zu verweigern, darunter drakonische Bewegungsbeschränkungen in der OPT, chronisch diskriminierende Unterinvestitionen in palästinensische Gemeinden in Israel und die Verweigerung des Rechts der Flüchtlinge auf Rückkehr. Der Bericht dokumentiert auch Zwangsüberstellungen, Verwaltungshaft, Folter und rechtswidrige Tötungen, sowohl in Israel als auch in der OPT.
Amnesty International stellte fest, dass diese Taten Teil eines systematischen und weit verbreiteten Angriffs auf die palästinensische Bevölkerung sind und mit der Absicht begangen werden, das System der Unterdrückung und Herrschaft aufrechtzuerhalten. Sie stellen daher das Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Apartheid dar.
Die rechtswidrige Tötung palästinensischer Demonstranten ist vielleicht das deutlichste Beispiel dafür, wie die israelischen Behörden verbotene Handlungen anwenden, um den Status quo aufrechtzuerhalten. Im Jahr 2018 begannen Palästinenser in Gaza, wöchentliche Proteste entlang der Grenze zu Israel abzuhalten, um das Rückkehrrecht für Flüchtlinge und ein Ende der Blockade zu fordern. Bevor die Proteste überhaupt begannen, warnten hochrangige israelische Beamte, dass Palästinenser, die sich der Mauer näherten, erschossen würden. Bis Ende 2019 hatten israelische Streitkräfte 214 Zivilisten getötet, darunter 46 Kinder.
Angesichts der systematischen rechtswidrigen Tötungen von Palästinensern, die in ihrem Bericht dokumentiert sind, fordert Amnesty International auch den UN-Sicherheitsrat auf, ein umfassendes Waffenembargo gegen Israel zu verhängen. Dies sollte alle Waffen und Munition sowie Strafverfolgungsausrüstung umfassen, angesichts der Tausenden von palästinensischen Zivilisten, die von israelischen Streitkräften unrechtmäßig getötet wurden. Der Sicherheitsrat sollte auch gezielte Sanktionen wie das Einfrieren von Vermögenswerten gegen israelische Beamte verhängen, die am stärksten in das Verbrechen der Apartheid verwickelt sind.
Palästinenser als demografische Bedrohung behandelt
Seit seiner Gründung im Jahr 1948 verfolgt Israel eine Politik der Errichtung und Aufrechterhaltung einer jüdischen demografischen Mehrheit und der Maximierung der Kontrolle über Land und Ressourcen zum Nutzen jüdischer Israelis. 1967 dehnte Israel diese Politik auf das Westjordanland und den Gazastreifen aus. Heute werden alle von Israel kontrollierten Gebiete weiterhin mit dem Ziel verwaltet, jüdischen Israelis zum Nachteil der Palästinenser zu nützen, während palästinensische Flüchtlinge weiterhin ausgeschlossen werden.
Amnesty International erkennt an, dass Juden, wie Palästinenser, ein Recht auf Selbstbestimmung beanspruchen, und stellt Israels Wunsch, ein Zuhause für Juden zu sein, nicht in Frage. Ebenso ist sie nicht der Ansicht, dass Israel, das sich selbst als "jüdischen Staat" bezeichnet, auf die Absicht hinweist, zu unterdrücken und zu dominieren.
However, Amnesty International’s report shows that successive Israeli governments have considered Palestinians a demographic threat, and imposed measures to control and decrease their presence and access to land in Israel and the OPT. These demographic aims are well illustrated by official plans to “Judaize” areas of Israel and the West Bank, including East Jerusalem, which continue to put thousands of Palestinians at risk of forcible transfer.
Oppression without borders
The 1947-49 and 1967 wars, Israel’s ongoing military rule of the OPT, and the creation of separate legal and administrative regimes within the territory, have separated Palestinian communities and segregated them from Jewish Israelis. Palestinians have been fragmented geographically and politically, and experience different levels of discrimination depending on their status and where they live.
Palestinian citizens in Israel currently enjoy greater rights and freedoms than their counterparts in the OPT, while the experience of Palestinians in Gaza is very different to that of those living in the West Bank. Nonetheless, Amnesty International’s research shows that all Palestinians are subject to the same overarching system. Israel’s treatment of Palestinians across all areas is pursuant to the same objective: to privilege Jewish Israelis in distribution of land and resources, and to minimize the Palestinian presence and access to land.
Amnesty International demonstrates that Israeli authorities treat Palestinians as an inferior racial group who are defined by their non-Jewish, Arab status. This racial discrimination is cemented in laws which affect Palestinians across Israel and the OPT.
For example, Palestinian citizens of Israel are denied a nationality, establishing a legal differentiation from Jewish Israelis. In the West Bank and Gaza, where Israel has controlled the population registry since 1967, Palestinians have no citizenship and most are considered stateless, requiring ID cards from the Israeli military to live and work in the territories.
Palestinian refugees and their descendants, who were displaced in the 1947-49 and 1967 conflicts, continue to be denied the right to return to their former places of residence. Israel’s exclusion of refugees is a flagrant violation of international law which has left millions in a perpetual limbo of forced displacement.
Palestinians in annexed East Jerusalem are granted permanent residence instead of citizenship – though this status is permanent in name only. Since 1967, more than 14,000 Palestinians have had their residency revoked at the discretion of the Ministry of the Interior, resulting in their forcible transfer outside the city.
Lesser citizens
Palästinensische Bürger Israels, die etwa 19% der Bevölkerung ausmachen, sind mit vielen Formen institutionalisierter Diskriminierung konfrontiert. Im Jahr 2018 kristallisierte sich die Diskriminierung der Palästinenser in einem Verfassungsgesetz heraus, das Israel erstmals ausschließlich als "Nationalstaat des jüdischen Volkes" verankerte. Das Gesetz fördert auch den Bau jüdischer Siedlungen und stuft den Status des Arabischen als Amtssprache herab.
Der Bericht dokumentiert, wie Palästinenser effektiv daran gehindert werden, 80% des israelischen Staatslandes zu verpachten, als Folge rassistischer Landbeschlagnahmungen und eines Netzes diskriminierender Gesetze über Landzuweisung, Planung und Zoneneinteilung.
Die Situation in der Region Negev/Naqab im Süden Israels ist ein Paradebeispiel dafür, wie Israels Planungs- und Baupolitik absichtlich Palästinenser ausschließt. Seit 1948 haben die israelischen Behörden verschiedene Richtlinien zur "Judaisierung" des Negev/Naqab verabschiedet, einschließlich der Ausweisung großer Gebiete als Naturschutzgebiete oder militärische Schießzonen und der Festlegung von Zielen für die Erhöhung der jüdischen Bevölkerung. Dies hatte verheerende Folgen für die Zehntausenden palästinensischen Beduinen, die in der Region leben.
Fünfunddreißig Beduinendörfer, in denen etwa 68.000 Menschen leben, sind derzeit von Israel "nicht anerkannt", was bedeutet, dass sie von der nationalen Strom- und Wasserversorgung abgeschnitten und Ziel wiederholter Zerstörungen sind. Da die Dörfer keinen offiziellen Status haben, sind ihre Bewohner auch mit Einschränkungen der politischen Partizipation konfrontiert und vom Gesundheits- und Bildungssystem ausgeschlossen. Diese Bedingungen haben viele gezwungen, ihre Häuser und Dörfer zu verlassen, was einem gewaltsamen Transfer gleichkommt.
Jahrzehnte der absichtlichen Ungleichbehandlung palästinensischer Bürger Israels haben sie im Vergleich zu jüdischen Israelis konsequent wirtschaftlich benachteiligt. Verschärft wird dies durch die eklatant diskriminierende Zuweisung staatlicher Mittel: Ein aktuelles Beispiel ist das Covid-19-Konjunkturpaket der Regierung, von dem nur 1,7% an palästinensische Lokalbehörden gingen.
Enteignung
Die Enteignung und Vertreibung der Palästinenser aus ihren Häusern ist eine entscheidende Säule des israelischen Apartheidsystems. Seit seiner Gründung hat der israelische Staat massive und grausame Landnahmen gegen Palästinenser durchgesetzt und setzt weiterhin unzählige Gesetze und Richtlinien um, um Palästinenser in kleine Enklaven zu zwingen. Seit 1948 hat Israel Hunderttausende von palästinensischen Häusern und anderen Besitztümern in allen Gebieten unter seiner Gerichtsbarkeit und effektiven Kontrolle zerstört.
Wie im Negev/Naqab leben die Palästinenser in Ostjerusalem und im Gebiet C der OPT unter voller israelischer Kontrolle. Die Behörden verweigern den Palästinensern Baugenehmigungen in diesen Gebieten und zwingen sie, illegale Strukturen zu bauen, die immer wieder abgerissen werden.
In der OPT verschärft der fortgesetzte Ausbau illegaler israelischer Siedlungen die Situation. Der Bau dieser Siedlungen in der OPT ist seit 1967 eine Regierungspolitik. Die Siedlungen bedecken heute 10% des Landes im Westjordanland, und etwa 38% des palästinensischen Landes in Ostjerusalem wurden zwischen 1967 und 2017 enteignet.
Palästinensische Viertel in Ostjerusalem werden häufig von Siedlerorganisationen ins Visier genommen, die mit voller Unterstützung der israelischen Regierung daran arbeiten, palästinensische Familien zu vertreiben und ihre Häuser an Siedler zu übergeben. Ein solches Viertel, Sheikh Jarrah, ist seit Mai 2021 Schauplatz häufiger Proteste, da Familien darum kämpfen, ihre Häuser unter der Bedrohung einer Siedlerklage zu behalten.
Drakonische Bewegungseinschränkungen
Seit Mitte der 1990er Jahre haben die israelischen Behörden den Palästinensern in der OPT immer strengere Bewegungsbeschränkungen auferlegt. Ein Netz von militärischen Kontrollpunkten, Straßensperren, Zäunen und anderen Strukturen kontrolliert die Bewegung der Palästinenser innerhalb der OPT und schränkt ihre Reisen nach Israel oder ins Ausland ein.
Ein 700 km langer Zaun, den Israel immer noch ausdehnt, hat palästinensische Gemeinden in "Militärzonen" isoliert, und sie müssen jedes Mal, wenn sie ihre Häuser betreten oder verlassen, mehrere Sondergenehmigungen einholen. In Gaza leben mehr als 2 Millionen Palästinenser unter einer israelischen Blockade, die eine humanitäre Krise ausgelöst hat. Es ist für Gazaner nahezu unmöglich, ins Ausland oder in den Rest der OPT zu reisen, und sie sind effektiv vom Rest der Welt getrennt.
Für die Palästinenser ist die Schwierigkeit, innerhalb und innerhalb und innerhalb und aus dem OPT zu reisen, eine ständige Erinnerung an ihre Machtlosigkeit. Jeder ihrer Schritte unterliegt der Zustimmung des israelischen Militärs, und die einfachste tägliche Aufgabe besteht darin, sich in einem Netz gewaltsamer Kontrolle zurechtzufinden.
Agnès Callamard
"Das Genehmigungssystem in der OPT ist symbolisch für Israels dreiste Diskriminierung der Palästinenser. Während die Palästinenser in einer Blockade eingesperrt sind, stundenlang an Checkpoints festsitzen oder auf eine weitere Genehmigung warten, können sich israelische Bürger und Siedler nach Belieben bewegen."
Amnesty International untersuchte jede der Sicherheitsbegründungen, die Israel als Grundlage für seine Behandlung der Palästinenser anführt. Der Bericht zeigt, dass einige der israelischen Politiken zwar darauf ausgerichtet waren, legitime Sicherheitsziele zu erreichen, aber in einer grob unverhältnismäßigen und diskriminierenden Weise umgesetzt wurden, die nicht dem Völkerrecht entspricht. Andere Politiken haben absolut keine vernünftige Grundlage in der Sicherheit und sind eindeutig von der Absicht geprägt, zu unterdrücken und zu dominieren.
Der Weg in die Zukunft
Amnesty International gibt zahlreiche konkrete Empfehlungen, wie die israelischen Behörden das Apartheidsystem und die Diskriminierung, Segregation und Unterdrückung, die es aufrechterhalten, abbauen können.
Die Organisation fordert als ersten Schritt ein Ende der brutalen Praxis der Hauszerstörung und Zwangsräumung. Israel muss allen Palästinensern in Israel und der OPT die gleichen Rechte gewähren, im Einklang mit den Prinzipien der internationalen Menschenrechte und des humanitären Rechts. Sie muss das Recht der palästinensischen Flüchtlinge und ihrer Nachkommen anerkennen, in die Häuser zurückzukehren, in denen sie oder ihre Familien einst lebten, und den Opfern von Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit volle Wiedergutmachung gewähren.
Das Ausmaß und die Schwere der im Bericht von Amnesty International dokumentierten Verstöße erfordern eine drastische Änderung der Herangehensweise der internationalen Gemeinschaft an die Menschenrechtskrise in Israel und der OPT.
Alle Staaten können die universelle Gerichtsbarkeit über Personen ausüben, die vernünftigerweise verdächtigt werden, das Verbrechen der Apartheid nach internationalem Recht zu begehen, und Staaten, die Vertragsparteien der Apartheidkonvention sind, sind dazu verpflichtet.
Die internationale Antwort auf die Apartheid darf sich nicht länger auf fadenscheinige Verurteilungen und Zweideutigkeiten beschränken. Wenn wir nicht die Ursachen bekämpfen, werden Palästinenser und Israelis in dem Kreislauf der Gewalt gefangen bleiben, der so viele Leben zerstört hat.
Agnès Callamard
"Israel muss das Apartheidsystem abbauen und anfangen, die Palästinenser als Menschen mit gleichen Rechten und Gleicher Würde zu behandeln. Solange dies nicht der Fall ist, werden Frieden und Sicherheit für Israelis und Palästinenser gleichermaßen eine ferne Perspektive bleiben."
Bitte beachten Sie den vollständigen Bericht für eine detaillierte Definition der Apartheid im Völkerrecht.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an press@amnesty.org
Quelle: amnesty international v. 01.02.2022
Bild. Internet

02.
Feb.
2022
Info über Indien
Hände weg vom bäuerlichen Land!
40 indische fortschrittliche Organisationen und Einzelpersonen verurteilen die brutale Polizeigewalt gegen die Menschen in Dhinkia Chaaridesh – und fordern ein Ende der Versuche, ihr Land zu beschlagnahmen.
Im Jahr 2017 gingen die Menschen von Dhinkia Chaaridesh siegreich aus einem Kampf hervor, um den südkoreanischen Stahlkonzern POSCO daran zu hindern, ihr Land zu erwerben. Aber jetzt – mit der aktiven Hilfe des Staates – versucht ein anderes Stahlunternehmen erneut, Hunderte hektar fruchtbares Ackerland an sich zu reißen, ökologische Verwüstungen anzurichten und Betelzüchter, Arbeiter und Fischer zu verarmen.
Wir, die Unterzeichner, verurteilen aufs Schärfste die brutale Polizeigewalt der Polizei von Odisha, die am 14. Januar stundenlang gegen die Dorfbewohner von Dhinkia im Bezirk Jagatsinghpur andauerte. Die Dorfbewohner der gesamten Region haben gegen den Landerwerb durch die Bezirksverwaltung für Jindal Steel Work Utkal Limited protestiert.
Am 14. Januar, als sich die Menschen zu einer Kundgebung in der Gegend versammelten, wurden sie von der Polizei gnadenlos angegriffen. Die Abendnachrichten auf regionalen Fernsehsendern zeigten, wie Frauen und Kinder gejagt und geschlagen wurden, Gruppen von Polizisten, die Schläge auf Dorfbewohner regneten, die zu Boden geworfen wurden, Leichen, die von der Polizei zertrampelt wurden, und Menschen, die hektisch rannten und um Hilfe schrien. Die Polizei führte einen Fahnenmarsch durch.
Unzählige Dorfbewohner wurden verletzt. Viele konnten das Gebiet wegen des Terrors und der Gewalt, die von der Polizei von Odisha entfesselt wurden, nicht verlassen, um sich behandeln zu lassen. Der Verbleib einiger von ihnen ist noch nicht bekannt. Immer wieder kommt es zu Telefonaten über vermisste Menschen, die sich vielleicht noch im Wald oder zwischen den Betelreben verstecken.
Sechs Personen wurden verhaftet, darunter Debendra Swain, die Führerin der Volksbewegung; Narendra Mohanty von der Kampagne gegen fabrizierte Fälle (Bhubaneswar), als er die Gegend besuchte; und Muralidhar Sahoo, Nimai Mallick, Manguli Kandi und Trinath Mallick. Die PC-Nummer lautet 21/22 GR-34/22 gemäß den Abschnitten 307, 147, 148, 323, 294, 324, 354, 336, 325, 353, 332, 379, 427, 506, 186, 149 des IPC-, CLA- und PPDP-Gesetzes. Sie wurden gewaltsam zu Polizeifahrzeugen geschleppt, ohne die Angehörigen zu informieren, an einem unbekannten Ort festgehalten und in den frühen Morgenstunden des 15. Januar dem Haftrichter vorgelegt. Dies geschah absichtlich, um zu verhindern, dass sie eine ärztliche Untersuchung verlangen oder jemanden über Misshandlungen während des Polizeigewahrsams informieren.
Die Dorfgassen sind jetzt verlassen, es gibt Polizei in der gesamten Gegend und den umliegenden Dörfern. Sie sind weiterhin in Terror und Einschüchterung in ihren Häusern gefangen. Viele mussten auch ihre Telefone ausschalten. Viele Menschen haben ihre Häuser von außen verschlossen und benutzen die Hintereingänge.
Dhinkia hat Hunderte von Dalit-Familien, die als Lohnarbeiter in den Betel-Rebflächen arbeiten oder fischen. Viele werden von Polizeiexzessen ins Visier genommen. Am 6. Januar wurden sieben Mitglieder einer Dalit-Familie verhaftet. Dazu gehören Shiba Mallick, Sankar Mallick, Kaushalya Parbati Mallick, Kusum Mallick, Sarat Mallick, Sujan Mallick und Jhini Mallick.
Am 15. Januar wurde ein Team von Odisha-SKM und seinen Unterstützern direkt vor Dhinkia von der Trilochanpur-Seite angehalten, als sie das Gebiet betraten, um den Lathi-Anklagevorfall zu untersuchen und den Dorfbewohnern Unterstützung und Solidarität anzubieten. Über 50 bis 60 Männer stoppten das Team auf seinem Weg, schleuderten Menschenrechtsverletzungen und behaupteten, dass Menschenrechtsverteidiger dem Dorf Ärger bereiten. Sie benutzten Drohungen, Einschüchterungen und Schimpfwörter und rochen auch nach Alkoholkonsum. Das Team bestand aus: Mahendra Parida, Prafulla Samantara, Jyoti Ranjan Mahapatro, Pradipta Nayak, Santosh Ratha, Jambeshwar Samanatray, Sujata Sahani und Ranjana Padhi. Drei Teammitglieder meldeten eine Beschwerde bei der Polizeistation Abhaychandpur an.
Während wir diese Erklärung veröffentlichen, hören wir, dass die Polizei an jede Tür klopft und die Menschen auffordert, herauszukommen, um Friedenskomitees zu bilden. Es ist ein direktes Mittel, um die Plünderung und Plünderung von Volksland im Namen von Friedenskomitees zu legitimieren.
Die Komplizenschaft der Landesregierung, Land für JSW mit allen Mitteln zu erwerben, ist klar, da sie weiterhin Appelle eines breiten Teils von Menschen und fortschrittlichen Organisationen ignoriert.
- Die staatliche Menschenrechtskommission wurde über willkürliche und fabrizierte Verhaftungen informiert.
- Mehrere Bürgergruppen und -organisationen appellierten beim Ministerpräsidenten an den Abzug der Polizei, seit sich die Dorfbewohner verbarrikadiert hatten.
- PUCL Odisha hat den Abzug der Polizei und die Wiederherstellung der Normalität gefordert.
- Ein Appell wurde von der Odisha-SKM an den Gouverneur gerichtet.
Tatsächlich macht das Schweigen des Ministerpräsidenten deutlich, wie komplizenhaft die Landesregierung beim Einsatz von Terror, Gewalt und Einschüchterung im Namen von Unternehmen ist. Die Situation in Dhinkia Chaaridesh hat einmal mehr die eiserne Hand der autoritären Macht offenbart, um die Errungenschaften des Volkskampfes zurückzudrängen. Auch Organisationen und Unterstützer der Volksbewegung werden ins Visier genommen. All dies läuft auf eine systematische Verweigerung des absoluten Rechts der Dorfbewohner hinaus, ihr Land, ihren Lebensunterhalt und ihr Leben zu schützen.
Es ist bekannt, wie die Menschen von Dhinkia Chaaridesh von 2005 bis 2017 mehrere Jahre gekämpft haben und als Sieger aus dem südkoreanischen Stahlkonzern POSCO hervorgegangen sind. Aber der Staat usurpiert wieder hunderte Hektar fruchtbaren Ackerlandes und verarmt Betelbauer, Arbeiter und Fischer. Zusätzlich dazu, dass sie das erworbene Land für POSCO in der Land Bank behalten hat, hilft die Regierung JSW mit mehr Land. Das Unternehmen muss noch die Umweltfreigabe erhalten. Last but not least werden ein Stahlwerk, ein eigener Steg und eine Zementfabrik, die das JSW-Projekt mit sich bringt, die fragile Küste von Odisha mit ihrer zunehmenden Häufigkeit von Zyklonen und zurückgehendem Land verwüsten. Die Regierung von Odisha muss sich der Zerstörung bewusst werden, die durch den Abbau von Mineralien und die Stahlproduktion verursacht wird, die ökologische Verwüstungen verursacht.
Wir fordern die Regierung von Odisha auf:
- Ziehen Sie sofort alle Polizeikräfte aus dem Gebiet ab.
- Durchführung einer SIT-Untersuchung unter der Leitung eines Richters des Obersten Gerichtshofs zu den Ereignissen in Dhinkia ab dem 4. Dezember.
- Ziehen Sie alle anhängigen Strafverfahren gegen die Menschen aus der Bewegung gegen POSCO bis jetzt im Fall JSW zurück.
- Freilassung aller, die sich in Untersuchungshaft befinden.
- Entschädigung an Betel-Rebbauern, deren Betel-Reben ohne ihre Zustimmung oder Zustimmung gewaltsam durch Polizeiterror zerstört wurden.
- Übergabe des für das POSCO-Projekt erworbenen Landes an die Menschen.
- Schützen Sie das Land, das Leben und die Lebensgrundlagen der Menschen.
- Aufrechterhaltung der ökologischen Nachhaltigkeit der fragilen Ostküste und Erleichterung der Bemühungen zur Verhinderung der globalen Klimakrise.
Unterzeichner
- Biswapriya Kanungo, Anwalt und Aktivist
- Prafulla Samantara, Lok Shakti Abhiyan
- Debaranjan – Ganatantrik Adhikar Suraksha Sangathan (GASS)
- Pramodini Pradhan, PUCL Odisha
- Shankar Sahu, Ganz Indien Krantikari Kisan Sabha (AIKKS)
- Srikant Mohanty, Chaasi Mulya Sangha
- Mahindra Parida, AICCTU, Bhubaneswar
- Bhalachandra Sadangi, Neue Demokratie
- Sudhir Pattnaik, Journalist und Sozialaktivist
- Ranjana Padhi, feministische Aktivistin und Schriftstellerin
- Sujata Sahani, Dichterin und Aktivistin
- Pramila Behera, AIRWO, Bhubaneswar
- Sabyasachi, TUCI, Odisha
- Thunfisch Mallick, Adivasi Bharat Mahasabha, Odisha
- Hena Barik, Sekretärin, Basti Suraksha Manch, Bhubaneswar
- Nigamananda Sadangi, Schriftsteller und Übersetzer
- Srimant Mohanty, Politischer Aktivist, Bhubaneswar
- Pramod Gupta, Politischer Aktivist, Kolkakta
- V Geetha, feministische Historikerin und Schriftstellerin, Chennai
- PUCL - National
- Komitee zum Schutz demokratischer Rechte (CPDR) -Tamil Nadu
- Saheli Women's Resource Centre, Neu-Delhi
- PUCL, Maharashtra
- Forum gegen Frauenunterdrückung (FAOW), Mumbai
- Swati Azad, Politischer Aktivist, Bhubaneswar
- Nisha Biswas, WSS, Kalkutta
- Sujata Gothoskar, Arbeitsrechtsaktivistin, Mumbai
- Arya, Arbeitsrechtsaktivistin, Neu-Delhi
- Venkatachandrika Radhakrishnan, Thozhilalar Koodam, Chennai
- T. Venkat Narasimhan, Thozhilalar Koodam, Chennai
- Alok Laddha, Lehrer, Chennai
- Santosh Kumar, Arbeitereinheit, Neu-Delhi
- Anuradha Banerjee, Saheli, Neu-Delhi
- Shambhavi, Generalsekretär, Kollektiv
- Feministinnen im Widerstand, Kalkutta
- Worker Peasant Student Unity Forum, Kalkutta
- Refraktion, Kalkutta
- Revolutionäre Studentenfront, Kalkutta
- Inquilabi Students' Unity, Kalkutta
- Lehrer gegen die Klimakrise, Neu-Delhi
Quelle: progressive internationale v. 02.02.2022,
Bild vom Stahlkonzern Südkorea von
Internetplattform Wikipedia




Info über Sierra Leone
DEMOKRATISCHE VOLKSLIGA
PDL
salpedel1986@gmail.com; sierraleonepdl@gmail.com; freedomsal@yahoo.fr
Öffentliches Statement vom 6. Februar 2022
PDL WIRD IHRE VERFASSUNG VERTEIDIGEN
MENSCHENRECHTE UND DEMOKRATISCHE FREIHEITEN
Unsere Aufmerksamkeit wurde auf Gerüchte gelenkt, die im Zentrum von Freetown kursieren und darauf hindeuten, dass die People's Democratic League (PDL) sich entschieden hat, sich erneut für die Registrierung politischer Parteien bei der Political Parties Registration Commission (PPRC) zu bewerben. Die Architekten dieser bösen Tat gingen auch unverfroren davon aus, dass die PDL ihr vorläufiges Zertifikat an die PPRC in Freetown abgegeben hat und nun dabei ist, einen erneuten Antrag auf Registrierung zu stellen. FALSE! Liegen! Trügerisch! Irreführend!
So wie die PDL die Daseinsberechtigung hinter dieser sinnlosen, grundlosen, böswilligen und unbegründeten Anschuldigung nicht versteht, sollte diese Tat als kriminell und als Angriff auf die Demokratie angesehen werden und die Würde von PDL-Mitgliedern und Unterstützern in ganz Sierra Leone ernsthaft beleidigen. In kürzester Zeit, sei es durch Telefongespräche, Social-Media-Chat oder Forum, hat die PDL solche diskutiert. Wir hatten diese Angelegenheit nicht einmal gegenüber unserem gesetzlichen Vertreter kommentiert, außer ihm mitzuteilen, dass wir kein Interesse daran haben, die Registrierung unserer Partei erneut zu beantragen. Wir haben unserem Rechtsvertreter ferner sehr deutlich gemacht, dass wir bei Bedarf beim Obersten Gerichtshof in Freetown Wiedergutmachung suchen werden. Es steht nicht in unserer Agenda, noch daran zu denken, dass dies auch nach dem Tod geschieht. Das ist unsere Position. Es liegt uns im Blut! Es ist in unserem Mark!
Die Wahrheit ist, dass ein Brief an unseren Rechtsvertreter in Freetown geschickt wurde, angeblich von der PPRC, in dem pdL aufgefordert wurde, sich erneut zu bewerben, weil die Organisation inaktiv war. Auch wenn es wahr ist, dass der Brief von der PPRC verfasst wurde, passt die darin enthaltene Sprache nicht in das demokratische Ethos der PDL.
Um die Sache richtig zu stellen, reichte pdL im August 2016 bei der PPRC in Freetown einen Antrag auf Registrierung als vollwertige politische Partei für Sierra Leone ein, und im Juli 2017 erhielt die Organisation eine vorläufige Bescheinigung für die Tätigkeit in den Räumlichkeiten ihrer Büros. Im September 2017 wurde die PDL-Verfassung per Gesetz für sechzig Tage in der Sierra Leone Gazette veröffentlicht . Wenn es innerhalb dieses Zeitraums nach der Veröffentlichung der genannten Gazette keine öffentlichen Einwände gibt, ist pdL qualifiziert, eine vollwertige politische Partei für Sierra Leone zu werden. Dies ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Die sechzig Tage waren vergangen und es gab keinen öffentlichen Einwand in unserer weithin verkauften Verfassung.
Anstatt unser endgültiges Zertifikat nach Ablauf der sechzig Tage im November 2017 auszustellen, entschied sich die PPRC, unsere verfassungsmäßigen Menschenrechte und demokratischen Freiheiten mit Füßen zu treten, und lud stattdessen die PDL-Führung zu einem Treffen im Dezember 2017 in Anwesenheit der derzeit regierenden Sierra Leone People's Party (SLPP) und des oppositionellen All People's Congress (APC) ein. Diese Aktion selbst war ein völliger Verstoß gegen die Mehrparteienverfassung der Republik Sierra Leone von 1991.
Wir haben mehrere Versuche unternommen, den neuen Vorsitzenden der PPRC zu erreichen, aber ohne Erfolg. Wir glauben, dass Sierra Leone eine Demokratie ist und es normal sein sollte, eine Opposition zu bilden, um die entrechteten, ausgeschlossenen und von Armut geplagten Menschen unseres Landes zu vertreten. Darüber hinaus muss die Untätigkeit der Regierungspartei oder die demagogische Politik einer Partei zur Verbesserung in Frage gestellt werden. Es ist die Funktion der politischen Parteien, sich in einer Demokratie gegenseitig herauszufordern, und ein Vergleich ist unvermeidlich, da jeder über die besten Möglichkeiten zur Verbesserung des Landes sprechen möchte. Widerstand, der Verbesserung bringt, ist eine gute Sache für Sierra Leone. Es bedeutet, dass, wenn wir falsch sehen, wir sagen, dass es falsch ist. Wenn wir es richtig sehen, sagen wir, dass es richtig ist. Kein Grund zur Beunruhigung!
Es gibt zahlreiche Beweise für Audios und Videos, die zu dem Schluss führen, dass die böswillige Entscheidung, die PDL bei den Wahlen 2018 auszuschließen, von mächtigen Menschen beeinflusst wurde und daher undemokratisch war und im Widerspruch zu den Bestimmungen der Mehrparteienverfassung der Republik Sierra Leone von 1991 stand. Es gibt einfach kein moralisches Argument, um die brutale Ungerechtigkeit zu rechtfertigen, die beim Registrierungsprozess der PDL für politische Parteien begangen wird.
Wenn man über PDL spricht, ist die erneute Beantragung der Registrierung nichts anderes als eine Erfindung der Phantasie. Die PDL hat genug Kapazitäten, um die unabhängige, demokratische, moralische Alternativpartei zu werden, um die Regierungspartei im Jahr 2023 herauszufordern.
Die PDL glaubt an die Mehrparteienverfassung der Republik Sierra Leone von 1991; wir haben dafür gekämpft und wir werden sie auch um den Preis unseres Lebens verteidigen. Wir werden uns nicht dazu verleiten lassen, eine Partei zu werden, die gegen die Verfassung von Sierra Leone verstößt. Wir sind Sierra Leoner und haben keinen anderen Ort, den wir unser Zuhause nennen können, als Sierra Leone. Und als solche werden wir uns allen Versuchen widersetzen, unsere Rechte zu verpfänden.
Sierra Leone ist meine Heimat!
Sierra Leone ist Ihr Zuhause!!
Sierra Leone ist unsere Heimat!!!
Absender:
(Häuptling) Alimamy Bakarr Sankoh
Gründungsmitglied, Leiter und Nationaler Vorsitzender
Die People's Democratic League
PDL
Wichtiger Hinweis:
Als Betreiber dieser Internetseite, möchten wir ausdrücklich Daraufhinweisen, dass wir den Wahrheitsgehalt dieser Darstellung weder bestätigen noch dementieren können und dass die Einstellung dieser Dokumentation, nicht den Beweis erbringt, dass dieses unser Meinungsbild ist. Zur Wahrung der Menschenrechte sehen wir uns verpflichtet, ein umfassendes Meinungsbild darzustellen.
Die Übersetzung aus der englischen Originalfassung erfolgte über ein Übersetzungsprogramm. Für mögliche Fehlübersetzung bitten wir um Entschuldigung, übernehmen dafür keine Verantwortung.
GeFiS e.V.
Quelle: siehe oben Internet-Mail, Bild Internet Häuptling Alimamy Bakarr Sankoh

Info über Palästina
19/01/2022
Beenden Sie jetzt die Administrativhaft für Palästinenser!
Diese Verhaftung ist ein Verstoß gegen die internationalen Menschenrechtsnormen
Ein Aufruf der Europäischen Allianz für die Solidarität mit den palästinensischen Gefangenen
Coalition européenne de soutien aux prisonniers palestiniens
Coalición europea de apoyo a los prisioneros palestinos
Europäische Allianz für die Solidarität mit den Palästinensischen Gefangenen e.V.
Bis Ende 2021 werden fast 500 Palästinenser in Administrativhaft von den israelischen Besatzungsbehörden rechtswidrig festgehalten. Die Palästinensische Administrativhäftlinge haben angekündigt, dass sie ab 2022 nicht mehr vor israelischen Besatzungsgerichten erscheinen werden. Mit dieser Entscheidung reagierten die inhaftierten Palästinenser auf die willkürliche Rechtspraxis der Besatzungsbehörden, die als "Verwaltungshaftgesetz" bezeichnet wird. Die israelischen Gerichte geben den Besatzungsbehörden stets den rechtlichen Schutz für ihre illegalen Praktiken.
Schon vor dieser Entscheidung traten sechs palästinensische Administrativhäftlinge für längere Zeit in einen offenen Hungerstreik, um die Gefängnisbehörden zu zwingen, sie freizulassen oder die Dauer ihrer illegalen Inhaftierung zu begrenzen.
Bei der Administrativhaft handelt es sich um eine willkürliche Praxis, die der israelischen Besatzungsbehörde das Recht gibt, jeden Palästinenser ohne Angabe von Gründen zu verhaften und für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten in Haft zu halten, wobei eine Verlängerung möglich ist. Während dieser Zeit werden die Inhaftierten weder angeklagt und vor Gericht gestellt noch freigelassen.
Die Administrativhaft ist ein koloniales Gesetz, das auf die britische Mandatszeit in Palästina zurückgeht. Israel hat dieses Gesetz seit der Besetzung des Westjordanlands, einschließlich Ostjerusalems, und des Gazastreifens im Jahr 1967 ausgeweitet.
In diesem Zeitraum hat die Besatzungsbehörde fast 54.000 Haftbefehle ausgestellt oder die Administrativhaft verlängert. Allein in diesem Jahr 2021 wurden 1.595 Haftbefehle ausgestellt oder die Administrativhaft wurde unter Verletzung des Völkerrechts und des humanitären Völkerrechts verlängert.
Die Palästinenser, die sich in Administrativhaft befinden, haben keine andere Wahl, als unter Lebensgefahr einen offenen Hungerstreik anzukündigen, um die Besatzungsbehörde zu zwingen, die Dauer der Haft zu begrenzen und sie zu einem bestimmten Zeitpunkt freizulassen.
In Solidarität mit den 500 Inhaftierten bekräftigen wir, die Unterzeichnenden, unsere unmissverständliche Unterstützung ihres Kampfes und des Kampfes aller palästinensischen Gefangenen, bis sie ihre Freiheit erlangen. Wir rufen alle internationalen Menschenrechtsinstitutionen, insbesondere den Menschenrechtsrat, die Parlamente aller europäischen Länder und das Europäische Parlament auf, klar gegen diese willkürliche Praxis Stellung zu beziehen, und fordern sie auf, Israel zu zwingen, diese rechtswidrige Praxis zu beenden.
Wir rufen auch alle Staaten und Organisationen, die die Rechte des palästinensischen Volkes unterstützen, auf, ihre Solidarität mit den 500 palästinensischen Administrativhäftlingen in ihrem Streben nach Freiheit zu bekunden.
Schließlich fordern wir die Freilassung aller palästinensischen Gefangenen in den israelischen Gefängnissen, einschließlich aller Kinder, Kranken, älteren Menschen und Frauen.
Brüssel am 31. Dezember 2021
Europäische Allianz für die Solidarität mit dem palästinensischen Gefangenen
➤ Bitte senden Sie Ihre Unterschrift an asrafalastin[at]web.de
https://drive.google.com/file/d/165wNdQgEB9MJHJ4wFLzffbscHpDCtXcY/view?usp=sharing
The-European-Alliance-in-Defence-of-Palestinian-Detainees
Liegnitzstr. 28, 53721 Siegburg, Germany,
Tel: 00491715411168, Fax: 0049-2241-2653744
asrafalastin[at]web.de
http://asrafalastin.eu
Accountnumber.: Kreissparkasse Köln, IBAN: DE08 3705 0299 0001 0389 45, BIC: COKSDE33
Envoyer par e-mailBlogThis!Partager sur TwitterPartager sur FacebookPartager sur Pinterest
Libellés : Administrativhaft, Deutsch, EADPP, Europäische Allianz für die Solidarität mit den Palästinensischen Gefangenen, Palästina/Israel, Palästinensische Gefangenen
Angriff auf Menschenrechte
Protest an Außenministerium Deutschland zur Einstufung NGO´S als "Terrorgruppen"
Aus: Ausgabe vom 11.01.2022, Seite 8 / Abgeschrieben
»Frontalangriff auf die Menschenrechte«
Die Landesarbeitsgemeinschaft Frieden und Internationale Politik der Partei Die Linke in NRW hat einen offenen Brief an Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) geschrieben und protestiert darin gegen die Einstufung von sechs palästinensischen Nichtregierungsorganisationen als »Terrorgruppen«. Darin heißt es:
(…) Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz hat am 22. Oktober sechs palästinensische NGOs zu »Terrorgruppen« erklärt. Diese gehören – was auch die UN-Kommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet betont – zu den renommiertesten Menschenrechts- und humanitären Gruppen in den besetzten palästinensischen Gebieten, die seit Jahrzehnten eng mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten.
Diese Einstufung als Terrororganisationen »ist ein Frontalangriff auf die palästinensische Menschenrechtsbewegung und auf die Menschenrechte überall«, wie auch Michael Lynk, der UN-Sonderberichterstatter für die besetzten palästinensischen Gebiete, erklärte. »Ihre Stimmen zum Schweigen zu bringen ist nicht das, was eine Demokratie, die sich an anerkannte Menschenrechte und humanitäre Standards hält, tun würde.« Wie auch Lynk rufen wir »die internationale Gemeinschaft auf, die Menschenrechtsverteidiger zu verteidigen«, und wir rufen ganz konkret Sie auf, diesen Schritt zu verurteilen, die israelische Regierung zur Rücknahme dieser Einstufung zu bewegen und die Zusammenarbeit mit diesen NGOs zu intensivieren. (…)
Die EU sowie einzelne EU-Länder unterstützen die palästinensische Zivilgesellschaft und auch die jetzt als »terroristisch« eingestuften Organisationen Al-Haq, Addameer, Defense for Children International-Palestine, das Bisan Center for Research and Development sowie die Organisationen Union of Palestinian Women’s Committees und Union of Agricultural Work Committees seit langem – meist über Drittorganisationen wie zum Beispiel die Heinrich-Böll-Stiftung und Medico International. Obwohl Israel die EU wegen dieser Finanzierung bereits früher zu Unrecht der »Terrorfinanzierung« beschuldigt hat und auch jetzt keinen überzeugenden Nachweis für diese Beschuldigungen geliefert hat, wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am 17. November 2021 laut der israelischen Zeitung Haaretz sagte, haben weder die EU noch Deutschland diese ungeheuerliche Entscheidung der israelischen Regierung bislang verurteilt. Wir sehen es als dringend erforderlich an, dass Deutschland und die EU diese Entscheidung entschieden verurteilen und die israelische Regierung zur Rücknahme bewegen. Das Schweigen Deutschlands würde auch Ihrer Koalitionsvereinbarung widersprechen, in der Sie von der palästinensischen Seite Fortschritte bei Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten sowie die Absage von jeder Form von Gewalt erwarten. Ganz abgesehen davon, dass wir sehr darüber erstaunt sind, dass Sie dies nur von der palästinensischen und nicht auch von der israelischen Seite erwarten, fragen wir Sie: Wie sollen sich die Werte Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte in der palästinensischen Gesellschaft entwickeln, wenn die israelische Besatzungspolitik renommierte Menschenrechts- und humanitäre NGOs willkürlich zerstört und alle Mitarbeiter:innen und alle Unterstützer:innen mit Gefängnis bedroht?
Quelle: junge Welt vom 11.01.2022

Info über Guatemala
Guatemaltekische Polizei unterdrückt indigene Völker von Nahualá
Das Gebiet wurde vor einigen Tagen von der Regierung aufgrund eines Massakers, das sich dort ereignete, in den Belagerungszustand ausgerufen.
Eine neue Konfrontation zwischen vereinten Sicherheitskräften und Bewohnern der indigenen Gemeinschaften von Nahualá im Departement Sololá im Süden Guatemalas wurde am Sonntag registriert, als die Strafverfolgungsbehörden mehrere Gruppen von Menschen bei Kilometer 160 der Interamerikanischen Route unterdrückten.
Die Bewohner von Sololá, die sich im Belagerungszustand befinden, haben mehrere Demonstrationen auf der Interamerikanischen Route in der Nähe von Santa Catarina Ixtahuacán abgehalten, um eine Lösung der territorialen Probleme mit Nahualá und Gerechtigkeit für alle Morde in den letzten Jahren zu fordern.
Das Problem entsteht im Rahmen des territorialen Konflikts, der zwischen dieser Gemeinde und Santa Catarina Ixtahuacán aus demselben Departement besteht.
Bei dieser Gelegenheit intervenierten die Armee und die Polizei, um die blockierte Route zu öffnen, erhielten aber eine Antwort von den Nachbarn der Gemeinde, die die Konfrontation auslöste.
Am 3. Januar werden die Operationen der Sicherheitskräfte fortgesetzt und der Dialog mit den Bewohnern zum Schutz des Gebiets aufgrund des durch den Konflikt verordneten Belagerungszustands fortgesetzt.
Die Regierung Guatemalas verfügte in der zweiten Dezemberwoche des vergangenen Jahres einen Belagerungszustand; Dies ist auf ein Massaker zurückzuführen, das das Leben von 13 Menschen unter Männern, Frauen und Kindern forderte, die auf dem Weg waren, ihre Ernte abzuholen.
Nach Angaben der guatemaltekischen Armee wurden am Sonntag sechs Soldaten und ein Agent der Nationalen Zivilpolizei (PNC) Guatemalas nach Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften verletzt.
Armeesprecher bestätigten einen beschädigten Lastwagen und die Bergung eines Streifenwagens sowie den Einsatz von Tränengas zur Abschreckung der Anwohner.
Polizeisprecher Jorge Aguilar sagte, es gebe mindestens zwei Blockaden von Bewohnern, mit denen sie versuchen würden, sich zum Dialog zusammenzusetzen.
Am 20. Dezember verhängte der guatemaltekische Präsident Alejandro Giammattei den Belagerungszustand in Nahualá und Santa Catarina de Ixtahuacán wegen eines Massakers an 14 Menschen in der Region.
Beide Gemeinden unterhalten einen territorialen Konflikt, der bei mehreren bewaffneten Zusammenstößen mehrere Tote und Verletzte gefordert hat.
Quelle: teleSUR v.03.01.2022

Info zu Menschenrechten
Aus: Ausgabe vom 09.11.2021, Seite 3 / Schwerpunkt
WESTLICHE PROPAGANDA
Mit zweierlei Maß
Geht es um Kuba, wird als Verletzung der Bürger- und Menschenrechte angeprangert, was anderswo gängige Praxis ist
Von Volker Hermsdorf
Georg Wendt/dpa Pool/dpa
Repression nach dem G20-Gipfel 2017 in Hamburg: Ein Beispiel für die Kriminalisierung von Aktivisten (10.7.2020)
Der Lateinamerikasonderberater von US-Präsident Joseph Biden, Juan Gonzalez, drohte Kuba am 22. Oktober mit »weiteren und schärferen Sanktionen«, falls »die Organisatoren der Protestmärsche vom 15. November strafrechtlich verfolgt werden sollten«. Geht es um Kuba, wird als Verletzung der Bürger- und Menschenrechte angeprangert, was im Westen gängige Praxis ist.
So beantragte die Staatsanwaltschaft nach dem G20-Gipfel Anfang Juli 2017 in Hamburg gegen 85 Demonstranten Haftbefehle. Noch Tage nach den Protesten und international kritisierten Polizeieinsätzen saßen 51 Personen in Untersuchungshaft. Drei Wochen später waren es immer noch 35. Ein Kunststudent aus Warschau wurde inhaftiert, weil dies, so das Landgericht Hamburg, »zur Verteidigung der Rechtsordnung« – also zur Abschreckung anderer – angezeigt sei. Einem 27jährigen, der mit einem Laserpointer einen Polizeihubschrauber angeleuchtet haben soll, wurde »versuchter Mord« vorgeworfen. Anderen Protestteilnehmern drohten wegen »gefährlicher oder versuchter gefährlicher Körperverletzung« mindestens sechs Monate Gefängnis, theoretisch sogar bis zu zehn Jahre Freiheitsentzug.
»In all diesen Fällen gibt es keinen Beleg dafür, was der einzelne in der Masse der Demonstranten getan hat. Die Vorwürfe stützen sich nur darauf, dass die Leute dabei waren, unabhängig davon, was sie selbst taten«, stellte die Süddeutsche Zeitung am 27. Juli 2017 fest. Journalisten, die über Proteste und Polizeieinsätze berichten wollten, wurden behindert. Einen Tag nach Gipfelbeginn entzogen die Behörden 32 Pressevertretern ihre Akkreditierungen. Journalistenverbände kritisierten Pfeffersprayattacken und Schlagstockeinsätze gegen Berichterstatter. Mehrere Journalisten wurden von Polizisten getreten, bedroht und beschimpft. In mindestens einem Fall richtete ein Beamter sein Gewehr auf einen Pressefotografen.
Obwohl derartige Szenen in Kuba unbekannt sind, steht die sozialistische Inselrepublik am Pranger. Dabei haben einige Organisatoren der für den 15. November angekündigten »Proteste«, die auf die Beseitigung der 2019 in einer Volksabstimmung mit 86,8 Prozent der abgegebenen Stimmen angenommenen sozialistischen Verfassung abzielen, großes Glück, in Kuba zu leben. In der BRD müssten sie für vergleichbare Aktivitäten und ihre Kontakte zu Terroristen – nach Paragraph 81 des Strafgesetzbuchs – »mit lebenslanger oder einer Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren« rechnen. Schon auf die »Vorbereitung« solcher, vom Gesetz in Paragraph 83 als »hochverräterisch« bezeichneten, Unternehmen stehen in Deutschland zwischen einem Jahr und zehn Jahre Haft. In den USA kann ein »Verrat gegen die Vereinigten Staaten« durch »Hilfe für ihre Feinde« sogar mit der Todesstrafe geahndet werden. Auch minderschwere Vergehen wie die »Verunglimpfung oder Herabwürdigung des Staates und seiner Symbole« (Paragraph 90a) sind in der Bundesrepublik Straftatbestände.
Quelle: junge Welt 09.11.2021

Info über Schweden
Aus: Ausgabe vom 08.11.2021, Seite 7 / Ausland
RASSISMUS
Hoffnung für Sámi
Schwedens Regierung kündigt Einrichtung von Wahrheitskommission zu Diskriminierung indigener Bevölkerung an
Von Gabriel Kuhn, Stockholm
Henrik Montgomery/imago images / TT
Bis heute werden sterbliche Überreste der Indigenen von schwedischen Forschungsinstituten und Museen verwahrt. Bestattung von 25 Sámi-Schädeln in Lycksele (8.8.2019)
Es ist ein Hoffnungsschimmer. Am vergangenen Mittwoch hat die schwedische Regierung angekündigt, eine Wahrheitskommission zur Aufarbeitung der Ungerechtigkeiten, die der samischen Minderheit im Land widerfahren sind, einrichten zu wollen. In einer Regierungserklärung teilte Schwedens Kulturministerin Amanda Lind mit: »Ich bin sehr froh, dass wir endlich eine Wahrheitskommission einberufen können. Unsere Regierung hat die Verantwortung, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was die Sámi an Übergriffen, Beleidigungen und Rassismus erleiden mussten und immer noch müssen.«
Die Sámi sind die indigene Bevölkerung des Norden Europas. In Schweden leben schätzungsweise 20.000 von ihnen, in Norwegen 70.000 und in Finnland 10.000. Die samische Gemeinde auf der russischen Kola-Halbinsel zählt 2.000 Menschen. Die Kolonisierung Sápmis, wie das traditionelle Siedlungsgebiet der Sámi genannt wird, war von Landraub, Zwangsumsiedlungen und dem Verbot samischer Sprache, Kultur und Religion geprägt. In Schweden führte das Staatliche Institut für Rassenbiologie in den 1920er und 30er Jahren anatomische Zwangsuntersuchungen an Sámi durch. Knochen und Schädel Verstorbener werden bis heute von schwedischen Forschungsinstituten und Museen verwahrt.
Mit der Einrichtung einer Wahrheitskommission folgt Schweden den Beispielen Norwegens und Finnlands, wo Wahrheitskommissionen bereits 2017 bzw. 2019 beschlossen wurden. Aufgrund der Coronapandemie geriet die Aufarbeitung jedoch ins Stocken. Abschlussberichte werden in den Ländern erst in einigen Jahren erwartet. In Schweden soll ein solcher 2025 veröffentlicht werden.
Bei der Besetzung der Kommissionen arbeiten die nationalen Regierungen mit den samischen Parlamenten zusammen, die es in jedem der Länder gibt. Vorsitzende der Arbeitsgruppe zur Wahrheitskommission des samischen Parlaments in Schweden ist Marie Persson Njatja. In einer Pressemitteilung des samischen Parlaments zeigte sie sich über den Regierungsentscheid erfreut: »Die Kommission hat das Mandat erhalten, jeden Stein in Schweden umzudrehen. Ein besonders wichtiger Auftrag ist es, Maßnahmen vorzuschlagen, die der Wiedergutmachung und der Veränderung dienen.« Die samischen Parlamente haben wenig Macht, sie dienen in erster Linie als Diskussionsforen. Das wichtigste politische Gremium der samischen Gesellschaft ist der 1956 gegründete Samische Rat, in dem Organisationen aus ganz Sápmi vertreten sind.
Auch der Vizepräsident des Samischen Rates, Aslak Holmberg, betonte im Gespräch mit junge Welt am Donnerstag die Bedeutung konkreter Vorschläge zur gesellschaftlichen Veränderung. Er mahnte jedoch zur Vorsicht, was die Arbeit der Wahrheitskommissionen anbelangt: »Im schlimmsten Fall erleben wir ein Weißwaschen: Man schaut nur auf die Vergangenheit, erklärt die samische Frage mit dem Abschlussbericht der Kommission für erledigt, legt die Papiere in die unterste Schublade und macht weiter wie bisher.« Dabei geht es Holmberg zufolge um weit mehr als das Aufarbeiten der Vergangenheit: »Es ist wichtig, dass die Arbeit der Kommission den Blick auch auf die Gegenwart und Zukunft richtet. Welche Strukturen unterdrücken und marginalisieren die Sámi auch heute noch? In welcher Form leiden wir immer noch unter dem kolonialen Erbe? Wie lässt sich unsere Lebenssituation verbessern? Wir brauchen Ideen, um die Zukunft besser zu gestalten.«
Sowohl in Schweden als auch in Norwegen kam es in jüngerer Zeit zu bahnbrechenden Urteilen der Obersten Gerichtshöfe, was die Landrechte der Sámi betrifft. So entschied das Oberste Gericht in Schweden im Januar 2020, dass der Vereinigung der samischen Rentierzüchter von Girjas in der Nähe Gällivares das alleinige Recht auf die Jagd und Fischerei auf ihrem Gebiet zukommt. Im Oktober dieses Jahres entschieden die Richter in Norwegen, dass zwei auf der Halbinsel Fosen errichtete Windparks gegen die in UN-Resolutionen verbürgten Rechte der Sámi als Ursprungsbevölkerung verstoßen. Beiden Urteilen gingen langjährige Rechtsstreits voraus. Sápmi geht neuen Zeiten entgegen.
Quelle: junge welt 08.11.2021

Info über Kolumbien
Aus: Ausgabe vom 08.11.2021, Seite 7 / Ausland
AUSBILDUNG UND AUFRÜSTUNG
Menschenrechte zweitrangig
Deutschland und Kolumbien vereinbaren Kooperationsabkommen in »Verteidigungsfragen«
Von Frederic Schnatterer
Jaime Saldarriaga/REUTERS
Die kolumbianischen Streitkräfte werden für zahlreiche Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht (Bogotá, 21.2.2018)
Dafür, dass es das erste Abkommen dieser Art zwischen der Bundesrepublik und einem lateinamerikanischen Staat ist, wurde es in der Öffentlichkeit erstaunlich wenig thematisiert: Am vergangenen Mittwoch unterzeichneten der Verteidigungsminister Kolumbiens, Diego Molano, der deutsche Botschafter in dem Land, Peter Ptasse, und der Verteidigungsattaché Harald Krempchen in Bogotá ein Kooperationsabkommen zwischen den beiden Staaten. Fortan wollen sie enger zusammenarbeiten, vor allem, was »Verteidigungsfragen« angeht, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung des kolumbianischen Verteidigungsministeriums.
Verteidigungsminister Molano erklärte vor der Unterzeichnung, die Kooperation mit Deutschland trete mit dem Abkommen in eine »neue Phase«. Sie werde es Bogotá künftig erlauben, seine »fundamentale Rolle innerhalb der NATO« bezüglich Ausführung und Unterstützung internationaler Operationen zu verbessern. Kolumbien ist seit 2018 als einziges Land Lateinamerikas »globaler Partner« im westlichen Kriegsbündnis. Zudem verfügen die Vereinigten Staaten über sieben Militärbasen in dem südamerikanischen Land, dessen Bedeutung für den Westen in den letzten Jahren gerade auch durch seine Nachbarschaft zu Venezuela gestiegen ist.
Der genaue Text des Abkommens wurde bislang nicht veröffentlicht. Einen Hinweis zum Inhalt gab am Mittwoch jedoch das kolumbianische Verteidigungsministerium über Twitter. Dort wurde erklärt, die Kooperation zwischen Berlin und Bogotá betreffe insbesondere die Bereiche militärische Ausbildung und Training, Waffentechnologie, »friedenserhaltende Maßnahmen«, maritime Sicherheit, Minenräumung, Cyberverteidigung und Cybersicherheit. Auch Molano betonte am Mittwoch, in Zukunft könnten so die Kapazitäten der kolumbianischen Einsatzkräfte, also von Polizei und Militär, gestärkt werden.
Angesichts der Menschenrechtslage in Kolumbien ist das durchaus besorgniserregend. Wie es um diese bestellt ist, zeigte nicht zuletzt der Umgang der rechten Regierung unter Iván Duque mit der Protestbewegung im Land. Seit April kamen Dutzende – manche Quellen sprechen von mehr als 80 – Demonstranten ums Leben, hinzu kommt eine Vielzahl an sogenannten Verschwundenen. Doch Berlin scheinen solche Hinweise auf systematischen Rechtsbruch nicht zu stören, wie auch der deutsche Botschafter Ptasse am Mittwoch noch einmal bewies. Per Twitter bedankte er sich am Mittwoch explizit bei Minister Molano und bezeichnete Kolumbien als »herausragenden Verbündeten«.
Quelle: junge Welt v.08.11.2021
03.10.
2021
Info aus Kolumbien
Indigener Führer der Awa-Gemeinde in Kolumbien ermordet
Es handelt sich um den Koordinator der indigenen Garde der Awô-Gemeinde, der Opfer einer Landmine geworden ist.
Die Welle paramilitärischer Gewalt, die in Kolumbien lebt, kostete am Freitag einen anderen indigenen Führer das Leben, als eine Antipersonenmine in einem Awa-Unterschlupf explodierte und den Koordinator Jhon Alberto Pascal tötete, berichteten Sprecher der Gemeinde.
Die Ereignisse ereigneten sich im indigenen Schutz von D 'Awa, Le Grand Sabalo, als der 25-Jährige neben seiner Mutter aus seiner Wohnung kam und auf das Gerät trat, was zu einem Grunzen führte.
Zeugenberichten zufolge, die vom Institut für Entwicklung und Frieden (Indepaz) zitiert wurden, zerstörte die Explosion Jhons Leiche, so dass seine Mutter nur einen minimalen Teil seiner Überreste erreichte.
Auf die Explosion folgte gestern Morgen eine Schießerei durch eine Gruppe bewaffneter Männer im indigenen Schutz von El Gran Sabalo, die vier Mitglieder derselben Familie, darunter ein Kind unter sieben Jahren, belästigte.
Ebenso erhielt Martha Lucia Ortíz, die Direktorin des indigenen Bildungszentrums Awá El verde de este resguardo, eine Morddrohung.
Die Gemeinschaft hat wiederholt angeprangert, dass sie wegen der Präsenz krimineller Gruppen auf ihrem Territorium inmitten des Terrors gefangen ist, und wiederholte einen Appell an die Regierung von Ivan Duque, mit der bevorstehenden Ausrottung des Awa-Volkes konfrontiert zu werden.
Die Region ist aufgrund der Konfrontation zwischen paramilitärischen Gruppen mit Minenfeldern übersät, und die Detonationen mehrerer Bewohner sind ums Leben gekommen, prangern Indepaz an.
Quelle: teleSUR 02.010.2021

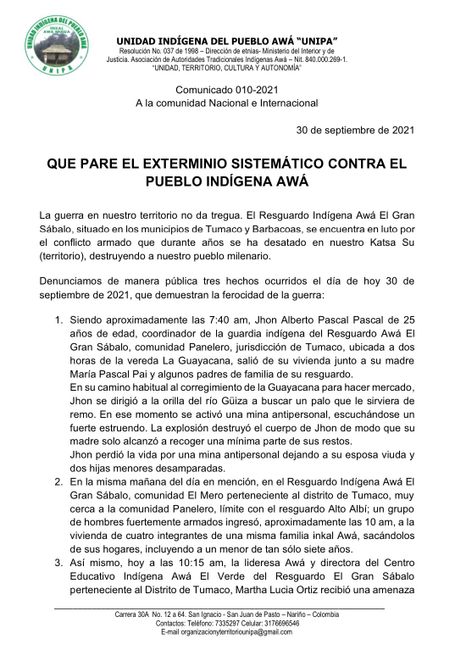

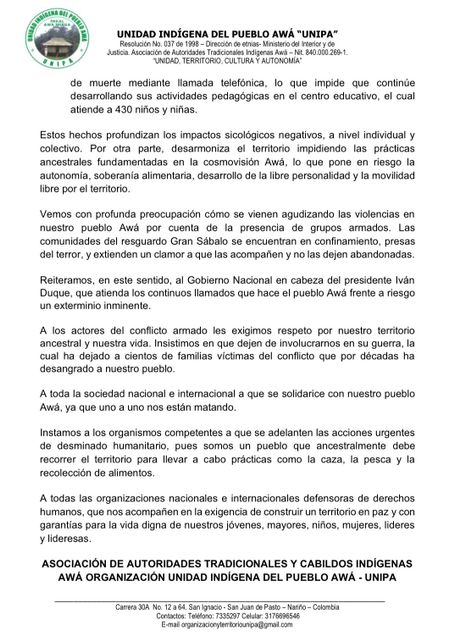

Info zu UN-Vollversammlung
30 Staaten fordern Ende von völkerrechtswidrigen Sanktionen des Westens
1 Okt. 2021 21:52 Uhr
In den letzten Jahren haben westliche Staaten, allen voran die Vereinigten Saaten, zunehmend zu einseitigen völkerrechtswidrigen Sanktionen gegriffen, um Drittstaaten wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen oder sonstiger "Verbrechen" zu "bestrafen".
Eine Gruppe von 30 Staaten hat am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Erklärung verfasst, die die Ablehnung von einseitigen, gegen die Satzung der Vereinten Nationen verstoßenden Zwangsmaßnahmen gegen andere Staaten fordert. Zu den Unterstützern der Erklärung gehören Russland, Venezuela, Kuba, Nordkorea, Iran, Südafrika, Palästina, Syrien und China, dessen UN-Botschafter die Erklärung vor dem dritten Ausschuss der UN-Vollversammlung vortrug.
Einleitend fordern die Staaten, die überwiegend aus Entwicklungsländern bestehen, eine "globale Antwort" auf die "erheblichen Auswirkungen" der COVID-19-Pandemie auf die "wirtschaftliche und soziale Entwicklung in allen Staaten". Diese Antwort müsse auf der zwischenstaatlichen Einheit, der Solidarität und auf internationaler Zusammenarbeit gegründet sein. Dabei verweist die Erklärung auf die Prinzipien der UN-Charta, insbesondere auf die Pflicht der UN-Mitgliedsstaaten zur Zusammenarbeit.
Die Staaten drücken anschließend ihre Besorgnis über die Anwendung von einseitigen Sanktionen gegen Entwicklungsstaaten aus:
"Wir sind besorgt über den Einsatz einseitiger Zwangsmaßnahmen gegen Entwicklungsländer, die den Zielen und Grundsätzen der UN-Charta und des Völkerrechts, dem Multilateralismus und den grundlegenden Normen der internationalen Beziehungen zuwiderlaufen."
Diese einseitigen Zwangsmaßnahmen haben in den Augen der unterzeichnenden Staaten verheerende negative Konsequenzen, etwa im wirtschaftlichen, sozialen und humanitären Bereich. Auch würden die Sanktionen erheblich die Bemühungen um die Förderung und den Schutz der Menschenrechte erschweren.
Es gebe viele Berichte, denen zufolge die Sanktionen den Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen wie Lebensmitteln, Wasser, Elektrizität, Medikamenten und medizinischer Ausrüstung erschweren würden, was gerade inmitten einer Pandemie besorgniserregend sei. Die Sanktionen würden zu vermehrter Armut führen und die Bemühungen humanitärer Organisationen, lebensrettende Hilfe an betroffene Menschen zu bringen, erschweren.
Angesichts dieser Situation bekräftigt die Staatengruppe, dass alle mit den gleichen Rechten geboren werden. Einseitige Zwangsmaßnahmen würden die betroffenen Bevölkerungen von Entfaltung ihrer Menschenrechte abhalten und ihren sozialen Wohlstand einschränken. Davon betroffen seien insbesondere Frauen, Kinder, Jüngere, Senioren und Behinderte.
An eine Reihe von früheren Aufrufen zum selben Thema erinnernd, fordern die Staaten die sofortige Abkehr von der Sanktionspolitik:
"Wir fordern die vollständige und sofortige Aufhebung der derzeitigen einseitigen Zwangsmaßnahmen gegenüber den betroffenen Ländern. Es muss unbedingt sichergestellt werden, dass die betroffenen Länder über angemessene Ressourcen und Unterstützung für die Reaktion auf die Pandemie und den Wiederaufbau verfügen, dass die humanitäre Hilfe die Bedürftigen ohne Verzögerungen oder Behinderungen erreichen kann und dass das Leiden der betroffenen Bevölkerung unverzüglich beendet wird."
Die Gruppe drängt andere Staaten, zukünftig von der Verhängung einseitiger, völkerrechtswidriger Sanktionen abzusehen. Die jetzige Situation erfordere "Solidarität und Einheit statt Konfrontation und Zwietracht". Das sei erforderlich, um die "globale Herausforderung" – also die Corona-Krise – zu meistern und die Menschenrechte von allen zu gewährleisten.
Quelle :rtd.01.10.2021

Information über Bolivien
Das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte erkennt die Gültigkeit des IPCC-Berichts an.
Das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (Hcdh) begrüßte heute, den 19. August, den von der Interdisziplinären Gruppe Unabhängiger Sachverständiger (IPCC) vorgelegten Bericht, in dem festgestellt wurde, dass während der De-facto-Regierung, die 2019 die Macht übernommen und den ehemaligen Präsidenten Evo Morales abgesetzt hat, schwere Menschenrechtsverletzungen begangen wurden.
Das sagte Hcdh-Sprecherin Liz Throssell mit Blick auf die Krise nach den Wahlen 2019 in Bolivien, wo es dem Bericht zufolge Massenhinrichtungen, sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt sowie den systematischen Einsatz von Folter gab.
Laut dem IPCC-Dokument hatte Gewalt rassistische und anti-indigene Vorurteile. Darüber hinaus haben die Sicherheitskräfte übermäßige und unverhältnismäßige Gewalt angewendet und die Durchführung dieser Handlungen nicht verhindert.
Herr Throssell wies darauf hin, dass die Schlussfolgerungen des IPCC-Textes mit denen des von seinem Präsidium im August 2020 veröffentlichten Berichts übereinstimmen.
"Der IPCC-Bericht muss die Bemühungen verstärken, unabhängige Untersuchungen durchzuführen, Gerechtigkeit und umfassende Wiedergutmachung der Opfer zu fördern, um die Wahrheit zu klären und weitere Menschenrechtsverletzungen in Bolivien zu verhindern", erklärte die Sprecherin in einer Erklärung.
Er warnte außerdem, wie wichtig es ist, dass die Ergebnisse des Berichts konstruktiv und unparteiisch genutzt werden, um den Dialog zwischen dem bolivianischen Volk zu fördern und "die Polarisierung und die anhaltenden politischen Spannungen abzubauen".
"Die Empfehlungen dieses Berichts und die Empfehlungen des Hcdh sind ein Fahrplan für die Bewältigung der strukturellen Herausforderungen in Bolivien" und zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie.
Die Sprecherin des Hcdh begrüßte die Zusage des bolivianischen Präsidenten Luis Arce, den IPCC-Bericht umzusetzen, und forderte die Behörden auf, Mechanismen zu schaffen, die sicherstellen, dass die Empfehlungen "mittel- und langfristig" zu konkreten Maßnahmen werden.
"Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen ist durch seine Präsenz im Land vor Ort, um den plurinationalen Staat Boliviens in diesem wichtigen Prozess zu unterstützen, und bekräftigt seine Solidarität mit den Opfern und ihren Familien", schloss er.
Quelle: TeleSUR 19.August 2021
10.
Juni
2021
Menschenrechte -
Kinderarbeit
Kinderarbeit nimmt zum ersten Mal seit 20 Jahren zu
Die Covid-19-Pandemie hat die bereits steigende Situation nur noch verstärkt.
Die Vereinten Nationen haben am Donnerstag davor gewarnt, dass Millionen von Kindern aufgrund der Covid-19-Pandemie zur Arbeit gezwungen werden könnten, während die Zahl der Minderjährigen, die Kinderarbeit machen, weltweit zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten gestiegen ist.
Einem Gemeinsamen Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) und des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF) zufolge, der Anfang 2020 erstellt wurde, waren fast 160 000 000 Minderjährige gezwungen, zu arbeiten, 8 400 000 mehr als vor vier Jahren.
In dem Dokument wird festgestellt, dass, wenn die prognostizierten Zahlen zur Weltweitverarmung erreicht werden, bis Ende 2022 etwa 9 000 000 kinder Beschäfti-gen mehr finden müssen.
Diese Zahlen können fünfmal so hoch sein, so die Projektionen, das ist es, was die Unicef-Statistiken und einer der Autoren der Studie Claudia Cappa veröffentlicht.
"Wenn die Sozialprognosen aufgrund von Sparmaßnahmen und anderen Faktoren unter dem derzeitigen Niveau liegen, könnte die Zahl der kinder arbeit lichen Kinder bis Ende 2020 um 46.000.000 steigen", erklärte Cappa gegenüber den internationalen Medien.
"Wir verlieren im Kampf gegen Kinderarbeit an Boden, und das letzte Jahr hat es nicht einfacher gemacht", sagte Henrietta Fore, Generaldirektorin von UNICEF.
"Wir haben das zweite Jahr der Einschließung, Der Schließung von Schulen, wirtschaftlicher Störungen und sinkender Staatshaushalte begonnen, und Familien sind gezwungen, schwierige Entscheidungen zu treffen", fügte er hinzu.
Zwischen 2000 und 2016 wurden 94 000 000 Bergleute beschäftigt. Der Aufwärtstrend setzte ein, noch bevor die Pandemie den Kurs der Weltwirtschaft änderte, was selbst für sie eine große Wendung bedeutete.
Während sich die Gesundheitskrise weltweit ausbreitete, arbeitete jedes zehnte Kind und die Vereinten Nationen warnen davor, dass sich die Situation verschlimmern könnte, wenn mit den in Armut geratenen Familien nichts unternommen wird.
Quelle: teleSUR 10.6.2021
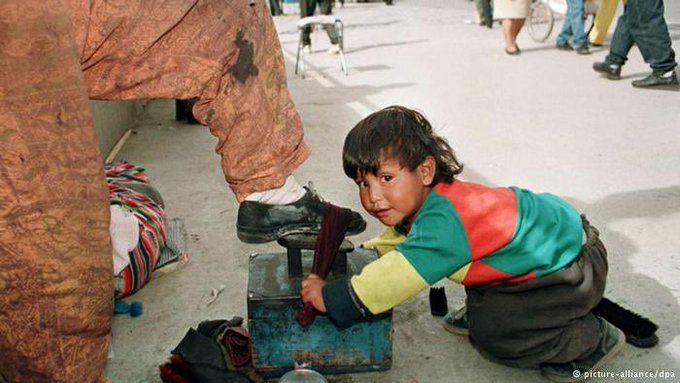




Menschenrechte
Menschenrechtler werfen israelischer Armee gezielte Angriffe auf Zivilisten vor
10 Juni 2021 19:00 Uhr
Menschenrechtsaktivisten sprechen davon, dass die Angriffe des israelischen Militärs in Gaza direkt gegen Zivilisten gerichtet gewesen seien. Derweil häufen auch sich Berichte über Angriffe israelischer Siedler auf palästinensische Bauern im Westjordanland.
Dass das israelische Militär im Gazastreifen eine horrende Verwüstung der zivilen Infrastruktur hinterlassen hat und Ziele angriff, in denen sich Unbeteiligte in ihrem Zuhause, der zivilsten aller Umgebungen befanden, ist aus mehreren Gründen noch nicht aufgearbeitet.
Unterdessen mehren sich Berichte über Gräueltaten, welche Siedler selbst bei der Vertreibung der Palästinenser verüben. Meist bleibt es dabei, die Opfer zu terrorisieren oder zu verletzen. Ismail Tubasi, ein Bewohner südlich von Hebron im besetzten Westjordanland, kam Medienberichten zufolge jedoch womöglich auf höchst gewaltsame Weise zu Tode.
Zeugen berichten, israelische Siedler hätten auf Tubasi geschossen, nachdem diese begonnen hatten, Felder und Bäume im Besitz von Palästinensern in al-Rihiya in Brand zu setzen. Eine Vorgehensweise, die nicht unüblich ist. Laut der Menschenrechtsgruppe Yesh Din sind 216 Beschwerden über Siedlergewalt allein zwischen Januar 2020 und Juni 2021 eingegangen. Ein aktueller Bericht der Organisation listet 63 Fälle von schweren Übergriffen in den Jahren 2017 bis 2020 auf. In keinem dieser Fälle wurde Anklage gegen die Täter erhoben.
Der 27-jährige Tubasi sei wie auch andere Palästinenser zu den Feldern gegangen, um die Flammen zu löschen. Den Augenzeugen zufolge sollen ihn dann mit Gewehren, Äxten und Schlagstöcken bewaffnete Siedler verfolgt haben. Mehrere Schüsse seien zu hören gewesen.
Wie das von israelischen und palästinensischen Journalisten betriebene Magazin +972 schreibt, sah ein Zeuge Tubasi auf dem Boden liegen, nachdem er von einer Kugel getroffen worden war. Weitere Wunden, welche das Hassan al-Qassam Krankenhaus später feststellte, lassen den Berichten zufolge den Schluss zu, dass Tubasi verstümmelt wurde, während dieser im Sterben lag. Eine Untersuchung des Vorfalls, der sich bereits Mitte Mai ereignet hat, wurde bisher nicht eingeleitet.
Präzise zielende Kampfflieger haben Dutzende Kinder und Frauen getötet
Unterdessen werden vermehrt Informationen zusammengetragen, um die ab dem 10. Mai dieses Jahres im Gazastreifen eskalierte Gewalt zu untersuchen. Die Zahl der im vergangenen Monat in Gaza getöteten Palästinenser liegt bei 256, darunter 66 Kinder. In Israel wurden 13 Menschen getötet, darunter zwei Kinder
Zu den von israelischen Luftangriffen getroffenen Zielen gehören zudem mehrere Hochhäuser in Gaza-Stadt, darunter das al-Jalaa-Gebäude, in dem Medienorganisationen wie Al Jazeera und Associated Press untergebracht waren. Neben mindestens 2.000 zerstörten und mehr als 15.000 beschädigten Wohneinheiten wurde auch für grundlegende Versorgung des Gazastreifens notwendige Infrastruktur schwer beschädigt. Straßen, die zum al-Shifa-Krankenhaus, der größten medizinischen Einrichtung und dem einzigen COVID-19-Testlabor in der Enklave führen, wurden laut Al Jazeera ebenfalls zerstört. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden während der Kämpfe sechs Krankenhäuser, neun Gesundheitszentren und eine Wasserentsalzungsanlage beschädigt.
Das israelische Militär behauptet, man habe nur Gebäude mit Verbindungen zur Hamas und weiteren bewaffneten Gruppen ins Visier genommen. Israels Premierminister Benjamin Netanjahu beschuldigte die Hamas, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu benutzen. Diese Version wurde auch von der deutschen Regierung und einigen Medien bekräftigt, als zahlreiche zivile Opfer auf der palästinensischen Seite zu beklagen waren. Demgegenüber konnte die UNO-Menschenrechtsbeauftragte Michelle Bachelet für diese Rechtfertigung der israelischen Anschläge keinerlei Belege finden. Dass sich in den bombardierten Gebäuden vermeintlich bewaffnete Gruppen befanden oder diese "für militärische Zwecke genutzt wurden", sei nicht zu beweisen.
Raji Sourani, Menschenrechtsanwalt und Direktor des Palästinensischen Zentrums für Menschenrechte in Gaza, erklärte dem Sender Al Jazeera, dass der Islamische Dschihad und die Hamas oder die Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) gar nicht das Ziel der Angriffe gewesen seien. Er ist der Ansicht, dass die Zivilbevölkerung gezielt unter schwerem Beschuss des israelischen Militärs stand. Sourani erklärte:
"Von der ersten Stunde des ersten Tages an waren Zivilisten das Ziel dieser High-Tech-Flugzeuge F16 und F35 mit Raketen, die für militärische Ziele bestimmt sind. Und man sieht, wie diese Dinger präzise zielen. Dutzende von Kindern und Frauen wurden getötet. Nichts kann das rechtfertigen."
Bereits im Frühjahr hatte der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) angekündigt, eine offizielle Untersuchung der Kriegsverbrechen Israels im besetzten Westjordanland und im blockierten Gazastreifen sowie in Jerusalem einleiten zu wollen. Jedoch sträubten sich sowohl Israel als auch die USA gegen die Aussicht auf eine Untersuchung möglicher israelischer Kriegsverbrechen. Medienberichten zufolge hoffte Israel, dass ein Aufschub der Untersuchungen bis zum Beginn der Amtszeit des neuen ICC-Anklägers Karim Khan Mitte Juni zu einer dem Land gewogeneren Bewertung führen könnte.
In einem offenen Brief verurteilten 55 ehemalige europäische Politiker, darunter Ministerpräsidenten und Außenminister, die Behinderung der Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs. "Zutiefst besorgniserregend ist nun die ungerechtfertigte öffentliche Kritik am Gericht in Bezug auf seine Untersuchung mutmaßlicher Verbrechen, die in den besetzten palästinensischen Gebieten begangen wurden, einschließlich unbegründeter Anschuldigungen des Antisemitismus", heißt es in dem Schreiben, das Ende Mai veröffentlicht wurde.
"Versuche, das Gericht zu diskreditieren und seine Arbeit zu behindern, können nicht toleriert werden, wenn es uns mit der Förderung und Aufrechterhaltung der Gerechtigkeit weltweit ernst ist. Wir verstehen die Ängste vor politisch motivierten Klagen und Untersuchungen. Dennoch sind wir der festen Überzeugung, dass das Römische Statut die höchsten Kriterien der Gerechtigkeit garantiert und einen entscheidenden Weg bietet, um die Straflosigkeit für die schwersten Verbrechen der Welt zu bekämpfen."
Vor dem Hintergrund der Gewalt im vergangenen Monat sagte die amtierende Chefanklägerin beim Internationalen Strafgerichtshof Fatou Bensouda, sie beobachte das Geschehen vor Ort genau.
Beide Seiten werden beschuldigt, Kriegsverbrechen begangen zu haben: Die Hamas, da sie wahllos Raketen auf zivile Gebiete in Israel abgefeuert hat, obwohl von den mehr als 2.000 Raketen nur etwa 640 im Gazastreifen einschlugen und 90 Prozent, die die Grenze überquerten, von Israels Raketenabwehrsystem Iron Dome abgefangen wurden, und Israel, da es wiederholt dicht besiedelte zivile Gebiete innerhalb des Gazastreifens bombardiert hat.
Yael Stein, Forschungsdirektorin bei B'Tselem, dem israelischen Informationszentrum für Menschenrechte in den besetzten Gebieten, ist angesichts der bisher vorliegenden Informationen bereits davon überzeugt, dass Israel mit den Bombardierungen ziviler Strukturen innerhalb des Gazastreifens gegen internationales Recht verstößt. Sie hob hervor:
"Damit ein Angriff legal ist, muss er sowohl auf ein militärisches Ziel gerichtet als auch verhältnismäßig sein."
Damit ein Gebäude ein militärisches Ziel ist, muss seine Zerstörung für Israel einen militärischen Vorteil bedeuten. Um verhältnismäßig zu sein, muss man beurteilen, ob der militärische Vorteil, den man sich von der Bombardierung verspricht, größer ist als der Verlust für die Zivilbevölkerung. Selbst wenn die Zivilbevölkerung kurzfristig gewarnt und evakuiert wurde, sei ziviles Eigentum nahezu planmäßig zerstört worden, so Stein. Dem Nachrichtenportal Al Jazeera erklärte sie:
"Ich denke, dass die Vergangenheit beweist, dass die israelische Armee dieses Prinzip in einer viel großzügigeren Weise auslegt, als es die Verfasser des internationalen Rechts es jemals erwartet hätten, und dass dies weit von dem entfernt ist, was als verhältnismäßig angesehen werden kann."
Laut Eric Goldstein, dem Exekutivdirektor für den Nahen Osten und Nordafrika bei Human Rights Watch, hat bezüglich der Situation ein Wandel im internationalen Bewusstsein stattgefunden. Dies habe die Bereitschaft erhöht, israelische Kriegsverbrechen als solche wahrzunehmen. Er begrüßt, dass der UN-Menschenrechtsrat eine internationale Untersuchung hierzu eingeleitet hat. Human Rights Watch werde darauf drängen, dass der Internationale Strafgerichtshof die Kriegsverbrechen aller Parteien untersucht. Die Hauptursache für die Behinderung eines langfristigen Friedens sei jedoch, dass der Gazastreifen dem größten Freiluftgefängnis der Welt gleichkomme. "Dies lässt die Menschen dort ohne Zukunft, ohne Hoffnung und mit beinahe täglichen Verletzungen ihrer Rechte zurück", so Goldstein. Er fügte hinzu, die internationale Gemeinschaft müsse Druck auf Israel ausüben, um dies zu beenden.
"Sie müssen diese Menschen als menschliche Wesen behandeln, als gleichberechtigte Menschen, die die gleichen Rechte verdienen wie alle anderen Menschen in dem Gebiet unter israelischer Kontrolle."
Goldstein betonte, dass die Unterdrückung der Palästinenser, die "auf eine Situation der Apartheid hinausläuft", den Konflikt nährt und der Hamas so "eine gewisse politische Unterstützung" verschafft. Insbesondere die Vereinigten Staaten müssten "ihre bedingungslose Unterstützung für Israel überdenken", während die Parteien, die die Hamas logistisch oder durch die Bereitstellung von Material unterstützen, dies beenden müssten.
Die Äußerung des französischen Außenministers Jean-Yves Le Drian, dass das "Risiko der Apartheid hoch" sei, wenn Israel weiterhin "nach einer Einstaatenlogik" handele und den Status quo beibehalte, quittierte Israel jüngst mit einer Rüge.
Jedoch betonten in dieser Woche zwei ehemalige israelische Botschafter, die in Südafrika gedient haben, dass sich Israel heute dem Verbrechen der Apartheid schuldig macht. Ilan Baruch, der als israelischer Botschafter in Südafrika, Namibia, Botswana und Simbabwe diente, und Dr. Alon Liel, ehemaliger israelischer Botschafter in Südafrika und Ex-Generaldirektor des israelischen Außenministeriums, erklärten, es sei an der Zeit, dass die Welt erkenne, dass das, was vor Jahrzehnten in Südafrika geschah, heute in den besetzten palästinensischen Gebieten geschieht. Das System sei von einer inhärenten Ungleichheit geprägt:
"Seit über einem halben Jahrhundert herrscht Israel in den besetzten palästinensischen Gebieten mit einem zweistufigen Rechtssystem, in dem innerhalb desselben Landstrichs im Westjordanland israelische Siedler unter israelischem Zivilrecht und Palästinenser unter Militärrecht leben."
Israel habe daran gearbeitet, "sowohl die Geographie als auch die Demographie der Westbank durch den Bau von Siedlungen zu verändern, die nach internationalem Recht illegal sind". Durch intensive Investitionen in die Entwicklung der Infrastruktur habe Israel über Jahre hinweg daran gearbeitet, die Siedlungen an Israel anzubinden.
Den israelischen Diplomaten zufolge geschah dies "parallel zur Enteignung und Übernahme massiver Teile palästinensischen Landes, einschließlich der Räumung und des Abrisses palästinensischer Häuser", während die Palästinenser in immer kleinere Landinseln gedrängt wurden. Heute besteht das Westjordanland aus 165 Enklaven, während der Gazastreifen im Jahr 2005, mit dem Abzug der Siedlungen aus dem Gazastreifen und dem Beginn der Belagerung, "einfach zu einer weiteren Enklave" wurde, einem Territorium ohne Autonomie, welches weitgehend von Israel umgeben ist und somit effektiv auch von Israel kontrolliert wird".
Indem die Bevölkerungen schrittweise von ihrem Land vertrieben und in dichten und zersplitterten Gebieten angesiedelt wurden, würden sowohl Südafrika damals als auch Israel heute "politische Autonomie und wahre Demokratie vereiteln". Es sei klarer denn je, "dass die Besatzung nicht vorübergehend ist und dass es in der israelischen Regierung nicht den politischen Willen gibt, ihr Ende herbeizuführen":
"Israel diskriminiert systematisch auf der Grundlage von Nationalität und ethnischer Zugehörigkeit. Eine solche Realität ist, wie wir selbst gesehen haben, Apartheid."
So wie sich die Welt dem Kampf gegen die Apartheid in Südafrika angeschlossen habe, sei es an der Zeit, dass man "auch in unserem Fall entschlossene diplomatische Maßnahmen ergreift und auf den Aufbau einer Zukunft der Gleichheit, Würde und Sicherheit für Palästinenser und Israelis gleichermaßen hinarbeitet," so die israelischen Diplomaten.
RTDeutsch 10.Juni 2021

PRESSEFREIHEIT IN CORONAZEITEN
»Ausgangssperren wurden zur Verfolgung genutzt«
Internationale Schriftstellervereinigung legt Statistik zu Übergriffen auf Medienschaffende vor.
Ein Gespräch mit Ralf Nestmeyer
Interview: Gitta Düperthal
Ralf Nestmeyer ist Vizepräsident und Writers-in-Prison-Beauftragter (Autoren in Haft) des deutschen Zentrums der Schriftstellervereinigung PEN (Poets, Essayists, Novelists – Dichter, Essayisten, Autoren)
Das deutsche Zentrum der Schriftstellervereinigung PEN hat jüngst eine sogenannte Caselist über insgesamt 220 Übergriffe auf Schriftsteller, Journalisten und Verleger, insbesondere auch Frauen veröffentlicht. Um welche Fälle geht es?
Insgesamt wurden 44 Schriftstellerinnen inhaftiert, vor Gericht gestellt, angegriffen oder bedroht. Sie hatten gegen Menschenrechtsverletzungen protestiert, Korruption aufgedeckt, ihre Regierungen kritisiert oder die Rechte von Minderheiten verteidigt. In Brasilien recherchierte die Schriftstellerin Patrícia Campos Mello über eine mögliche illegale Finanzierung der Wahlkampagne des Präsidenten Jair Bolsonaro. Daraufhin wurde ihr unterstellt, sexuelle Dienstleistungen für Informationen anzubieten. Die Autorin und Menschenrechtsaktivistin Golrokh Ebrahimi Iraee wurde im Iran inhaftiert, weil sie in einer bislang unveröffentlichten Kurzgeschichte die Steinigung einer Frau schildert. Unter dem Deckmantel von Covid-19-Maßnahmen nahmen Übergriffe weltweit zu. Strengere Kontrollen und Ausgangssperren wurden zur Verfolgung genutzt.
Wie ist zu erklären, dass die Bundesregierung ihren Blick hauptsächlich nach Russland und Belarus richtet, obgleich es überall auf der Welt und auch hierzulande problematische Entwicklungen gibt?
Sie tut es zu Recht. Journalistinnen und Journalisten sind dort stark unter Druck. Erstaunlich ist, dass der Präsident Alexander Lukaschenko so eine Angst vor einem Blogger hat, dass er ein Flugzeug zur Landung zwingen lässt.
In diesem aktuellen Fall schwingen die deutsche Regierung wie auch die Verantwortlichen in der EU sofort die Sanktionskeule. In anderen Fällen, etwa wenn es um die Türkei geht, schaut Berlin beinahe reglos zu, wie unter der Regierung von Recep Tayyip Erdogan Schriftstellerinnen und Journalisten wie Verbrecher behandelt und weggesperrt werden.
Das hängt mit der politischen Einordnung der Bundesregierung zusammen. Die Unterdrückung der Meinungsfreiheit in der Türkei spielt im politischen Umgang mit Erdogan und dessen Regierung keine Rolle. Im Fall des inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel kam niemand auf die Idee, Wirtschaftssanktionen zu verhängen. Damals hätte man beispielsweise Flüge in die Türkei stoppen können, was den Tourismus hart getroffen hätte.
Seitens der kurdischen Bewegung wird kritisiert, zwar kenne jeder den Namen des rechten russischen Oppositionellen Alexej Nawalny, nicht aber den des Schriftstellers und HDP-Politikers Selahattin Demirtas, der seit 2016 in der Türkei im Hochsicherheitsgefängnis in Edirne gefangen ist.
In der Tat sind in der Türkei Autorinnen und Journalisten seit mehr als einem Jahrzehnt der politischen Verfolgung und Justizwillkür ausgesetzt. Es gibt übrigens ein weiteres Beispiel, an dem sich die Bundesregierung gänzlich desinteressiert zeigt: Der australische Journalist und Wikileaks-Gründer Julian Assange sitzt nach wie vor in Großbritannien im Gefängnis. Deutschland hätte Assange längst Asyl bieten können. Das würde aber zu Konflikten mit den USA führen. Das will die Bundesregierung vermeiden, möglicherweise aus wirtschaftlichen Interessen.
Weshalb verhängt die Bundesregierung keine Sanktionen gegen die Türkei, wenn sie Journalistinnen, Autoren und Politiker einsperrt?
Das fragt sich! Auch Konzerne, wie etwa die Allianz-Versicherung, seit 13 Jahren mit einer Dependance in der Türkei Marktführer, könnten sich für die Einhaltung der Menschenrechte dort einsetzen. Man interessiert sich aber nur für reibungslos funktionierende Geschäfte.
Was will PEN mit der Publizierung der »Caselist« erreichen?
Überall auf der Welt, wo die Meinungsfreiheit für Autorinnen und Autoren eingeschränkt ist, versuchen wir das in den Fokus zu stellen. Dadurch wollen wir Verbesserungen erreichen.
Quelle: junge Welt vom 01.06.2021
Bild: imago/ZUMA Press
Demonstration in Istanbul für die Freilassung des HDP-Politikers Demirtas (17.6.2018)

Moira Millén beharrt in Argentinien gegen "Terrizid"
Hektar Land befanden, wie es im Fall des Italieners Luciano Benetton der Fall ist, der etwa eine Million Hektar in Patagonien hat und reich an Von Maylén Vidal (*)
Buenos Aires (Lateinische Presse) Moira Millon litt jahrelang unter Verfolgung, Drohungen und dem Schmerz, sein Volk zu massakrieren, aber dieser Argentinier Mapuche ging in der Rechtfertigung der ursprünglichen Völker voran.
Mit 50 Jahren ist dieser Weychafe (Krieger), einer der Führer der Indigenen Frauenbewegung für das gute Leben, von Ende zu Ende durch das Land gereist und hat den Kampf um seine Schwestern angesichts der "Terricide" und der ständigen Femizide, deren Opfer sie sind, mit abwegigen Praktiken in diesem 21. Jahrhundert.
Inmitten der Pandemie geht die Offensive weiter und ab dem 14. März, dem Welttag zum Kampf gegen die Dämme, unternahm er mit seinen Schwestern einen Spaziergang von Norden nach Süden des
Landes - um "Terricide" als Verbrechen gegen Menschlichkeit und Natur anzuprangern - das sie am 25. Mai in Buenos Aires abschließen wollen.
Alles begann im Jahr 2013, es hat in einem exklusiven Interview mit Prensa Latina Millon, die im September dieses Jahres aufbrechen, um Ushuaia, Argentiniens südlichste Stadt, zu lernen, was mit Mapuche Frauen und verschiedenen ethnischen
Gruppen vor sich ging.
Als sie jedes Gebiet erreichten, kamen sie
aus verschiedenen Gemeinschaften, um mir ihre Probleme zu erzählen. Im Jahr 2015 machten wir einen ersten großen Marsch der indigenen Frauen für das gute Leben, präsentierten der Nation einen Gesetzentwurf und organisierten uns als Eine Bewegung. Heute sind wir 500 der 36 Nationen, sagt er.
Sie erzählt von dieser Frau, die ständig Sätze von Hass und Drohungen erträgt, dass es, als sie begann, für Argentinien zu landen, nur
ein Traum war, der geknetet wurde, um ihre Gefährten in einer Bewegung zusammenzubringen, aber sie hätte nie gedacht, dass sie so viel wachsen würde. HEARTBREAKING STORIES
Dort, auf diesem Spaziergang, traf er herzzerreißende Geschichten, einige, die er in seinem eigenen Fleisch gelebt hatte und eine besonders, für die sie alle heute kämpfen, die schändliche Praxis
des Kinnens, ein Name, den die kreolischen Aborigines Mädchen oder Teenagern für ihr halb quietschiges Gesicht damals gegeben haben.
Es ist abscheulich.
Criollos einer bestimmten sozialen und wirtschaftlichen Macht wählen Mädchen zwischen acht und zehn Jahren, um sie zu vergewaltigen, sie leben dies als einen anfänglichen Ritus, sie sterben viele Male an den Folgen dieser Verletzungen, manchmal in Herden, manchmal begehen sie Selbstmord, erzählt Millon. Noch schmerzhafter ist die Situation, wenn die Kleinen schwanger werden.
"Dies hat leider die mitschuldige Zustimmung der Gemeinschaft, sie schließen ein, die Vergewaltiger sind oft Politiker, Händler, bemerkenswerte Menschen und sie entschädigen die Familien des Opfers mit einer Kuh
oder Einem Essen, wir haben sogar Fälle gesehen, in denen sie dem Vater einen Job gegeben haben", prangert der Mapuche-Führer an.
Er bezieht sich auf den Fall einer Herdenvergewaltigung eines 12-jährigen Mädchens im salzigen Chaco (im Nordwesten Argentiniens)
und dazu kam die Einnahme von Bier mit gemahlenem Glas. "Es gibt Situationen der Vergewaltigung mit Gegenständen, knirschen über ihren Körper, Verstümmelungen der Brüste, es ist schrecklich, was passiert."
"Es geht durch den vorherrschenden Rassismus, die soziale Gleichgültigkeit, die Indolenz einer ganzen Gesellschaft, die davon ausgeht, dass der Körper von Mädchen und indigenen Frauen Wegwerfsind
sind, dass das indigene Leben keinen Wert hat, es wird abgewertet", verweist auf eines der sichtbarsten Gesichter des Kampfes der Frauen ursprünglich in dieser südlichen Nation. GEGEN
DAS 'TERRICIDIO' Neben diesem Kampf stand er auch für einen anderen, gegen die 'terricide', ein Konzept, Ausdruck, das
ich persönlich aufgebaut und von der indigenen Frauenbewegung akzeptiert habe.
Es ist uns gelungen, als ein Konzept angesehen zu werden, das zum Aufbau einer kriminellen
Kategorie beiträgt, Terroizid als Verbrechen gegen die Natur und die Menschheit. Es ist die Handlung, die drei Lebenssysteme zu töten, die wir als indigene Völker anerkennen: die greifbare Welt, die wahrnehmbare Welt und die der Völker, erklärt er.
Der greifbare
Mord am Ökosystem; das Wahrnehmbare wären die heiligen Orte, wo es ein spirituelles Ökosystem gibt, das den Kreis des Lebens regeneriert, die Latifundio zum Beispiel ist eine Form von "Terricid", betont er.
Latifundistas verdrahten heilige Orte, an denen früher der
Dialog mit der Natur benutzt wurde, um die Bindung des Lebens zu stärken. Heute, sagt er, ist es unmöglich, weil sie in ihren Händen sind. "Im Falle des Lebenssystems der Völker ist es eine kulturelle Struktur, die zur Schaffung einer zivilisatonisierenden Matrix beitragen kann."
Es ist ein Beispiel dafür, wie sich transnationale Unternehmen in allen Gebieten auf Tausenden
Mineralien ist.
Einige dieser Gebiete betreten das Einzugsgebiet von kohlenwasserstofflichem Interesse, und die Mehrheit der Latifundisten siedelt sich an Orten an, wo es viel Süßwasser, Mineralien und
Öl gibt.
"Transnationale genießen völlige Straflosigkeit, vernichten das Leben der Territorien, verletzen alle Arten von Rechten indigener Völker unter der Komplizenschaft der verschiedenen Regierungen, die unter dem Staat erfolgreich waren", betont er.
ANERKENNUNG
ZU PLURINATIONALITÄT Nachdem er betont hat, dass es sehr komplex ist, Rechte gegen einen historisch rassistischen Staat zu fordern, fordert er im Namen der Bewegung, die sie und
andere Coterrénea leiten, die Anerkennung der freien Bestimmung der Völker, Territorien und der Multinationalität der Territorien.
Möge der Staat eine kategorische Wahrheit annehmen, dass es keine Bürgerhegemonie gibt, sondern viele Nationen, die auf demselben Territorium überleben.
Wir unterliegen den Vorschriften und der Homogenisierung der Vision eines Ländermodells, mit dem wir nicht einverstanden sind, Extraktivist, Verursacher, Raubtier, das das Leben nicht respektiert, manifestiert sich.
Er liefert sich heute den Kampf um die Anerkennung von Gebieten, in denen
es Ureinwohner gab, die, wie er angibt, in Kraft bleiben. "Wir haben das Recht, Politiken in Bezug auf unsere eigene Vision als Volk, in der Gesundheit, in der Kommunikation, im Lebensmitteltransport und in der Produktion, im Bildungsmodell zu definieren."
Wir möchten auch, dass die sprachlichen Rechte respektiert werden,
um einander zu verstehen, fügt er hinzu. Eine Frage, wie es ist, zwischen Angst und Stärke zu leben und gleichzeitig ein Volk zu verteidigen, das jahrhundertelang massakriert wurde, weist darauf hin, dass beide Gefühle zurückgenährt werden.
"Die Angst wird überwunden durch den Wunsch, das Leben zu garantieren, von einer besseren Welt zu träumen und ein neues
Brot für Solidarität zu bauen, gerecht, gerecht, wo wir die Träume der Menschen zu freier Entschlossenheit ernähren können."
Es ist sehr wichtig, dass Millon nicht zuhält, anprangert, versucht, Vorschläge zu entwickeln und zu entwickeln.
Wir können nicht erwarten, dass wundersame Bedingungen dazu in der Lage sind, weil Jahrhunderte und Jahrhunderte von Verbrechen gegen uns, von Enteignung, Verarmung, territorialer Reduktion vergangen sind, behauptet er.
Wir müssen mit großem Mut das anbringen können, was wir wollen, wo wir hinwollen, es kostet viel, weil wir den Ninguneo, die Verfolgung, das sexistische Schweigen
schändlicher Machtsektoren, aber manchmal auch der Ehemänner, der Gemeinschaftsbehörden haben, sagt er.
Jenseits von Justizundungen und hasserfüllten Botschaften behauptet Er, dass er weiterhin mit dem Weychafe-Geist kämpfen wird, der darin wohnt, und
der Brüderlichkeit unter seinen Gefährten aller Völker, die manchmal, wie er sagt, mehr leiden als ich.
An die Extraktivisten sendet er eine Botschaft: Sei vorsichtig, denn ihre
Tage der "Terricides" werden zu Ende gehen. "Die Erde in ihrer teluric-Bewegung weckt die Frauen und Völker der Welt, um genug zu sagen. Ich vertraue darauf, dass diese Kraft der Erde so viel Tod beendet."
Schließlich fügt er hinzu, dass die indigenen Völker weiterhin ihre Rechte auf Spiritualität und den Aufbau einer neuen
zivilisatisierenden Matrix für diesen Planeten beanspruchen müssen, die ihn in Zeiten so vieler Krisen braucht. arb/may/cvl (*) Latin
Press Correspondent in Argentinien
Quelle: Prensa Latina-Agencia Informativa Latinoamericana

Gewalt gegen Frauen, verwurzelt in der Dominikanischen Republik
Von Edilberto F. Méndez Amador*
Santo Domingo, (Lateinische Presse) Gewalt gegen Frauen in der Dominikanischen Republik ist ein in der Gesellschaft verwurzeltes Übel, schwer zu entfernen und alles scheint langfristig zu deuten.
Aber als ob das nicht genug wäre, stieg es in diesem Jahr mit Quarantäne und Sperrung der Covid-19, weit davon entfernt, die Geißel zu verlangsamen, beunruhigend zu.
Zwischen dem 1. April und dem 13. November dieses Jahres kamen
40 Frauen, darunter sechs Minderjährige, ihren Partnern das Leben.
In den ersten 46 Tagen der Beschränkungen, der härtesten Zeit der Quarantäne, d. h. zwischen Mitte März und Anfang Mai, erstatteten Frauen über die
Lifeline und das Office of Comprehensive Gender Violence Care Units dreitausend und 353 Meldungen über geschlechtsspezifische Gewalt.
Und diese Anschuldigungen schließen sich tausend 81 Anträgen auf Schutzanordnungen und tausend 124 Verhaftungen an, Horrorfiguren in der Mitte des 21.
Jahrhunderts.
Medienberichten zufolge wurden in den vom Frauenministerium verwalteten Frauen1112 Frauen und ihre 217 Söhne und Töchter unter 13 Jahren, davon 140 Kinder
und 77 Mädchen, aufgenommen.
Die Helpline, die mit dem Hilfe- und Schutzsystem 911
verbunden ist, hat durchschnittlich 22 Anrufe pro Tag abgeführt.
Als jedoch angenommen wurde, dass die Todesfälle angesichts der allmählichen Freisetzung der Krankheitssperre zurückgehen werden, geschah das Gegenteil, weil vom
1. Oktober bis zum 13. November dreizehn Frauen die tödlichen Statistiken verdickten.
Todesfälle, die dramatische Zeichen wie der Fall von Rosmery Valenzuela hatten, dem sein Aggressor mit einer Fledermaus den Kopf
zu Tode schlug, dem er Nägel hinzufügte, um ihn in seinem tödlichen Zweck noch effektiver zu machen.
Ein weiterer schwer zu verstehender Fall war der Mord
an Leyda Vicente Sénchez. Der Angreifer, der bei einem Polizeieinsatz niedergeschossen wurde, reichte nicht aus, um die Frau zu töten, sondern unternahm sie auch mit ihren Eltern und einem Schwager von ihr, zusätzlich zur Verletzung ihrer Schwester.
Fast immer lassen diese Frauen Kinder verwaist zurück, wenn sie nicht neben ihr
sterben, danach nimmt sich der Mörder oft das Leben oder fliegt.
Die Gemeinde und die Polizei werden in der
Regel Zeuge gewalttätiger Aktionen vor der letzten Tragödie; sexistische und religiöse Traditionen zwingen Frauen jedoch zum Schweigen, ohne von ihrer Familie und Gesellschaft abgelehnt zu werden. Die Regierung
und ihre Strategien Am 22. September kündigte der dominikanische Präsident Luis Abinader eine Reihe von Maßnahmen an, die zusammen
mit den vom Ministerrat gebilligten Maßnahmen einen Plan zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt im Land bilden.
Bei dieser Gelegenheit erklärte das Staatsoberhaupt, dass die Beseitigung der Gewalt
gegen Frauen eine Priorität im Land sei.
Darüber hinaus sagte sie, dass sie dem Nationalkongress ein umfassendes organisches Gesetz über Prävention, Pflege, Verfolgung, Sanktionen und Wiedergutmachung für die Beseitigung von Gewalt gegen
Frauen vorlegen wird.
Andererseits erklärte sie, dass die Initiative darauf abzielte, das Recht der Frauen auf ein gewaltfreies Leben zu
schützen und zu garantieren und das Integrale System gegen dieses Übel zu errichten.
Er berichtete auch über die Schaffung einer spezialisierten Polizei, um auf Fälle von geschlechtsspezifischer Gewalt schnell und zeitnah zu reagieren, sowie über die
Verwendung elektronischer Armbänder durch die Aggressoren, um die Behörden zu alarmieren, wenn sie sich ihren Opfern nähern.
"Diese nationale Reaktion gegen Gewalt erfordert, dass die verschiedenen Akteure des Systems in einem Prozess kontinuierlicher Zusammenarbeit, der es ermöglicht, diese Geißel endgültig zu bremsen, in
die gleiche Richtung gehen und die gleiche Aufgabe erfüllen", fügte er hinzu.
Obwohl dieses Land Anstrengungen unternimmt und wichtige Initiativen zur Beseitigung dieser Missbräuche durchführt, ist die realitätsgemäße Sache, dass
das Böse weitergeht und nach dem System der Vereinten Nationen in dem Gebiet eine der hauptwichtigsten Menschenrechtsverletzungen ist.
Vor genau einigen Wochen hat die Institution ihre Besorgnis über die hohe Gewalt gegen Frauen in
diesem Land zum Ausdruck gebracht und die Notwendigkeit zur Kenntnis genommen, ihr dringend ein Ende zu setzen.
Sie erinnerte daran, dass die Experimentelle Erhebung über die Situation von Frauen, die 2018 vom National Bureau of Statistics, der Interamerikanischen Entwicklungsbank und dem Ministerium
für Frauen erstellt wurde, ergab, dass 68,8 Prozent der dominikanischen Frauen über 15 Jahren irgendeine Form von Gewalt erlebten.
Während zwei von fünf Frauen im gleichen Alter Opfer sexistischer Gewalt geworden waren und 41,8 von
ihren Partnern oder Ex-Partnern unter Gewalt litten.
Die Agentur würdigte die Regierung jedoch zu ihrem Engagement für die Verteidigung der Rechte von Frauen, Jugendlichen und Mädchen und insbesondere für
die Förderung eines politischen Konsenses zur Beseitigung der Kinderehe und der frühen Gewerkschaften, was sich direkt auf das Phänomen auswirkt.
Dieses Land hat eine komplexe Aufgabe vor sich, weil die beschriebene Geißel als eine der schlimmsten von denen, die durch die dominikanischen Straßen und Nachbarschaften bewegen und ist nicht
genug mit Verpflichtungen, ist es notwendig, in Aktion zu handeln wissen, dass die Gesellschaft vor einem Problem mit vielen Kanten und voller Auswirkungen steht.
Hoffen wir, dass dieses Thema wirklich eine Priorität sein wird und die Arbeit an der Aufgabe geleistet wird, dieses Übel
allmählich an der Wurzel zu entfernen, der Bürgerschaft und vor allem innerhalb jeder Familie wird eine starke Arbeit aufgezwungen. *Lateinischer Pressekorrespondent in der Dominikanischen Republik
Quelle: Prensa Latina-Agencia Informativa Latinoamericana
rr/ema/cvl
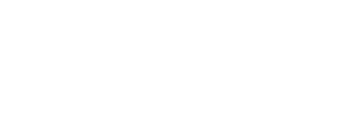
UN-Menschen- rechtskommission
Dauernotstand kann nicht als Rechtfertigung oder Grund für einseitige Sanktionen verwendet werden
GENF (4. März 2021) - Notstandserklärungen der US-Regierung, die einseitige Sanktionen genehmigen, führen zu schweren Menschenrechtsverletzungen und müssen mit dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) in Einklang gebracht werden, sagten UN-Menschenrechtsexperten.
Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte verpflichtet die Staaten, ein breites Spektrum von Menschenrechten zu schützen. Es erlaubt den Regierungen zwar, den Schutz bestimmter Rechte in Notfällen auszusetzen, doch kann dies nur geschehen, wenn die Existenz von Staaten gefährdet ist. Die Staaten können den Schutz der Rechte nur dann aussetzen, wenn dies zur Bewältigung des Notfalls erforderlich ist, und nur solange der Notfall besteht.
NOTfälle in den USA verstoßen oft gegen diese Regeln. Die nationalen Gesetze erlauben es dem US-Präsidenten, Notfälle auszurufen und Sanktionen auf der Grundlage nationaler Sicherheitsbedrohungen zu verhängen, aber auch, wenn die US-Außenpolitik oder Die Wirtschaft Bedrohungen ausgesetzt ist, und nicht nur auf der Grundlage von Bedrohungen für die Existenz der Vereinigten Staaten.
"Notfälle, die von den Vereinigten Staaten erklärt werden, dauern oft Jahre, und in einigen Fällen Jahrzehnte, und das gilt auch für die Sanktionen, die sie genehmigen", sagten Experten. "Statt echte Notfälle zu sein, scheinen sie wie Ausreden, um Sanktionen auf unbestimmte Zeit zu verhängen."
Zu den Gründen für US-Notstandserklärungen und Sanktionen gehören Vorwürfe der Korruption im Inland und Menschenrechtsverletzungen im Ausland sowie Bemühungen internationaler Staatsanwälte, gegen Amerikaner zu ermitteln, die des Kriegsverbrechens verdächtigt werden. "Keines davon stellt ein existenzielles Risiko für die Vereinigten Staaten dar."
"Insbesondere zwei US-Gesetze, der National Emergencies Act und der International Emergency Economic Powers Act, sind im Wesentlichen zu einer unbegrenzten Befugnis für den Präsidenten geworden, durch Notstandserklärungen und Sanktionen, die menschenrechteverletzen, weitreichende und hohe Ermessensbefugnisse auszuüben", so die Experten.
"Die von den USA auf der Grundlage des angekündigten Ausnahmezustands verhängten Sanktionen verletzen eine breite Palette von Menschenrechten in China, Kuba, Haiti, Iran, Nicaragua, der Russischen Föderation, Syrien, Venezuela, Simbabwe und anderen Ländern auf der ganzen Welt, einschließlich der Rechte auf Freizügigkeit, Vereinigungsfreiheit, auf ordnungsgemäße Verfahren wie faires Verfahren und die Unschuldsvermutung sowie wirtschaftliche und soziale Rechte und das Recht auf Leben. ", sagten sie.
Einige der Sanktionen, die sich aus US-Notstandserklärungen ergeben, verweigern Menschen überall auf der Welt, die angeblich bestimmte Aktivitäten ausüben, wie die Hilfe beim Wiederaufbau nach dem Konflikt in Syrien. Die Vereinigten Staaten verhängen auch sekundäre Sanktionen gegen Personen, die angeblich mit sanktionierten Menschen und Regierungen interagieren. "Dies sind Strafen, die verhängt werden, ohne die Rechte des ICCPR auf ein ordnungsgemäßes Verfahren zu achten, wie das Recht auf ein faires Verfahren", so die Experten.
Die UN-Menschenrechtsexperten fordern die Vereinigten Staaten nachdrücklich auf, ihren Verpflichtungen aus dem ICCPR voll und ganz nachzukommen, um negative Auswirkungen auf die Menschenrechte von Personen zu verhindern, die Sanktionen unterliegen, die gemäß den Notstandserklärungen genehmigt werden.
Endet
Die Experten: Alena Douhan, Sonderberichterstatterin über die negativen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf den Genuss der Menschenrechte und Obiora C. Okafor, Unabhängige Expertin für Menschenrechte und internationale Solidarität.
Sonderberichterstatter sind Teil der so genannten Sonderverfahren des Menschenrechtsrates. Special Procedures, das größte Gremium unabhängiger Experten im UN-Menschenrechtssystem, ist der allgemeine Name der unabhängigen Informations- und Überwachungsmechanismen des Rates, die sich entweder mit spezifischen Ländersituationen oder mit thematischen Fragen in allen Teilen der Welt befassen. Die Experten für sonderpädagogische Verfahren arbeiten auf freiwilliger Basis; sie sind keine UN-Mitarbeiter und erhalten kein Gehalt für ihre Arbeit. Sie sind unabhängig von jeder Regierung oder Organisation und dienen in ihrer individuellen Eigenschaft.
Für weitere Informationen und Medienanfragen wenden Sie sich bitte an Christophe Peschoux. (+41 22 917 9381, +41 79 101 04 88 / cpeschoux@ohchr.org )
Für Medienanfragen zu anderen unabhängigen UN-Experten wenden Sie sich bitte an Renato de Souza (+41 22 928 9855 / rrosariodesouza@ohchr.org)
Verfolgen Sie die Nachrichten über die unabhängigen UN-Menschenrechtsexperten auf Twitter@UN_SPExperts.

Bundespressekonferenz BPK
Sanktionsregime gegen Russland und Venezuela über das Völkerrecht
26 Feb. 2021 23:00 Uhr
Laut dem Bericht der UN-Sonderberichterstatterin Alena Douhan haben die Sanktionen der EU und USA zu gravierenden humanitären Folgen in Venezuela geführt. Sie rief daher zur Aufhebung der Sanktionen auf. Was machte daraufhin die EU? Sie verhängte, aktiv vorangetrieben durch Deutschland, neue Sanktionen. RT-Redakteur Florian Warweg wollte vom Auswärtigen Amt wissen, aus welchen Motiven und auf welcher völkerrechtlichen Grundlage dies geschah. Die Antwort erschüttert.
FRAGE WARWEG:
UN-Sonderberichterstatterin Alena Douhan hat in einem vorläufigen Bericht auf die gravierenden humanitären Folgen der EU- und US-Sanktionen für Venezuela hingewiesen und auch zur Aufhebung der Sanktionen aufgerufen.
Aus welchen Motiven hat sich maßgeblich Deutschland im Rahmen der EU gegen diesen Bericht und die Aufforderung der UN-Sonderberichterstatterin gewandt und just nach der Veröffentlichung die Sanktionen gegen Venezuela nochmals verschärft?
ADEBAHR:
Vielleicht gibt mir das Gelegenheit, kurz noch einmal auch zu den anderen aktuellen Entwicklungen beim Thema Venezuela etwas zu sagen.
Wir verurteilen nachdrücklich die Ausweisung der EU-Botschafterin aus Venezuela. Aus unserer Sicht verschließt das Maduro-Regime damit weitere wichtige Gesprächskanäle, um den Weg aus der Krise in Venezuela zu finden. Wir fordern das Maduro-Regime auf, diese Entscheidung zurückzunehmen.
Die Bundesregierung hat gestern in Brüssel mit allen EU-Mitgliedsstaaten beraten. Insofern wurde gestern in der EU beschlossen, auch die venezolanische Botschafterin bei der EU zur Persona non grata zu erklären, sie auszuweisen und zur Heimreise aufzufordern.
Was die Sanktionen betrifft, hat die EU am 22. Februar auf dem letzten Rat der Außenminister zusätzliche Sanktionen gegen 19 Angehörige des Maduro-Regimes verhängt. Warum hat sie das getan? Weil diese Personen aus unserer Sicht entweder demokratische Strukturen des Landes untergraben haben oder Menschenrechtsverletzungen begangen haben. Diese Sanktionen sind gegen Einzelpersonen gerichtet und so ausgelegt das beantwortet auch Ihre Frage nach dem Bericht, dass sie keine negativen wirtschaftlichen Auswirkungen auf die venezolanische Bevölkerung haben sollen. Das heißt: Wir verhängen in diesem Falle Sanktionen gegen Einzelpersonen, die spezifische Verletzungen begangen haben, und nicht Wirtschaftssanktionen, die sich in die Breite richten würden. Die Sanktionen sind eben eine konkrete Reaktion auf Menschenrechtsverletzungen und die Untergrabung demokratischer Strukturen im Land.
ZUSATZFRAGE WARWEG:
Die UN-Sonderberichterstatterin hat auch darauf verwiesen, dass ihrer Ansicht nach die Sanktionen der EU und der USA völkerrechtswidrig sind. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass sich die Bundesrepublik an völkerrechtswidrigen Sanktionen beteiligt, interessiert mich, auf welcher völkerrechtlichen Grundlage die neuen Sanktionsverstärkungen gegen Venezuela, aber auch gegen Russland erfolgten.
ADEBAHR:
Das ist die gleiche Legitimation der EU-Sanktionen im gleichen Regime wie vorher. Ich kann Ihnen gern die konkrete Berichtsnummer oder das, was da genau steht, noch nachreichen, wenn Sie sie nicht öffentlich finden.
ZUSATZFRAGE WARWEG:
Meine Frage war, auf welcher konkreten völkerrechtlichen Grundlage diese Sanktionen beruhen. Denn Sanktionen sind – verbessern Sie mich, wenn ich falschliege – völkerrechtlich nur dann legitim, wenn sie von den UN ausgesprochen werden.
ADEBAHR:
Die Europäische Union hat Sanktionsregime zu ganz verschiedenen Themen. Sie hat auch ein eigenes Menschenrechtssanktionsregime, das jetzt geschaffen wurde. Insofern bewegt sich die EU in ihren eigenen Sanktionsregimen, die sie macht und die aus unserer Sicht natürlich nicht völkerrechtswidrig sind.
Diese Sanktionen, da haben Sie einen Punkt, überschneiden sich sehr oft mit denen der VN [gemeint ist die UNO; Anm. d. Red.]. Denn die Interessen und die Ansichten sind sehr oft die gleichen. Aber trotzdem sind das zwei unterschiedliche Sanktionsmechanismen und -regime, jenes der EU und jenes der Vereinten Nationen.
https://youtu.be/vOQcKWBEiXo
Menschenrechte
Nehmen wir das Menschenrechtsversprechen!
- Ich werde Ihre Rechte respektieren, unabhängig davon, wer Sie sind. Ich werde Ihre Rechte auch dann wahr machen, wenn ich mit Ihnen nicht einverstanden bin
- Wenn die Menschenrechte von irgendjemandem verweigert werden, werden die Rechte aller untergraben, also werde ich AUFSTEHEN.
- Ich werde meine Stimme erheben. Ich werde Maßnahmen ergreifen. Ich werde meine Rechte nutzen, um für Ihre Rechte einzutreten.
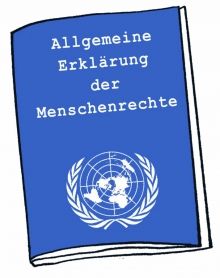
Was sind Menschenrechte?
Menschenrechte sind Rechte, die wir haben, nur weil wir als Menschen existieren - sie werden von keinem Staat gewährt. Diese universellen Rechte sind uns allen inhärent, unabhängig von Nationalität, Geschlecht, nationaler oder ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Religion, Sprache oder einem anderen Status. Sie reichen von den grundlegendsten - dem Recht auf Leben - bis zu denen, die das Leben lebenswert machen, wie das Recht auf Nahrung, Bildung, Arbeit, Gesundheit und Freiheit.
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (UDHR), die 1948 von der GENERALversammlung der Vereinten Nationen angenommen wurde, war das erste Rechtsdokument, in dem die grundlegenden Menschenrechte festgelegt wurden, die universell geschützt werden sollen. Die UDHR, die 2018 70 Jahre alt wurde, ist nach wie vor die Grundlage aller internationalen Menschenrechtsgesetze. Seine 30 Artikel enthalten die Grundsätze und Bausteine aktueller und künftiger Menschenrechtskonventionen, Verträge und anderer Rechtsinstrumente.
Die UDHR bilden zusammen mit den beiden Bündnissen - dem Internationalen Pakt für bürgerliche und politische Rechte und dem Internationalen Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte - die Internationale Bill of Rights.
Universell und unveräußerlich
Der Grundsatz der Universalität der Menschenrechte ist der Eckpfeiler des internationalen Menschenrechtsrechts. Das bedeutet, dass wir alle gleichermaßen Einrecht auf unsere Menschenrechte haben. Dieser Grundsatz wird, wie zuerst in der UDHR betont wurde, in vielen internationalen Menschenrechtskonventionen, Erklärungen und Entschließungen wiederholt.
Die Menschenrechte sind unveräußerlich. Sie sollten nicht weggenommen werden, außer in bestimmten Situationen und nach ordnungsgemäßem Verfahren. Beispielsweise kann das Recht auf Freiheit eingeschränkt werden, wenn eine Person von einem Gericht eines Verbrechens für schuldig befunden wird.
Unteilbar und voneinander abhängig
Alle Menschenrechte sind unteilbar und voneinander abhängig. Das bedeutet, dass ein Satz von Rechten nicht vollständig ohne das andere genossen werden kann. So erleichtert beispielsweise fortschritte bei den bürgerlichen und politischen Rechten die Ausübung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte. Ebenso kann die Verletzung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte viele andere Rechte negativ beeinflussen.
Gleich und nichtdiskriminierend
In Artikel 1 der UDHR heißt es: "Alle Menschen werden frei und gleich in Würde und Rechten geboren." Die in Artikel 2 festgelegte Freiheit von Diskriminierung ist es, die diese Gleichheit gewährleistet.
Die Nichtdiskriminierung erstreckt sich über alle internationalen Menschenrechtsgesetze. Dieser Grundsatz ist in allen wichtigen Menschenrechtsverträgen enthalten. Sie enthält auch das zentrale Thema von zwei Kerninstrumenten: dem Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung und dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau.
Rechte und Pflichten
Alle Staaten haben mindestens einen der neun grundlegenden Menschenrechtsverträgesowie eines der neun fakultativen Protokolle ratifiziert. 80 % der Staaten haben 4 oder mehr ratifiziert. Das bedeutet, dass die Staaten völkerrechtliche Verpflichtungen und Pflichten haben, die Menschenrechte zu achten, zu schützen und zu erfüllen.
- Die Verpflichtung zur Achtung bedeutet, dass die Staaten davon absehen müssen, in den Genuss der Menschenrechte einzugreifen oder sie einzuschränken.
- Die Schutzpflicht verpflichtet die Staaten, Einzelpersonen und Gruppen vor Menschenrechtsverletzungen zu schützen.
- Die Verpflichtung zur Erfüllung bedeutet, dass die Staaten positive Maßnahmen ergreifen müssen, um den Genuss grundlegender Menschenrechte zu erleichtern.
In der Zwischenzeit, als Individuen, während wir ein Recht auf unsere Menschenrechte haben - aber wir sollten auch die Menschenrechte anderer respektieren und einstehen.
Tag der Menschenrechte
Jedes Jahr am 10. Dezember feiert die Welt den Tag der Menschenrechte, genau an dem Tag, an dem 1948 die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedete.
Die Erklärung besteht aus einer Präambel und 30 Artikeln, in denen ein breites Spektrum grundlegender Menschenrechte und Freiheiten dargelegt ist, auf die wir alle, überall auf der Welt, Anspruch haben. Sie garantiert unsere Rechte ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit, des Wohnorts, des Geschlechts, der nationalen oder ethnischen Herkunft, der Religion, der Sprache oder eines anderen Status.
Die Erklärung wurde von Vertretern aller Regionen und Rechtstraditionen verfasst. Es wurde im Laufe der Zeit als Vertrag zwischen Regierungen und ihren Völkern akzeptiert. Nahezu alle Staaten haben die Erklärung akzeptiert. Seitdem dient es als Grundlage für ein erweitertes System des Schutzes der Menschenrechte, das sich heute auch auf schutzbedürftige Gruppen wie Menschen mit Behinderungen, indigene Völker und Migranten konzentriert.
Viele von uns haben Angst vor der Art und Weise, wie die Welt vorgeht. Extremistische Bewegungen unterwerfen Menschen schrecklicher Gewalt. Konflikte und Entbehrungen zwingen Familien aus ihrer Heimat. Der Klimawandel verdunkelt unseren Horizont – und überall, so scheint es, vertiefen sich die Ängste. Menschliche Werte werden angegriffen, und wir fühlen uns überfordert – unsicher, was wir tun sollen oder wohin wir uns wenden sollen.
Botschaften von Intoleranz und Hass machen unsere Ängste aus. Sie werden von Menschen verbreitet, die Machtwillen, verdrehte Logik und falsche Versprechungen einsetzen und lügen. Ihre Erzählungen sprechen von Egoismus, Separatismus – einem verzerrenden, engen Blick auf die Welt. Nach und nach steigt diese giftige Flut des Hasses um uns herum, und die tiefen und lebenswichtigen Prinzipien, die friedliche Gesellschaften schützen, laufen Gefahr, hinweggefegt zu werden.
Wir müssen die Grenze ziehen – und das können wir auch. Es gibt einen anderen Weg. Es beginnt damit, dass wir alle praktische Schritte unternehmen, um unsere gemeinsame Menschlichkeit zu bekräftigen.
Das UN-Menschenrechtsbüro hält an Werten fest, die die Wurzeln von Frieden und Inklusion sind. Wir treten für praktische Lösungen für Angst und Ungerechtigkeit ein, damit die Regierungen die Rechte aller ihrer Völker im Einklang mit dem Völkerrecht schützen. Wir überwachen ihre Politik und rufen sie auf, wenn sie zu kurz kommen. Wir stehen für mehr Freiheiten. Mehr Respekt. Mehr Mitgefühl.
Begleiten Sie uns. Helfen Sie dabei, die toxischen Muster einer ängstlichen Welt zu durchbrechen und sich auf eine friedlichere, nachhaltigere Zukunft zu begeben. Wir müssen nicht tatenlos zusehen, wie die Hasser Die Feindseligkeiten zwischen den Gemeinschaften treiben – wir können Brücken bauen. Wo immer wir sind, können wir wirklich etwas bewegen. Auf der Straße, in der Schule, bei der Arbeit, im öffentlichen Verkehr; in der Wahlkabine, in den sozialen Medien, zu Hause und auf dem Sportplatz.
Überall dort, wo es Diskriminierung gibt, können wir einen Schritt nach vorn tun, um das Recht eines Menschen zu schützen, frei von Angst und Missbrauch zu leben. Wir können unsere Stimme für anständige Werte erheben. Wir können gemeinsam mit anderen öffentlich für eine bessere Führung, bessere Gesetze und eine größere Achtung der Menschenwürde werben.
Jetzt ist es an der Zeit. "Wir, die Völker" können für Rechte einstehen. Lassen Sie uns wissen, was Sie tun, und wir werden Ihre Geschichten sammeln und Ihre Stimme verstärken. Lokale Aktionen können zu einer globalen Bewegung addieren. Und gemeinsam können wir für mehr Menschlichkeit einstehen.
Es beginnt mit jedem von uns. Treten Sie für die Menschenrechte ein.
UN - Menschenrechts Erklärung von 1948
Auf den nächste Seiten findest du alle 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen wurden.
Wir haben die Texte teilweise gekürzt oder sprachlich angepasst und durch eigene Beschreibungen ergänzt.

Artikel 1
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechte geboren

Artikel 2
Niemand darf diskriminiert werden

Artikel 3
Jeder hat das Recht auf Leben

Artikel 4
Keine Sklaverei

Artikel 5
Niemand darf gefoltert werden

Artikel 6
Jeder wird überall als Rechtsperson anerkannt

Artikel 7
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich
UN - Menschenrechts Erklärung von 1948
- Artikel 8 - 13 -

Artikel 8
Anspruch auf Rechtsschutz

Artikel 9
Niemand darf willkürlich inhaftiert werden

Artikel 10
Jeder hat das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren

Artikel 11
Jeder bist unschuldig, solange nicht das Gegenteil bewiesen wurde

Artikel 12
Jeder hat ein Recht auf Privatleben

Artikel 13
Jeder darf sich frei bewegen
UN - Menschenrechts Erklärung von 1948
- Artikel 14 - 19 -

Artikel 14
Recht auf Asyl

Artikel 15
Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit

Artikel 16
Das Recht zu heiraten und eine Familie zu gründen

Artikel 17
Jeder hat ein Recht auf Eigentum

Artikel 18
Recht auf Gedanken,- Gewissen und Religionsfreiheit

Artikel 19
Recht auf freie Meinungsäußerung
UN - Menschenrechts Erklärung von 1948
- Artikel 20 - 25 -

Artikel 20
Recht auf friedliche Versammlung

Artikel 21
Recht auf Demokratie und freie Wahlen

Artikel 22
Recht auf soziale Sicherheit
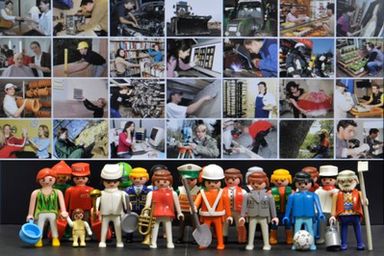
Artikel 23
Recht auf Arbeit und Schutz der Arbeit

Artikel 24
Recht auf Erholung und Freizeit

Artikel 25
Recht auf Unterkunft, Essen und ärztlicher Versorgung
UN - Menschenrechts Erklärung von 1948
- Artikel 26 - 30 -

Artikel 26
Jeder hat ein Recht auf Bildung

Artikel 27
Kultur und Urheberrecht
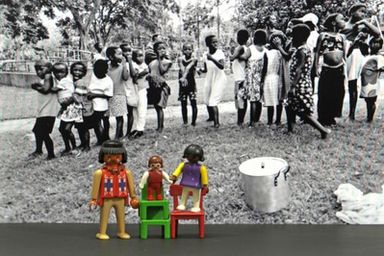
Artikel 28
Gerechte soziale und internationale Ordnung

Artikel 29
Wir alle tragen Verantwortung gegenüber anderen
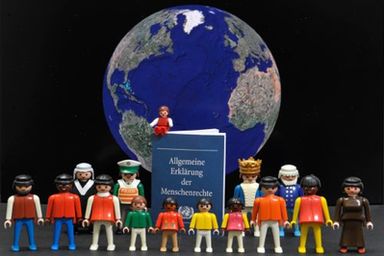
Artikel 30
Niemand kann dir die Menschenrechte wegnehmen
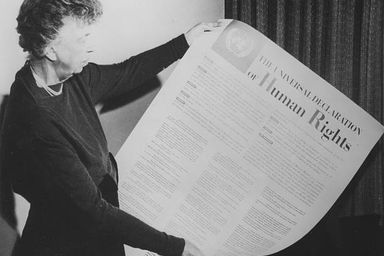
Eleanor Roosevelt
Wo fangen denn die universellen Menschenrechte an? An kleinen Orten, in der Nähe von zu Hause -- so nah und so klein, dass sie auf keiner Karte der Welt zu sehen sind. [...] Wenn diese Rechte dort keine Bedeutung haben, haben sie nirgendwo eine geringe Bedeutung. Ohne eine konzertierte Bürgeraktion, um sie wohnortnah aufzurichten, werden wir vergeblich nach Fortschritten in der größeren Welt suchen."
Eleanor Roosevelt
Menschenrechte
&
Völkerrecht
Das Humanitätsideal dient zur Legitimation von Krieg und Völkerrechtsbruch. Exklusivabdruck aus „Menschenrechte“.
von Norman Paech
Foto: garagestock/Shutterstock.com
Menschenrechte sind in jüngster Zeit zu einem der zentralen Begriffe und Standardlegitimationen in der Außenpolitik geworden. Heute gibt es kaum eine politische Konfrontation und keine militärische Intervention, die nicht die Menschenrechte als Basis der Argumentation und Legitimation ihres Eingriffes heranziehen. Man versucht Menschenrechte oft buchstäblich herbeizubomben. Dabei gerät ein anderes Recht, das Völkerrecht, oft ins Hintertreffen. Bevor man sich mit dem Missbrauch des Menschenrechtsbegriffs befasst, ist es hilfreich, sich vor Augen zu führen, wie es ursprünglich gemeint war. Dies gelingt dem Autor mit einem Streifzug durch die Geschichte.
Menschenrechte sind in jüngster Zeit zu einem der zentralen Begriffe und Standardlegitimationen in der Außenpolitik geworden. Noch vor wenigen Jahrzehnten konnte man weder in dem voluminösen Werk von Henry Kissinger „Diplomacy“ (1) noch in den tonangebenden Analysen zu Frieden, Krieg und dem System der internationalen Beziehungen, geschweige denn in den außenpolitischen Programmen der CDU/CSU, SPD und von Bündnis 90/Die Grünen ein Wort zur Bedeutung der Menschenrechte entdecken (2). Heute gibt es kaum eine politische Konfrontation und keine militärische Intervention, die nicht die Menschenrechte als Basis der Argumentation und Legitimation ihres Eingriffes heranziehen.
Woran liegt die Renaissance eines Rechts, welches ein selbstverständliches und deshalb kaum erwähnenswertes Element eines jeden demokratischen Handelns sein sollte? Die Vermutung liegt nahe, dass es nicht gut um das Recht bestellt ist, wenn es derart immer wieder in den Vordergrund gerückt wird.
Es gibt einen oft vernachlässigten, aber nicht unwesentlichen Unterschied zwischen dem Recht der Menschen und dem Recht der Völker.
Richtet sich ersteres vornehmlich gegen den eigenen Staat, soll es also im Wesentlichen die Freiheiten und Pflichten im innerstaatlichen Bereich bestimmen, so soll das Völkerrecht die internationalen Beziehungen der Staaten zueinander regeln. Der Begriff „Völkerrecht“ ist also irreführend. Zutreffender ist der im Englischen und Französischen übliche Begriff „Internationales öffentliches Recht“.
Es handelt sich vornehmlich um ein Recht der Staaten. Die Völker sind erst in ihrem Kampf um Dekolonisation auf dem Weg zu einem eigenen souveränen Staat als Rechtssubjekte anerkannt worden. Doch verbinden sich Menschen- und Völkerrecht wieder in ihrem Entstehungsprozess, denn auch die Menschenrechte wurden, anders als die von ihnen abgeleiteten staatlichen Grundrechte, vor allem nach 1945 in völkerrechtlichen Verträgen formuliert. Dieses wird am sinnfälligsten in dem Recht auf Selbstbestimmung, welches in den beiden Pakten über bürgerliche und politische sowie kulturelle und soziale Menschenrechte von 1966 jeweils in Artikel 1 den Völkern als kollektives Menschenrecht zuerkannt wird.
Die Aufnahme eines kollektiven Rechts in die beiden Pakte individueller Rechte ist insofern folgerichtig, als auch das Recht auf Selbstbestimmung den Völkern Freiheitsrechte gegenüber rassistischer und kolonialistischer Unterdrückung des Staates gibt.
Vom Verfassungs- zum Völkerrecht
Die historisch frühesten Dokumente menschenrechtlicher Normen waren Freiheits- und Schutzforderungen gegen die eigene Herrschaft: Sei es die Magna Charta Libertatum (1215) gegen die Krone, die Petition of Rights (1628) gegen Karl I. zum Schutz der Person und des Eigentums, die Habeas Corpus Akte (1679) zum Schutz vor willkürlichen Verhaftungen oder die Bill of Rights (1689), die die „angemaßte Macht“ der „königlichen Autorität“ gegenüber dem Parlament einschränkte (3). Sie alle hatten verfassungs-, nicht völkerrechtlichen Charakter.
Auch die ersten echten Kodifikationen der modernen Menschenrechtsgeschichte waren verfassungsrechtliche Dokumente des Unabhängigkeits- und Freiheitswunsches gegen koloniale Fremdherrschaft (Declaration of Rights of Virginia vom 12. Juni 1776, Declaration of Independence vom 4. Juli 1776) oder gegen feudal-absolutistischen Despotismus (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen vom 26. August 1789 und 3. September 1791 sowie 24. Juni 1793). Es waren Dokumente der republikanischen Staatsgründung aus der Idee der Menschenrechte.
Aber schon frühzeitig kommt die völkerrechtliche Dimension des menschenrechtlichen Schutzes zum Tragen, als es um die Abschaffung der Sklaverei und das Verbot des Sklavenhandels geht. In dem berühmten Fall der Meuterei auf der Amistad vor dem Supreme Court der USA in den Jahren 1840/41 ging es einerseits um das Recht auf Freiheit von Sklaverei, andererseits um die Durchsetzung dieses Rechts gegenüber den Ansprüchen eines anderen Staates, das heißt die universelle Geltung des Menschenrechts. Vor der kubanischen Küste kam es 1839 auf dem Schiff Amistad zum Aufstand von Sklaven, die kurz zuvor von Sierra Leone/Afrika nach Havanna gebracht und dort verkauft worden waren. Sie töteten den Kapitän und Schiffskoch und wollten zurück in ihre Heimat segeln.
Doch der spanischen Segelmannschaft, auf die die Afrikaner angewiesen waren, gelang es, das Schiff in nordamerikanische Küstengewässer zu steuern, wo es von der US-Küstenwache aufgebracht wurde. Nun beanspruchten die Spanier als „Eigentümer“ das Schiff und die Waren, worunter sie auch die Sklavenfracht der Afrikaner verstanden. Das forderte auf der anderen Seite die „Abolitionisten“ heraus, die seit Jahren in den USA für die Abschaffung der Sklaverei und des Sklavenhandels fochten. Sie mobilisierten die Öffentlichkeit und konnten für den Fall erhebliche Aufmerksamkeit erringen.
Der Supreme Court stand vor der Frage, ob die Afrikaner schlicht als Ware zu gelten haben und ob ihr Aufstand eventuell gerechtfertigt war. Denn wenn ihr Aufstand als Akt der Piraterie und Räuberei anzusehen war, mussten sie nach dem amerikanisch-spanischen Vertrag von 1795 an Spanien zurückgegeben werden. Der Supreme Court folgte Richter Joseph Story und entschied mit acht zu zwei Stimmen am 9. März 1841 „nach den ewigen Prinzipien der Gerechtigkeit und des internationalen Rechts“, dass die Afrikaner freie Menschen und keine Ware seien (4).
Insbesondere sei sowohl nach US-amerikanischem wie auch nach spanischem Recht und internationalen Verträgen die Begründung von Eigentum an Sklaven nicht mehr möglich. Die „Negroes“ seien also nicht Sklaven, sondern illegal gekidnappte und an Bord der Amistad festgehaltene Afrikaner, die ihr Recht auf Freiheit legal zu erkämpfen versuchten und daher keine Piraten seien.
Die Bedeutung dieser Entscheidung liegt nicht nur in der Anerkennung des Freiheitsrechts, sondern auch in der Durchsetzung seiner internationalen Gültigkeit über die Grenzen des eigenen Staates hinaus und der Kompetenz des Gerichts, es auch gegen einen fremden Staat durchzusetzen. Der Kampf um das Menschenrecht der Freiheit von Sklaverei war nur in seinen völkerrechtlichen Dimensionen zu gewinnen. Heute ist das Verbot der Sklaverei in allen universellen und regionalen Menschenrechtsverträgen enthalten.
Es gehört zum ius cogens des Völkerrechts, welches alle Staaten zwingend verpflichtet. Dennoch beobachten wir neue moderne Formen der Sklaverei in den Arbeitsverhältnissen — ob Kinderarbeit, Schuldknechtschaft, Zwangsarbeit und Zwangsprostitution et cetera; Menschenrechtsorganisationen rechnen mit bis zu 27 Millionen Menschen in moderner Sklaverei. Der Einklang von Völkerrecht und Menschenrechten scheint erschlafft.
Dies wird besonders deutlich, wenn man den Artikel „Menschenrechte“ liest, den Gustav von Struve, radikaldemokratischer Revolutionär, geprägt von den Schriften Jean-Jacques Rousseaus, drei Jahre nach der Entscheidung des US Supreme Courts im „Staats-Lexikon oder Encyklopaedie der Staatswissenschaften“ von Carl von Rotteck und Carl Welcker verfasste. Er beginnt bei der Sklaverei, die weder von den Griechen, Römern oder Juden in Zweifel gezogen wurde (5), und sah in der Lehre Christi die ersten Ansätze zur Anerkennung ewiger und unveräußerlicher Menschenrechte auf der Basis der Gleichberechtigung aller Menschen.
Allerdings wurde der „Urgedanke reiner Menschlichkeit“ durch den „Gedanken der Kirche“, der schon 313 u. Z. mit dem Mailänder Toleranzedikt Kaiser Konstantins das Christentum auf den Weg zur Staatskirche brachte, verdrängt. So bedurfte es erst der Freiheitskämpfe der Völker, die bereits mit der Loslösung der Schweizer Eidgenossen vom Deutschen Reich im Krieg gegen Kaiser Maximilian I. und dem Frieden zu Basel 1499 begannen, und der literarischen Kraft der bedeutendsten Denker des 16. bis 18. Jahrhunderts in England und Frankreich (6), um die praktischen und theoretischen Grundlagen der Menschenrechte zu legen. So etwa Thomas Hobbes mit seinem „Leviathan“ (1651), John Locke mit „Two Treatises of Government“ (1689), Jean-Jacques Rousseau mit „Du contrat social“ (1762), Thomas Paine mit „Rights of Man“ (1791/92), um nur die Bedeutendsten zu nennen.
Die beiden revolutionären Verfassungen Frankreichs von 1791 und 1793 enthalten bereits alle Freiheits- und Gleichheitsrechte, die auch heute den Kern der menschenrechtlichen Garantien in der Universellen Menschenrechtsdeklaration vom 10. Dezember 1948 und den beiden Internationalen Pakten über zivile und politische sowie über ökonomische, soziale und kulturelle Rechte vom 16. Dezember 1966 bilden. Nach Artikel 2 der Verfassung von 1791 sind diese Rechte „die Freiheit, das Eigentum, die Sicherheit, der Widerstand gegen Unterdrückung“, die Artikel 2 der Verfassung von 1793 ausdrücklich um das Recht der Gleichheit ergänzt.
Struve, der sich im April 1848 an dem bewaffneten Aufstand in Baden beteiligte und nach dessen Scheitern in die USA emigrierte, wo er sich auf Seiten der Union am Sezessionskrieg 1861/62 beteiligte (7), sah die Menschenrechte durchaus materialistisch: „Die erste Voraussetzung menschlicher Kräfte ist das physische Leben und folgeweise alles dasjenige, was zur Erhaltung desselben notwendig ist (…) (Das erfordert) gesunde Nahrung, eine schützende Wohnung und hinreichende Kleidung.
Der Mensch hat also das ewige und unveräußerliche Recht, von dem Staate, dessen Mitglied er ist, zu verlangen, sich so zu organisieren, dass jeder Mensch ohne Unterschied des Standes, des Alters und des Geschlechts diese Voraussetzungen des Lebens habe.
Solange die ärmeren Klassen des Volkes Not leiden an den unvermeidlichen Bedürfnissen des Lebens, haben sie daher ein vollgültiges Recht, zu verlangen, dass die reicheren Klassen ihnen von ihrem Überfluss so viel abgeben, als zu diesem Behufe erforderlich ist“, schreibt Struve ein Jahr vor der Publikation des „Kommunistischen Manifests“.
Er fordert eine „gänzliche Umwandlung unseres Steuersystems“ mit radikaler Entlastung des „besitzlosen Arbeitsstandes“ und progressiv steigender Einkommens- und Erbschaftssteuer derjenigen, „welche mehr haben oder erwerben, als sie zu ihrem Lebensunterhalte bedürfen, und zwar in demselben Maße höher, als ihr Überfluss größer ist“ (8).
Er hat erkannt, dass die vollkommene Verwirklichung der Menschenrechte nur mit der radikalen Umgestaltung der materiellen Verhältnisse zu erreichen ist. Er war damit nicht weit von Karl Marx entfernt, der die strukturelle wechselseitige Abhängigkeit von kapitalistischer Produktion/Zirkulation und Recht, vor allem der Menschenrechte, aufgezeigt (9) und nach der bürgerlichen die soziale Revolution gefordert hatte.
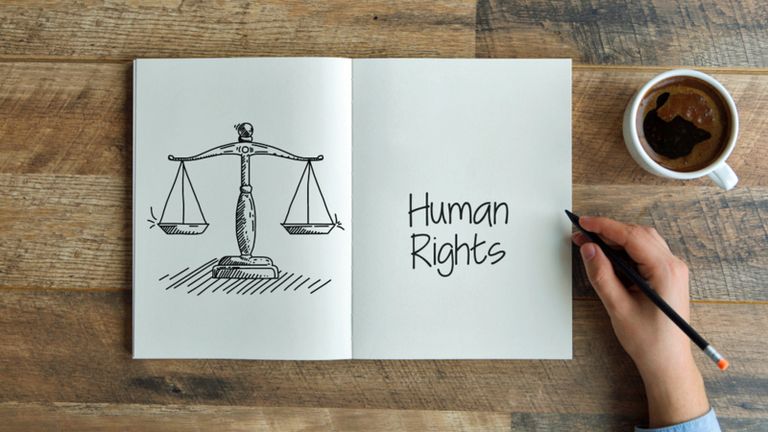
Begriffe und Wesen des Völkerrechts
- Begriff, Wesen und Grundsätze des Völkerrechts
Das Völkerrecht umfasst jene Rechtsvorschriften, welche die Beziehungen zwischen Völkerrechtssubjekten (siehe zu diesen Abschnitt III.) regeln und nicht dem autonomen Recht eines dieser Völkerrechtssubjekte zugehören. Diese Vorschriften haben Rechtscharakter, mag es auch vorkommen, dass sich die Völkerrechtssubjekte aus politischen Erwägungen über völkerrechtliche Verpflichtungen hinwegsetzen und diese Rechtsverletzungen sanktionslos bleiben (siehe unten Abschnitt V.).
Die Grundsätze des modernen Völkerrechts kommen in der Erklärung der Generalversammlung der Vereinten Nationen über Grundsätze des Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen vom 24.10.1970 (UN-Prinzipiendeklaration 1970) zum Ausdruck, verdichten sich aber in zahlreichen weiteren Rechtsakten der internationalen Gemeinschaft. Im Einzelnen wird das Völkerrecht von folgenden Grundsätzen geleitet:
- Grundsatz des Gewaltverbots
Jeder Staat hat die Pflicht, in seinen internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale
Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit
den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen.
- Grundsatz der friedlichen Streitbeilegung
Jeder Staat hat seine internationalen Streitigkeiten mit anderen Staaten durch friedliche Mittel (etwa durch Verhandlung, Vermittlung, Vergleich, Schiedsspruch oder gerichtliche Entscheidung) beizulegen.
- Grundsatz des Interventionsverbots
Kein Staat hat das Recht, in die inneren oder äußeren Angelegenheiten eines anderen Staates einzugreifen.
- Grundsatz der internationalen Zusammenarbeit
Die Staaten haben die Pflicht, in den verschiedenen Bereichen der internationalen Beziehungen miteinander zusammenzuarbeiten.
- Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker
Alle Völker haben das Recht, frei und ohne Einmischung von außen über ihren politischen Status zu entscheiden und ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung zu gestalten.
- Grundsatz der souveränen Gleichheit der Staaten
Alle Staaten genießen souveräne Gleichheit. Sie haben gleiche Rechte und Pflichten und sind ungeachtet wirtschaftlicher, sozialer, politischer und anderer Unterschiede gleichberechtigte Mitglieder der internationalen in internationalen Organisationen).
- Grundsatz von Treu und Glauben
Jeder Staat hat seine völkerrechtlichen Verpflichtungen nach Treu und Glauben (bona fides) zu erfüllen, also unter Achtung der Gemeinschaftswerte und der Interessen der anderen Mitglieder.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen
Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.